Horst Schwebel im Gespräch mit …

... Meinhard von Gerkan
Über Architektur
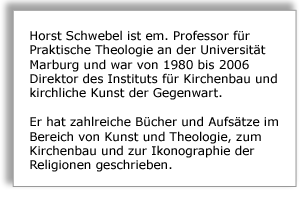 Schwebel: Ich möchte gleich mit der Frage nach der Gebundenheit und Freiheit des Architekten beginnen und frage Sie direkt: Sie sind Architekt. Fühlen Sie sich in Ihrem Beruf als Künstler oder würden Sie Ihren Beruf anders definieren? Schwebel: Ich möchte gleich mit der Frage nach der Gebundenheit und Freiheit des Architekten beginnen und frage Sie direkt: Sie sind Architekt. Fühlen Sie sich in Ihrem Beruf als Künstler oder würden Sie Ihren Beruf anders definieren?
von Gerkan: Obwohl ich der Auffassung bin, dass die Architektur die Mutter der Künste ist - was früher wohl allgemeiner Konsens war - würde ich gleichwohl sagen, dass sich die Kunstgattung Architektur von allen anderen wesentlich unterscheidet.
Schwebel: Inwiefern unterscheidet sich die Architektur von den anderen Künsten?
von Gerkan: Architektur unterliegt nicht der Entscheidung eines einzelnen, eines Künstlers, sondern Architektur entsteht immer aus einem dialogischen Prozess und ist an Voraussetzungen und Bedingungen gebunden.
Schwebel: Dann gibt es also keine Architektur an sich?
von Gerkan: Architektur kann nicht per se entstehen. Es gibt zwar einige Architekten, die ein Monument gebaut haben, ohne dass es dafür irgendein Nutzungsbedürfnis gab. Doch ich denke, man kann für Architektur fast ausnahmslos sagen, dass sie immer eine Kunst der sozialen Anwendung ist. Ein Kunst, die sich auf die sozialen Bedürfnisse der Menschen bezieht, auf die Bedingungen, die gesetzlichen, sozialen, ökonomischen, technischen und nicht zuletzt natürlich auch die örtlichen.
Schwebel: Das ist bei der freien Kunst in der Regel anders, obgleich es natürlich auch angewandte Kunst gibt.
von Gerkan: Jedes Stück Architektur ist an einen Ort gebunden, einen Ort, den es auf der Welt nur einmal gibt, wenn sich auch viele Orte inzwischen ähneln. Wenn man sich beispielsweise amerikanische Siedlungen anschaut, kann man feststellen, dass die gleiche Kaffeemühle auch woanders stehen könnte. Trotzdem ist jeder Ort, auf dem Architektur entstehen soll, einzigartig. Und die Architektur ist den Bedingungen dieses Ortes unterworfen, sei es die Topografie, sei es die Nachbarschaft, ob eher Land oder Stadt.
Schwebel: Was dann immer zu unterschiedlichen Entscheidungen führt ...
von Gerkan: Ja. Und auf Grund dieser Bedingungen steht Architektur im Gegensatz etwa zur Malerei und Bildhauerei, also im Gegensatz zur bildenden Kunst, aber auch zur Literatur, wo der Künstler aus sich, aus seinen Gedanken, Gefühlen - etwa einem Farbklang folgend -, etwas künstlerisch zu Wege bringt. Demgegenüber hat Architektur immer eine Funktion, eine Funktion in der sozialen Einbettung und in der Topographie der Landschaft.
Schwebel: Herr von Gerkan, das Wort „Architekt“, wenn man es vom Ursprung her ableitet, ergibt im Grunde zwei Interpretationsmöglichkeiten. Ich habe mich hier von einem Altphilologen, dem Marburger Gräzisten Arbogast Schmitt, beraten lassen. Der Architekt ist der erste der Bauhandwerker, der architektos, sowie der archihiereus, der Oberpriester, der erste der Priester ist. Das Wort archae oder im Plural die archai beziehen sich auf die Grundprinzipien. Der Architekt ist derjenige, der mit den Grundprinzipien zu tun hat, mit den Anfängen, den Ursprüngen. Die beiden Ableitungen lassen sich auch miteinander verbinden. Der Architekt ist deshalb der erste der Bauhandwerker, weil er um die Grundprinzipien, weil er um die archai weiß. Würden Sie den Begriff des Architekten ähnlich verstehen?
von Gerkan: Mit der philologischen Herleitung, die Sie eben entwickelt haben, könnte ich mich identifizieren, weil über die Nennung des Begriffs Architekt etwas über den Beruf zum Ausdruck gebracht wird, was aus dem Allgemeinverständnis des Wortes Architekt weitgehend verdrängt worden ist. Wie ich schon sagte, ist Architektur immer ein Prozess in Auseinandersetzung mit anderen Beteiligten und deshalb ist Führung erforderlich. Architektur kann man nicht allein im Kämmerlein machen. Es gibt sehr viele Beteiligte. Leute, die das Geld geben, Leute die das Grundstück haben, Leute die es bewohnen und benutzen wollen - bis hin zu Behörden, die es zu genehmigen haben. Deshalb ist ein Verständnis, dass es dabei um Grundsätze, um Prinzipien, um eine typologische Gesamtheit geht, hilfreich und notwendig.
Schwebel: Weil sonst die partikularen Interessen auseinanderdriften ...
von Gerkan: Ja. Man muss bedenken, dass es partikulare Interessen unterschiedlichster Art gibt, allen voran, wie viel etwas kostet. Aber es sind natürlich auch viele andere Interessen mit im Spiel, die in Widerspruch zueinander stehen. Und da die Dinge heute sehr spezialisiert sind, bis hinauf zu Gremien, an denen viele Personen teilhaben, weil also immer Einzelinteressen vertreten werden und sich daraus natürlicherweise Streit entwickelt, kommt es in diesem Szenario auf die Rolle des Architekten an. Wenn er sein Rolle so versteht, wie Sie sie definiert haben und wie ich sie auch verstehe, dann hat der Architekt einen schwierigen Stand, weil er das gesamtheitliche Anliegen der baulichen oder städtebaulichen Bauaufgabe zu vertreten hat. Andere sind für anderes zuständig, etwa die Verträglichkeit der Temperatur oder die Lautstärke – die Lautstärke in Dezibel -, Dinge, die man alle messen kann. Die Qualität von Architektur kann man aber nicht messen, sondern sie ist immer konzeptionell bedingt. Es wird ja auch geklagt, dass es konzeptionslose Architektur gibt. Es gibt konzeptionslose Häuser, die einem einseitigen Diktat, z. B. dem der Ökonomie folgen.
Schwebel: Welche Qualitäten muss der Architekt mitbringen, damit nicht alles auseinander läuft?
von Gerkan: Am befriedigsten ist die Tätigkeit als Architekt immer dann, wenn man in dem Sinne arbeitet, dass man sich um die Grundzüge, um das Wesentliche, kümmert. Von daher lässt sich dann auch die Konzeption des ersten Baumeisters entwickeln oder des primus inter pares innerhalb eines Szenarios mit vielen Beteiligten. Diese Konzeption wird oft als hochmütig oder als überheblich verstanden. Doch diese Kritik ist unberechtigt. Kein Musiker in einem großen Orchester würde sich darüber beschweren, dass einer dirigiert. Das größte Defizit in der Planung von Architektur heute und vor allem in der Stadtplanung besteht darin, dass die Dirigentenrolle gar nicht besetzt ist, und dass die Architekten, denen es zukäme, sie zu besetzen, die Rolle nicht wahrnehmen und sich damit ihrer Führungsrolle verweigern.
Schwebel: Hat denn jeder Architekt seine je eigenen Prinzipien und Vorstellungen, oder gibt es eine Verbindlichkeit in den architektonischen Grundpositionen?
von Gerkan: Nach meinem Erfahrungshintergrund und der Entwicklung, die ich durchlebt habe, befinden wir uns im Moment in einem Zustand, in dem die Positionen extrem weit auseinander gehen. Wir haben ein Höchstmaß an Divergenz. Einen Grundkonsens im Sinne des traditionellen Baumeisters scheint es überhaupt nicht mehr zu geben. Es gibt die verschiedensten Strömungen und Richtungen gleichzeitig. Moderne, Dekonstruktivismus, die wieder entdeckte Moderne sind gleichzeitig vorhanden, stoßen aufeinander und werden gleichermaßen bekämpft oder befürwortet.
Schwebel: Ist diese Vielfalt in der Architektur etwas Neues?
von Gerkan: Sie steht sogar in Gegensatz zu der gesamten Baugeschichtsvergangenheit. Es wurde zu jeder Zeit immer aus einem allgemeinen Konsens heraus gebaut. Früher hat man an einer Kathedrale 80 Jahre lang gebaut. So etwas war möglich. Wenn man jetzt überlegt, dass wir in den letzten 20 Jahren mindestens 15 - 20 verschiedene Ismen hatten also fast jedes Jahr einen Paradigmenwechsel, dann hätte man früher gar keinen Bau mehr vollenden können, weil man ständig neue Erkenntnisse hätte einbringen müssen.
Schwebel: Ist damit ein Grundkonsens ausgeschlossen? Gibt es ein richtig und falsch in der Architektur?
von Gerkan: Natürlich ist es so, dass Architekten ihre eigene Philosophie haben, ihr eigenes Leitbild und auch eine Orientierung, was falsch und richtig ist. Ich habe in meiner Lehre als Hochschulprofessor aber immer gesagt: Die meisten Dinge in der Architektur sind eben nicht falsch und richtig, es ist immer eine Frage des individuellen Ermessens. Es ist in erster Linie eine Frage der Verhältnismäßigkeit und der Korrespondenz eines Einzelaspektes zum Ganzen. Trotzdem gibt es so etwas wie einen Konsens, ganz bestimmte Leitlinien.
Schwebel: Sie haben doch in Ihren Bauten bestimmte Prinzipien, an denen Sie sich orientieren, beispielsweise Ihr Umgang mit dem Material? Gibt es hier ein echt und unecht, eine moralische Position?
von Gerkan: Es geht uns nicht darum, einen Stil zu entwickeln, der ein Erkennungszeichen sein könnte – wie jemand, der immer Cortenstahl verwendet oder der sich auf Filz und Fett festgelegt hat. In der Architektur ist eine solche Einschränkung auf ein ganz bestimmtes Vokabular nicht gut. Bei der Architektur muss die Bezogenheit auf den Ort und seine Bedingungen das primäre sein. Eine ideologische Position würde ich ablehnen, auch der Begriff moralisch würde mir an dieser Stelle missfallen. Denn es ist keine moralische Kategorie, wohl aber eine inhaltliche der Angemessenheit, wenn man z. B. Materialien bevorzugt, die in ihrem natürlichen Zustand erhalten bleiben.
Schwebel: Können Sie das an einem Beispiel erläutern?
von Gerkan: Also, eine Holzverbindung ist etwas völlig anderes als ein Verbindung mit Stahl. Innerhalb der Stahlkonstruktionen hat sich einiges verändert. Bei alten Stahlkonstruktionen von vor hundert Jahren - etwa bei den Bahnhöfen - waren die Teile alle genietet, und die Oberfläche der Stahlkonstruktion des Gebäudes lebte von den Nieten. Heute wäre es abwegig, Stahl zu nieten, weil es viel zu arbeits- und zeitintensiv ist, heute werden beim Stahl die Verbindungen geschweißt. An diesem Beispiel lässt sich zeigen, dass sich hier eine Technologie verändert hat und damit die Bedingungen, wie man gestalterisch mit einem Material umgeht. Wenn sich jemand in den Kopf gesetzt hat, Nietbilder zu haben, und das durchsetzen würde, würde er die Technologie, die sich u. a. aus ökonomischen Gründen verändert hat, ignorieren und sich nicht auf die aktuellen Bedingungen beziehen.
Schwebel: Sie hatten des Öfteren gefordert, dass bei der Verwirklichung eines Bauvorhabens Einfachheit und Ökonomie als Kriterien gelten sollten. Können Sie erklären, wie Sie den Begriff Einfachheit verstanden wissen wollen?
von Gerkan: Der Begriff Einfachheit ist leicht missverständlich. Es gibt nicht viele Begriffe, die im Allgemeinverständnis gleichermaßen positiv wie negativ besetzt sind. Wenn etwas einfach ist, sagen viele, dann ist es etwas armseliges. Ein einfach gekochtes Essen ist das Essen armer Leute. Aber es gibt die andere Position - und auf dieser Seite befinde ich mich -, die genau darin die Qualität sieht. Um beim Essen zu bleiben: Mir ist ein einfaches Essen, das frisch und gut zubereitet ist, viel lieber als ein anspruchsvolles Essen, das nur ein bisschen daneben gegangen ist. Bei einfacher Kost kann man lange Zeit immer wieder das gleiche essen, das ist bei der anspruchsvollen Kost nicht so. Was würde ich essen, wenn ich jetzt ins Gefängnis käme und die Möglichkeit hätte, mich für eine einzige Speise zu entscheiden, die ich mehrere Monate jeden Tag essen müsste. Dann kann man nur sagen, entweder Reis, Kartoffeln oder Brot. Alles andere geht doch gar nicht. Ich kann nicht jeden Tag Kaviar essen.
Schwebel: Eine grauenvolle Vorstellung, da kann’s einem ganz schnell übel werden.
von Gerkan: Und das kann man sinngemäß auf die Architektur übertragen. Was ich meine, ist, dass in der Einfachheit Dinge selbstverständlich, logisch und sinnfällig geregelt sind. Dass es Sinn macht, etwas so zu machen und nicht anders. Der Begriff des „Sinn machen“ ist doppeldeutig. Einmal im Hinblick auf die Sinnlichkeit, also die Wahrnehmung, und dann in Hinblick auf das Sinnvolle angesichts der Aufgabe, der Funktion, der Form, des Materials – all dessen, was Architektur konstituiert. Die Sinnlichkeit in der Wahrnehmung gehört dazu, ein Wohlbefinden in der Architektur, die Materialwahl, die Schaffung von Körpern und Räumen bis hin zum Detail, also der Fügung jedes einzelnen Teils. Es geht darum, Lösungen zu finden, die so einfach und selbstverständlich wie nur irgend möglich sind.
Schwebel: Dann ist also diese Art der Einfachheit das Ergebnis eines langen Weges, die schwere Einfachheit sozusagen.
von Gerkan: Es ist nicht so, dass das Einfache einfach wäre. Nein, das Einfache ist hoch kompliziert. Man stellt immer wieder fest, insbesondere wenn man Möbel entwirft, wie schwer es ist, Dinge in ihrer Gesamtheit zu reduzieren, etwa bei einem Holzmöbel auch wirklich nur Holz zu verwenden und es nicht mit Stahl und Kunststoff zu mixen. Oder eine Fügung so auszuführen, dass sich Stabilität und Dauerhaftigkeit mit der Anmut der Form verbindet. Bei der Findung von Körpern und Räumen ist nahezu alles, was man heute machen kann, möglich. Es gibt keine technische Beschränkung, man kann jede noch so komplizierte Form bauen. Es gibt die neue Welle der organischen Architektur, die mit dem Einsatz von Kunststoff und Folien arbeitet.
Schwebel: Das würde dem von Ihnen geforderten Prinzip der Einfachheit widersprechen.
von Gerkan: Ja, für mich ist das andere nahe liegender. Der Entstehungsprozess von Architektur ist ein Prozess des Kopfes. Es sind zunächst Gedanken und Kopfarbeit nötig, und erst danach kommt der Bleistift oder der Computer hinzu, mit dem dann das Ganze bildlich wird. Was wir mit unserer menschlichen Logik normalerweise konstruieren, unterliegt Gesetzmäßigkeiten. Und die Geometrie ist ein System, das diese Sinnfälligkeit und Einfachheit aus sich, aus ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten heraus, rekonstruiert. Aus diesem Grund liegt es für mich nahe, die Geometrie zur Schaffung und Findung von Formen zu verwenden.
Schwebel: Wenn man die Natur anschaut, dann sind die Bäume beispielsweise krumm gewachsen, weil die Spiralen des Wassers sie so geformt haben. Architekten, die das Organische aufnehmen wollen, versuchen, dem Ungeraden und Krummen Rechnung zu tragen. Dem Organischen mit organischer Architektur begegnen, das würden Sie nicht tun. Sie entscheiden sich für Ordnung, für Geometrie. Wer die Geometrie wählt, wählt den geraden Winkel. Ist Geometrie eine Sache, die sich gegen das Leben stellt?
von Gerkan: Ich denke, das Ergebnis, das konzeptionelle Ergebnis, so wie es sich bildlich oder dreidimensional manifestiert, muss sich architektonisch begründen lassen. Die Geometrie mit ihren Gesetzmäßigkeiten, die in sich eine Stimmigkeit haben, ist eine Art Grammatik. Auch bei der Sprache brauchen wir, um die Dinge ausdrücken zu können, eine Grammatik. Wenn man für das Erfinden freier beliebiger Formen keine inhaltliche Begründung hat, sondern sie nur aus einem vermeintlichen künstlerischen Bezug schafft, ist dies nach meinem Empfinden eine Art Willkürakt. Die schlimmste Willkür ist es, organische Formen der Natur bloß im Formalen zu übernehmen. Auch die organischen Formen sind bei ihrer Entstehung einem Prinzip der Logik gefolgt. Alles, was sich in der Evolution der Erdgeschichte entwickelt hat, hat sich aus dialogischen Prozessen entwickelt. Es ging bei dieser Auseinandersetzung um Probleme der Selbstbehauptung und des Überlebens. Durch die Prozesse der Generierung sind die ganzen Mutationserscheinungen zum Tragen gekommen. Dies nur formal zu adaptieren und gewissermaßen als ein Abziehbild zu benutzen, halte ich für äußerst problematisch und fragwürdig. Ich will nicht bestreiten, dass es Gründe geben kann, Räume und Körper auch anders zu gestalten. Das erfolgt dann vielleicht aus rein semantischen Überlegungen oder aus atmosphärischen oder aus ideologischen wie bei den Anthroposophen, die meinen, der rechte Winkel wäre der Teufel und deswegen müsse er abgeschrägt werden. Rudolph Steiner hat dies einer jeden Architektur verordnet. Dabei sind die unmöglichsten Formen herausgekommen, die überhaupt keine Harmonie haben und eigentlich nur noch eine Art „Kartoffelarchitektur“ sind: um Himmels Willen, nur nicht kantig oder rechteckig!
Schwebel: Das Prinzip der Ordnung ist Ihnen so wichtig, weil dadurch Lebensprozesse strukturiert werden. Wenn man Bahnhöfe oder Flughäfen baut, so sind hier Leute unterwegs, von ihrem vertrauten Umfeld getrennt in einer Zwischenphase von Abfahrt und Ankunft. Es handelt sich hier um einen ganz bestimmten Lebensprozess so wie auch Wohnen ein differenzierter Lebensprozess ist. Der Architekt wird dabei primär als ein Mensch verstanden, der Lebensprozessen eine Struktur gibt, der Ordnung schafft, damit sich leben lässt.
von Gerkan: Der Begriff der Ordnung ist in gewissem Sinne ambivalent. Gleichermaßen wie der Begriff, den wir vorhin hatten, die Einfachheit. Ambivalent ist der Begriff der Ordnung deswegen, weil er auf der einen Seite etwas beschreibt, was in unserer Lebensgemeinschaft unabdingbar ist und weil er auf der anderen Seite immer die Bevormundung, die Entmündigung oder gar die Freiheitsberaubung gleichermaßen impliziert. Auf der eine Seite bin ich der Überzeugung, dass Architektur in der Tat einer Funktion, nämlich der Funktion des Lebens zu dienen hat. Es geht um Wohlbefinden, aber natürlich auch um gute Bewegungsmöglichkeiten, gute Orientierung, gute Bedingungen für den Körper. Der Mensch ist nicht in der Lage, ungeschützt in der Natur zu leben. Sonst gäbe es keine Architektur. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das einer hoch entwickelten Technologie bedarf, um selbst lebensfähig zu sein. Die meisten tierischen Lebewesen können sogar ohne jede Behausung leben, also ohne dass sie eine Höhle oder ein Nest haben. Der Mensch ist der einzige, der räumliche Bedingungen braucht, die sich auf rein natürliche Weise nie und nimmer befriedigen lassen.
Schwebel: Bauen in Einfachheit, Materialstimmigkeit, Ökonomie der Mittel, das sind Stichworte Ihres architektonischen Credos. Gibt es aber nicht trotzdem Organik oder zumindest Ansätze hierzu?
von Gerkan: Es wird irrtümlicherweise von vielen Architekturkritikern so etwas hineininterpretiert - was aber völlig falsch ist. Z. B. haben wir bei verschiedenen Bauten, allen voran beim Flughafen Stuttgart, Baumstützen verwendet. Man sprach dabei von einer Analogie der Architektur zur Natur. Wir haben Baumstämme eingesetzt als sich verästelnde Stützen, Punkte, auf denen das Dach lagert und die Last somit auf eine größere Fläche verteilt wird. Die Fehlinterpretation der Kritiker sagt, dieses sei eine Entlehnung aus der Natur, denn der Baum würde sich gleichermaßen verästeln. So weit so gut. Nur, der Baum tut das unregelmäßig, während unsere Konstruktion streng geometrisch ist. Der Grund, dies so zu machen, ist dem des Baumes absolut entgegengesetzt. Denn der Baum verästelt sich, um eine möglichst große Fläche mit seinem Laubwerk der Sonne auszusetzen, damit die Aufnahme der Sonnenkraft, die Osmose, gefördert wird. Der Baum tut dies nicht, weil er etwas tragen muss, sondern er trägt ja nur die Blätter, während unsere Baumstütze sich deshalb „verästelt“, damit das Tragwerk das Dach halten kann, weil es nämlich an viel mehr Punkten unterstützt wird, als wenn die Stütze nur in der Mitte wäre und dann große Spannweiten entstehen würden. Es ist zwar eine bildliche Analogie da, und wir benutzen auch das Bild der Dolde. Das leuchtet jedem ein, aber der Schluss, der daraus gezogen wird, ist schlichtweg falsch. Wir haben nicht der Natur ein Gesetz abgeguckt, um Lastgut tragen zu können. Das tun die Bäume ja gar nicht. Sie sind ja nicht dafür gebaut, wie das Dach möglichst viel Schnee zu tragen, sondern sie haben sich so entwickelt, um den Osmose-Prozess zu ermöglichen.
Bauen für Religion
Schwebel: Bisher stand das Verständnis von Architektur im Allgemeinen im Zentrum unseres Gesprächs. Ich möchte einen Sprung machen und auf das Bauen für Religion zu sprechen kommen. Wenn man einen Flughafen baut oder einen Bahnhof oder ein Wohnhaus, dann hat man sehr klare Funktionen vor Augen, die zu erfüllen sind. Aber beim Bauen für Religion ist das ganz anders. Wie sind Sie auf der EXPO mit diesem Problem zurechtgekommen?
von Gerkan: Zunächst ist die Feststellung richtig, dass sich diese Bauaufgabe am deutlichsten von allen sonstigen Bauaufgaben unterscheidet, weil sie dem normalen funktionellen Bedingungsfeld nicht unterworfen ist. Im gewissen Sinne ist dies vielleicht noch bei Museumbauten der Fall, aber selbst da muss man ja zumindest Flächen schaffen, wo man die Bilder aufhängen kann und für genügend Licht sorgen. Ansonsten ist der Freiheitsgrad, wie die jüngsten Entwicklungen gezeigt haben, auch hier sehr groß. Wenn sich ein Museumsbau selbst als Kunst versteht - was häufig der Fall ist - , dann wird die Kunst nahezu überflüssig. Beim Kirchenbau oder beim Bau für Religion ist der Freiheitsgrad des Architekten natürlich sehr viel größer als bei Funktionsbauten. Doch je größer der Freiheitsgrad ist, um so schwieriger ist die Aufgabe.
Schwebel: Freiheit kann also auch bedrohlich werden?
von Gerkan: Das Schlimmste ist, wenn ich einem Architekturstudenten die Aufgabe gebe: Bau dein Idealhaus und such dir dein Idealgrundstück! Du bekommst keine Vorgaben! - Dabei kommt entweder gar nichts oder nur Mist heraus. Also, nichts ist schlimmer als keinen Widerstand zu haben, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Da das Bauen für Religion heute nicht mehr zu den alltäglichen Aufgaben gehört, sondern eine sehr seltene Aufgabe darstellt und auch viele tradierte Vorstellungen nicht mehr gültig sind, steht man zunächst allein da.
Schwebel: Gibt es für Sie an diesem Punkt überhaupt noch Leitbilder?
von Gerkan: Sie sind alle samt auf Grund aller möglichen Entwicklungen zerbrochen. Hierzu zähle ich auch die Kapelle in Ronchamp von Le Corbusier, einem sehr eindrucksvollen Bau, der mit der Art und Weise, wie er Licht inszeniert, ein Mysterium erzeugt, dieses aber gleichwohl in einer Bauweise tut, die aus meiner Sicht unaufrichtig ist. Diese wie eine Festung wirkenden Wände sind Hohlwände, Hohlkörper. Sie tun so, als ob sie schwer und mächtig wären, aber man könnte in sie hineingehen.
Schwebel: Ronchamp ist für einige Kirchenbaumeister zum Leitbild geworden, gerade für solche, die sich des Betons als Material bedient haben. Sie haben die Leitbildfunktion von Ronchamp soeben abgelehnt.
von Gerkan: Es gibt kein Leitbild mehr. Ich habe mich natürlich auch danach gefragt, als wir bei der EXPO mit dieser Aufgabe konfrontiert waren. Was ist das Wesentliche, wenn man in einem großen Überblick die gesamte Baugeschichte religiöser Bauten aufzeigen würde? Was ist das Anliegen von Bauten für Religion gewesen? Dann bleibt für mich eigentlich nur eines übrig, das ist die Wahrnehmung von einem Erhabenheitsgefühl, ein Übersteigen des eigenen Ich auf eine Transzendenz hin, die zu verschiedenen Zeiten auf ganz unterschiedliche Weise vermittelt wird.
Schwebel: Bereits die abendländische Geschichte umfasst ein großes Spektrum, wenn man sich eine Basilika anschaut, die Hagia Sophia, gotische Dome, Barockkirchen oder die bereits erwähnte Kapelle von Ronchamp. Doch Sie würden hier auch ein Gemeinsames sehen: die Ausrichtung auf Transzendenz oder auf das Erhabene.
von Gerkan: Wenn man Bauten anderer Religionen mit einbezieht, seien es die des Islam oder des Buddhismus, wo wieder andere räumliche Mittel eingesetzt wurden, so haben diese Bauten etwas Gemeinsames. Es ist ihnen gemeinsam, durch den Raum eine Art Ausnahmezustand in der Wahrnehmung zu erzielen.
Schwebel: Der Architekt steht faktisch dadurch, dass es kein Leitbild mehr gibt, vor einem Nichts oder der unbegrenzten Freiheit: Ich habe zwar kein Vorbild, an dem ich mich einfach orientieren kann, trotzdem stehe ich unter dem Anspruch, dass etwas Bedeutendes, etwas Außergewöhnliches, zu Stande kommen soll.
von Gerkan: Das ist ja das Schlimme. Aus diesem Grund gibt es ja unter den Kirchenbauten auch unglaublich viele Entgleisungen. Entgleisungen, weil hier „etwas ganz Tolles“ passieren soll.
Schwebel: Das Außergewöhnliche der Aufgabe ist nicht als Event vom Äußerlichen her zu begreifen, sondern vom Inneren her.
von Gerkan: Es entsteht dann nämlich dieses grundlegende Missverständnis, beim Architekten etwas einzufordern, was bei der bildenden Kunst an der Tagesordnung ist, nämlich den Ausdruck per se zu nutzen, um eine Partizipation beim Betrachter zu erzeugen.
Schwebel: Haben Sie beim Bauen für Religion, etwa beim EXPO-Pavillon für die Kirche, eine andere Einstellung als dann, wenn Sie einen Bahnhof oder einen Flughafen bauen? Sind die Mittel andere? Sie haben Formen von Erhabenheit gefunden. Waren diese Formen vorher schon da und wurden einfach herüber genommen, oder war es ein völlig neuer Einstieg?
von Gerkan: Sowohl als auch. Ich denke, es wäre mir nicht möglich gewesen, auf die Fragestellung eines christlichen Pavillons auf der Weltausstellung eine Antwort, so wie sie jetzt gegeben worden ist, zu finden, wenn ich am Beginn meiner Berufstätigkeit gestanden hätte. Ohne den Erfahrungshintergrund, ohne die Erkenntnis, dass man, je größer der Freiheitsgrad ist, sich umso mehr disziplinieren muss, sich umso mehr zurücknehmen muss, wäre es nicht gegangen. Auf der anderen Seite war es in der Tat ein großes Erlebnis und es musste ein ganzes Instrumentarium erst gefunden werden.
Schwebel: Als Sie mit Marg den Flughafen Tegel gebaut haben, das war ganz am Anfang Ihres Berufslebens als Architekt. Sie haben einmal gesagt: Wir hatten den Auftrag, einen Flughafen zu bauen, bevor wir eine Garage gebaut hatten. Der Flughafen konnte am Beginn stehen. Aber für ein religiöses Bauwerk bedurfte es eines ganzen Lebens, um dort anzukommen.
von Gerkan: Ganz so habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ein Entwurf wie dieser oder ein Konzept wie dieses nicht möglich gewesen wäre ohne langjährige Erfahrung. Höchst wahrscheinlich hätte ich am Anfang meiner Berufslaufbahn etwas Aufwendig-Angeberisches gemacht, mehr Selbstdarstellung statt Reduktion, wie ich es vielen der missratenen Kirchenbauten anlaste. Erst vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung, dass eine Aussage dann an Stärke gewinnt, wenn sie sich in den Mitteln beschränkt, wenn sie sich auf einiges Wenige reduziert, konnte es gemacht werden, wie es gemacht worden ist. Übrigens auch ein interessantes Phänomen, dass bei religiösen Bauten bei gleicher Zielvorstellung beide Extreme vertreten sind, das Überreiche in der Dekoration einer Kirche wie bei Vierzehnheiligen bis hin zur reinen Betonkirche von Taddao Ando, die außer Beton überhaupt nichts zeigt. Und, um auf das Neue angesichts der Aufgabe zu sprechen zu kommen: Grundsätzlich anders und neu war für mich die Frage, dass es sich nicht um einen Bau handeln soll, der jetzt irgendwelchen rituellen Funktionen zu dienen hat, sondern dass eigentlich das Bauwerk selbst sinnstiftend sein soll.
Schwebel: Das war ja die Besonderheit gerade dieses Bauwerks. Der Plan stand, Ihr Modell war da, aber man wusste kirchlicherseits noch gar nicht, mit welchem Programm man das Gebäude füllen sollte. Man hat sich dann faktisch auf das Bauwerk eingelassen. Zuerst gab es das Bauwerk und danach kamen die Funktionen. Das Bauwerk selbst bot Möglichkeiten eines religiösen Lebens in verschiedener Hinsicht.
von Gerkan: Ja, ja, so weit ging es damals nach dem Wettbewerb. Sie waren ja gelegentlich an dieser Diskussion selbst beteiligt. Ich sage es einmal ganz bildhaft. Es ging in dieser Diskussion um die Frage: Nun haben wir das Spielzeug, was spielen wir nun damit? Was fangen wir denn damit an?
Schwebel: So etwas habe ich vorher auch noch nicht erlebt. Erst gibt es ein Programm, dann gibt es einen Entwurf. Diesmal war es umgekehrt.
von Gerkan: Und dann kam eine endlose Latte von Überlegungen zu Aktivitäten, die natürlich erst einmal von der Quantität her total überzogen waren, die aber auch in sich nicht konsensfähig waren. Ich weiß sehr wohl, dass einige der Mitglieder dieser Gesprächsrunden immer wieder gesagt haben: Wir wollen gar keine Kirche, davon ist nie die Rede gewesen. Wir wollen einen Pavillon haben, wir wollen Action machen. Und ich denke, dass die Art und Weise, wie sich die Kirchen dann mit diesem Bau am Ende selbst dargestellt haben, aus diesem Gesprächsprozess erst erwachsen ist.
Schwebel: Sie wollten keinen Messepavillon?
von Gerkan: Ich habe immer wieder gesagt: Macht um Himmels willen nicht das gleiche Zeug, was alle auf diesem Jahrmarkt der Eitelkeit machen: Alles beschallen und alles bespielen, überall muss es flimmern und flackern und es muss Film sein. Alles weg, weg, weg! Das ist die einzige Chance, Intensität zu entwickeln. Man sollte etwas total anderes machen und nicht das, was alle anderen machen, was beispielsweise Bertelsmann macht. Die können das doch mit dem Zehnfachen vom Geld viel eindrucksvoller und viel lauter machen.
Schwebel: Welcher Mittel, welcher architektonischen Mittel haben Sie sich bedient, um dieses Gegenmodell zu verwirklichen? - Sie haben es ja schließlich geschafft.
von Gerkan: Bei der Frage nach den Mitteln muss man natürlich auch sagen, dass bei einem Verständnis von Architektur als Kunst in der sozialen Anbindung weitere Bedingungen existieren, die den Prozess der Konzeptfindung erleichtert haben, etwa gegenüber einem Zustand, wenn es das nicht gegeben hätte. Da war zunächst die Forderung, dass das Gebäude demontabel sein müsse, um es nach der Weltausstellung abzubauen, zu transportieren und an einer anderen Stelle, in Volkenroda, wieder aufzubauen. Das ist ein ganz entscheidender Parameter.
Schwebel: Für das Material?
von Gerkan: Für das Material. Es musste ein Material sein, das wieder trennbar war, man musste es auseinander nehmen können, man musste es wieder zusammensetzen können, man musste es transportieren können. Das Material Beton als gegossener Werkstoff wäre nicht in Frage gekommen. Das war die eine der Voraussetzungen.
Das zweite war der Hinweis, dass die Stahlindustrie, die sich mit einem namhaften Betrag als Sponsor beteiligen würde, sich bitte im Material wiederfinden wolle. Das war ein entscheidendes Moment. Sonst hätte man es ja auch mit Holz machen können, was mir vom Material her ganz spontan eigentlich mehr gelegen hätte.
Schwebel: Mit Holz wäre ein Abbau und Neuaufbau ebenfalls möglich gewesen?
von Gerkan: Ich muss im Nachhinein sagen, dass Stahl eine gute Entscheidung war. Es handelt sich um ein stark reduziertes Gefüge, eigentlich um ein Gerüst aus Stahlprofilen, und dieses Gerüst sollte flächige Füllungen haben.
Schwebel: Im „Kreuzgang“, einem Wandelgang, der den 16 m hohen Hauptraum umfängt, sind in dieses Gerüst Doppelgläser eingefügt, in deren Zwischenräumen Naturprodukte und technische Produkte zu sehen sind: Federn, Holzstücke, weiße und braune Zuckerstücke, aber auch kleine Tonbänder, sogar Einwegspritzen und vieles andere.
von Gerkan: Diese Idee wurde zunächst nicht ernst genommen und sogar bespöttelt. Das sind doch Primitivstoffe, - es sind ja alles Massenprodukte gewesen; entweder handelt es sich um Massenprodukte der Natur oder um Massenprodukte aus der Technik, mit denen die Scheiben gefüllt wurden. Das ist zum Schluss wie ein reifer Apfel vom Baum gefallen, nachdem es vorher in der Diskussion immer hieß, es sei so vordergründig. Ich muss gestehen, dass ich manchmal richtig verletzt war, wenn alle sagten, das sei vordergründig. Da gab es Moralisten, die sagten, jetzt fehlten nur noch die Kondome in den Glaszwischenräumen. Am Schluss hatte sich etwas eingestellt, was einen überraschenden Effekt hatte.
Aus diesen Fenstern sind gewissermaßen Gemälde geworden. Durch das einfallende Licht ergab sich eine lebendige Zeichnung, ein mit einer gewissen Regelmäßigkeit bedrucktes Glas, von links nach rechts mit einem fortlaufenden Muster. Doch es war nicht alles regelmäßig. Diese kleinen Tonbänder, die zwischen den Gläsern waren, - drei oder vier waren doch falsch herum drin und gerade dies, genau diese kleinen Webfehler, gaben dem Ganzen den Unikatcharakter.
Die Glasfensterfüllungen haben wundervolle Lichtstimmungen im Raum erzeugt, gerade durch das Nebeneinander verschiedener Werkstoffe. Auf der inhaltlich-interpretativen Ebene wurde zu guter Letzt etwas geleistet, was auch im absoluten Widerspruch zu all dem stand, was links und rechts in den anderen Pavillons zu finden war. Dort wurde mit visueller Rhetorik inszeniert und erklärt, und hier wurde etwas scheinbar Simples aufgezeigt und überhaupt nichts erklärt. Es wurde weder eine neue Welterfindung präsentiert, es wurde keine neue Wundertechnik vorgestellt, sondern es wurden die alltäglichen und banalsten Dinge, mit denen man täglich Umgang hat, gezeigt. Und diese Dinge haben einfach durch ihre Präsenz in der Häufung und der ungewöhnlichen Darbietung Wahrnehmungsebenen erzeugt, die normalerweise überhaupt nicht vorhanden sind.
Schwebel: Es hat eine Transformation stattgefunden. Die Gegenstände waren in diesem Kontext nicht mehr die gleichen, obgleich sie sich gleich geblieben sind. Die Welthaltigkeit der Dinge wurde in eine neue Dimension gebracht.
von Gerkan: Vielleicht ist das ja eine „Ästhetik des Einfachen“. Es geht um die einfachsten Dinge, denen wir keinerlei Wert beimessen. Eine Einwegspritze, die man aus hygienischen Gründen wegwirft oder leere Batterien. In dem Moment, wo sie dem Betrachter auf eine andere Weise begegnen als sie es im Alltag tun - in der Masse, der speziellen Anordnung und mit dem besonderen Licht - geht es nicht nur um ein Wahrnehmen. Es geht auch darum, sich fragen zu lassen: Was soll das? Warum ist das da?
Schwebel: Ich habe die Menschen dort oft beobachtet. Natürlich war dies visuell sehr anregend. Man staunte über die Wirkung, man vergewisserte sich, was man sah, wenn man beispielsweise feststellte: Dies sind braune Zuckerstücke, Federn, Hölzer, Glühbirnen, kleine Teesiebe. Es fand ein Dialog zwischen der Person und den Glasflächen statt, aber auch untereinander kam es zum Dialog. Ging man dann in den Hauptraum, wurde man hingegen überwältigt von der Stille. Dabei spielen natürlich die Höhe, die Vertikale der schwarzen Stahlstützen und das Material weißer Marmor mit seinem Licht eine bestimmende Rolle.
von Gerkan: Dieses Material hat eine hervorragende Eigenschaft, es lässt das Licht durch, aber es ist nicht durchsichtig. Es erzeugt dabei in seiner Struktur ein lebendiges Spiel, das gleichwohl verhalten ist. Wir hätten auch einen anderen Stein nehmen können, einen sehr lauten Stein - wir haben aber absichtlich den weißesten aller Marmorsorten gesucht, einen Stoff, lichtdurchlässig, der auf draußen reagiert, aber auf der anderen Seite gedämpft ist in seiner Lebendigkeit. Ich bevorzuge auch sonst Materialien, die ähnliche Eigenschaften haben, z. B. als Holz, die Schweizer Birne mit ihrer sehr verhaltenen, reduzierten Binnenzeichnung. Alabaster ist in seinem Charakter ein ähnliches Material.
Schwebel: Alabasterfenster gab es schon im Mausoleum der Galla Placidia in Ravenna; sie lassen ein honigfarbiges Licht herein. Die Assoziation an das Kaiserliche wäre nicht gewünscht gewesen.
von Gerkan: Das Wichtigste war, einen hellen, lichten Raum zu schaffen, der im Sinne der Einfachheit - reduziert auf die Sprache des Materials - seine Wirkung ausübt. Wir planten in der Gewissheit, dass durch die unterschiedlichen Lichtverhältnisse - Sonne oder grauen Himmel - sich dieses Szenarium permanent ändert und immer andere, veränderte Lichtstimmungen erzeugt werden. Es hatte immer etwas Erhabenes. Dadurch ist das Gebäude - ob gewollt oder nicht - zur Kirche geworden.
Schwebel: Ihrer Schlussfolgerung möchte ich noch einmal nachgehen. Ich hatte mit Studenten dieses Gebäude mehrfach besucht. Wir hatten uns praktisch dort einquartiert, fingen jeden Morgen, als wir auf der EXPO waren, dort an und haben uns dann zwischendurch dort mehrfach am Tag wiedergetroffen. Wir konnten diesen Raum also zu verschiedenen Tageszeiten erleben. Manchmal, wenn auch selten, war man nahezu allein, dann wieder waren viele Leute da oder es fand eine Andacht statt. Ich selbst habe das Gebäude auch bei dem Eröffnungsgottesdienst erlebt. Es wurde darin getauft und es fanden Trauungen und andere religiöse sowie kulturelle Veranstaltungen dort statt. Es war ein Raum - und das ist eigentlich das Erstaunliche, was ich woanders so noch nicht erlebt habe -, der sowohl dem Einzelnen etwas gab, der hereingekommen ist, um Ruhe zu suchen, der aber auch geeignet war für einen großen Gottesdienst mit einem Gospelchor. Es war ein Raum, der viele Einstellungen und Handlungen ermöglichte, der allerdings niemals seine Würde verlor. Was ist das für ein Raum, ein Pavillon oder eine Kirche? Die Studenten und ich haben den Raum als Kirche empfunden. Herr von Gerkan, wollten sie einen Pavillon oder wollten sie eine Kirche bauen?
von Gerkan: Nein, ich wollte ganz entschieden und ohne zu zögern eine Kirche bauen. Einfach weil ich das schon immer wollte. Einen x-beliebigen Pavillon bauen, also eine Hülle, die dann aber unter dem Anspruch irgendeiner Mission hätte stehen sollen, das wollte ich nicht. Ich bin damit allerdings in den Diskussionen mit dem Gremien vorsichtig umgegangen, habe das auch nicht so benannt, weil mir immer wieder bekundet wurde, es sollte um Himmels willen keine Kirche werden. Ja, ich denke, das hat sich dann von allein beantwortet - in dem Moment, wo das Bauwerk fertig war.
Schwebel: Die Aufgabe war ein Pavillon, in dem Informationsprozesse ablaufen sollten, aber herausgekommen ist eine Kirche. Der Raum wurde auf der EXPO als Kirche genutzt und zwar in vielfacher Hinsicht, als Andachts- und Meditationsraum, aber auch als Ort vielfältiger Kommunikation. Sie haben hier als Architekt gezeigt, welche Rolle die Kirche auf einer EXPO, einem großen säkularen Medienereignis, einnehmen kann. Auf die Frage, wie sich die Kirche in der modernen Welt darstellen kann, haben Sie eine exemplarische Antwort gefunden. Wie Sie sehen, ist Ihre Antwort verstanden worden, weshalb Ihnen der Fachbereich Evangelische Theologie im November den Ehrendoktor verleihen wird. Sie haben sich mit großem Engagement der Bauaufgabe „Kirche auf der Expo“ gestellt. So was geht nicht ohne Bezug zu den Inhalten, also zu Kirche und Christentum. Wie sehen Sie Ihr Verhältnis dazu? Hat die Kirche eine Zukunft? Welche Rolle könnten Kirche und das Christentum Ihrer Meinung nach in der gegenwärtigen Situation spielen?
von Gerkan: Ich bin der Überzeugung, dass die Entleerung unseres Lebensraums von nicht zweckbringenden, sich nicht rechnenden Dingen eine generelle Sinnentleerung in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein erzeugt hat, die existenzbedrohend geworden ist. Denkt man einmal an die Jugendkriminalität, die in den ostdeutschen Länder viel stärker ist als hier - natürlich gibt es hierfür viele Gründe - so hat dies vor allem mit dem Verlust von Sinn zu tun. Der Sinn des Lebens ist den Jugendlichen verloren gegangen, es fehlt an einer inhaltlichen Orientierung. Solchen Sinn anzubieten, ist nicht allein der christlichen Religion vorbehalten, sondern das bezieht sich auf alle Religionen. Orientierung zu gewähren ist das gesellschaftliche Anliegen der Religionen gewesen, dass Menschen über ihr Tun zur Lebenserhaltung und meinethalber auch zur Belustigung hinaus noch einen weiteren, einen transzendenten Inhalt finden, dem sie sich zuwenden und an den sie sich gebunden fühlen. Alles, Moral und Ethik, hängt zum Schluss an diesem Punkt. Moral und Ethik erwachsen aus der Notwendigkeit einer Sinngebung, Verhaltensregeln werden erst durch die Verknüpfung mit Sinn hergestellt. Und deshalb ist eine religiöse Grundorientierung für die zwischenmenschlichen Beziehungen, für Moral und Ethik, unerlässlich.
Schwebel: Sie kennen durch ihre internationale Tätigkeit über das Christentum hinaus auch andere Religionen und haben einen speziellen Kontakt zu Ostasien. Haben sie den Eindruck, dass die Religionen, die Sie kennen, noch in der Lage sind, eine Sinnstiftung für die Menschen zu leisten? Oder sind die Religionen inzwischen alle durch die gesellschaftlichen Entwicklungen überrollt, so dass die Menschen den geistlichen Zuspruch, der nötig wäre, von woandersher holen?
von Gerkan: Das größte religiöse Phänomen, das wir in der Gegenwart registrieren können, ist das, was der Islam uns zur Zeit präsentiert. Dort ist es in der Tat so, dass das menschliche Bedürfnis nach Sinn zu einem politischen Machtinstrument benutzt wird, was fast unabsehbare Konsequenzen hat. Die Verbindung mit dem Terrorismus ist ein Teil davon. Ich denke, es gibt keinen anderen Bereich der Welt, wo die Besinnung auf einen religiösen Inhalt eine so dominierende gesellschafts-politische Rolle spielt. Fast keines der islamischen Länder - Indonesien eingeschlossen, das bevölkerungsreichste islamische Land - ist frei von diesen extremen Entwicklungen, einem Machtspiel unter Berufung auf den Propheten und den Koran. Das macht sogleich deutlich, wie gefährlich ein solcher zentraler Lebensinhalt für eine Gesellschaft werden kann. Im übrigen ist die katholische Kirche, wenn man weit genug zurückblickt, davon auch nicht freigewesen.
Schwebel: Im Islam wurde der Weg zur Moderne hin nicht beschritten. Wenn jemand ein gläubiger Muslim ist, hat er Schwierigkeiten, ein moderner Mensch zu sein. Seine Identität erhält er durch Abgrenzung gegenüber der modernen Welt. Das Christentum ist durch die Aufklärung hindurchgegangen und hat manche Anpassungsprozesse an die Moderne unternommen. Natürlich gibt es im Christentum auch Fundamentalismen, die sich diesem Weg verweigern. Aber generell hat man versucht, die Schere zwischen Christ-Sein und ein moderner Mensch-Sein nicht gar so weit auseinander klaffen zu lassen. Hat möglicherweise durch diese Anpassungsprozesse der christliche Glaube an Glaubwürdigkeit verloren? Oder denken Sie, dass trotz dieser Wandlungsprozesse das Christentum noch immer genügend Kraft hat, einen existentiell verbindlichen Sinn anzubieten und Menschen in eine positive Richtung zu führen?
von Gerkan: Ich befürchte, nein. Ich will nicht sagen, dass es an Substanz mangelt, aber die Kirche hat ein Problem in der Vermittlung ihrer Botschaft. Wenn ich Auto fahre und Autoradio höre, mache ich oft folgende Erfahrung. Es ist ja in den heutigen Sendungen fast eine Seltenheit, dass überhaupt jemand 5 Minuten hintereinander sinnvolle Sätze sagen kann. Normalerweise sind es Schnipsel, die durch die Gegend geworfen werden. Ich ertappe mich beim Autofahren dann oft bei dem Gedanken, wenn ich jemanden zwei, drei Minuten habe reden hören: Aha, das soll eine Predigt sein! Da bemüht sich jemand auf eine populäre, dem Medium angepasste Weise, christlichen Glauben rüberzubringen oder überhaupt etwas an Religiosität zu vermitteln. Dass er eigentlich sein Anliegen fast wieder karikiert durch diese Art, sich zu vermitteln, das merkt er nicht. Da sehe ich eine Parallele zur Entwicklung innerhalb des kirchlichen Bauens. Als wir als Architekten anfingen zu arbeiten, da wurde in der Kirche viel gebaut. Es wurden aber keine Kirchen gebaut, sondern sogenannte Gemeindezentren. Damit begann für mich ein beklagenswerter Anbiederungsprozess. Die Kirche sollte als ein soziales, alltagstaugliches Gerät für alles und jedes zu nutzen sein. Ein Raum, in dem man Tischtennis spielen, Feste feiern und Gottesdienste abhalten kann, kann doch nur ein neutraler Raum sein. Ein solcher Raum darf dann keine Erhabenheit mehr ausstrahlen, damit er keine Barrieren aufbaut oder eine „Schwellenangst“ erzeugt, so etwas war nicht gewollt. So entstanden schließlich diese Allerweltszentren, an die dann noch der Kindergarten angegliedert wurde und dies und jenes. Aus sozialen Gründen heraus ist das absolut integer, auch in Ordnung. Ich denke nur, dass eine Kirche ....
Schwebel: Sie empfanden dies als eine Profanierung?
von Gerkan: Ja. Ich denke, dass Profanierung eine Parallele hat – beispielsweise zu dem Nichtwissen um angemessene Kleidung. Ich habe es noch erlebt, als ich zur Schule ging, auf dem Lande, dass am Sonntagvormittag alle Leute, die auf der Strasse waren - auch die Bauern - dunkle Anzüge und eine Krawatte anhatten. Schwarzer Anzug, meist war er ein bisschen abgeschabt oder zu klein oder schon hinfällig, aber sie waren nobel gekleidet. Die Nachlässigkeit in der Kleidung ist heute keine Protesthaltung mehr, das war sie in der Zeit der Studentenunruhen, da hatte das noch einen Sinn. Um auf die Gemeindezentren der 70er Jahre zurückzukommen: Das mag einmal ein Protest gewesen sein. Am Ende war es bloß noch eine Nivellierung.
Schwebel: Als Sie den Auftrag bekamen, einen Pavillon zu bauen, haben Sie eine Kirche gebaut. Im Augenblick sind Sie dabei, für Heiligenhafen, gegenüber der Insel Fehmarn, eine Kirche zu entwickeln. Hier gibt es keinen EXPO-Kontext. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?
von Gerkan: Ich komme auf den Anfang zurück. Ich will den Menschen, so klein diese Kapelle auch sein wird, das Gefühl der Erhabenheit geben. Allerdings mit anderen Materialien und unter anderen Voraussetzungen als auf der EXPO. Dieses umgedrehte Boot oben auf dem Hang könnte als Metapher verstanden werden. Es gibt eine Analogie zur Fischerei, es soll eine Fischerkapelle sein. Die Kapelle hat eine archaisch-einfache Form. Die Ausrichtung nach vorn soll allen, die sich im Raum aufhalten, einen Ausblick geben. Das Panorama habe ich auf das Meer hin ausgeschnitten, auf die gegenüberliegende Insel hin. Nun habe ich auch entdeckt, dass das Kreuz in der Fassade gewissermaßen in genauer Peilrichtung mit dem Leuchtturm gegenüber auf Fehmarn steht.
Schwebel: Man sieht auf das Kreuz und in der Ferne den Leuchtturm, - ein symbolischer Verweis?
von Gerkan: Das ist das eine. Aber ich sehe auch eine Beziehung zu den Fenstern im christlichen Pavillon mit ihren Materialien. Das Schiff als etwas, was zur Alltagswelt am Meer dazugehört - und aus dem Inneren des Schiffrumpfes wird ein sehr einfacher hölzerner Raum. Den Menschen wird eine Wahrnehmung ihrer Umwelt gegeben, die sie sich so nie bewusst gemacht haben.
Schwebel: Auf der meerzugewandten Seite kommt sozusagen im Sehen etwas Neues hinzu. Die Landschaft, die man eigentlich kennt und die man nun im Ausschnitt sieht, ist auf einmal ein Teil der Kirchenarchitektur, sie gehört dazu.
von Gerkan: Es ist ja oft so, dass man Dinge, die man in einem Ausschnitt betrachtet, anders sieht. Es ist nicht allein das Panorama, das sogar manchmal atemberaubend ist. Aber gerade die Verengung des Sichtfeldes auf einen Ausschnitt schafft eine neue Qualität. Fast möchte ich von einer Anbetungsqualität sprechen. Dieser Blick aus diesem Fenster über den See auf die gegenüberliegende Insel mit diesem Leuchtturm sollte die Menschen aus ihrem Alltag herausheben und ihnen ein Gefühl vermitteln von dem, was größer ist als sie selbst.
Schwebel: Sollte dies, wenn es gelingt, ein heiliger Raum sein?
von Gerkan: Eine schwierige Frage. Wie Sie aus meiner Beschreibung ersehen, geht es mir darum, mit einer Kirche den Menschen eine Erfahrung zu ermöglichen, die sie heraushebt und auf das Andere verweist. Ob dies gelingt, weiß ich nicht. Wenn die Menschen erkennen, dass in einem solchen Raum ein Mehr zur Sprache kommt, das eine andere Dimension von Erfahrung möglich macht, die über das Alltägliche hinausgeht, dann wäre es gelungen.
Zuerst erschienen in: Bernd Pastuschka, Horst Schwebel, Jürgen Wittstock (Hrsg.), Meinhard von Gerkan. Geometrie der Stille, Ausstellung vom 20. 10. - 24. 11. 2002, Universitätsmuseum Marburg,
|

