
Intimität |
Wirtschaftsethik und Sozialethik
Die Optionen gleichen sichChristoph Fleischer Rezensionen zu:
Das Zentrum dieser Arbeit ist die Untersuchung wirtschaftsethischer Begrifflichkeiten, aus der nur einige wenige Essentials als Säulen der Ethik bleiben: die Forderung nach "Chancengerechtigkeit", die "Option für die Armen" besonders im Zusammenhang der Globalisierung, der "Begriff der Menschenwürde" und die Perspektive des "Doppelgebots der Liebe". Der Gerechtigkeitsbegriff ist angelehnt an J. Rawl (Cambridge). Die "Option für die Armen" findet sich zwar im Hirtenbrief amerikanischer Bischöfe, aber auch in Grundgedanken der Wirtschaftstheorie, die am Ergehen der Schwächsten die Funktionsweise der Gesamtwirtschaft ablesen will. ("Wenn sich herausstellt, dass Mindestlöhne das Wirtschaftswachstum bremsen, sind diese nicht zum Vorteil der am wenigsten Begünstigten." S.186). Wenn auch der Autor von Anbeginn klar macht, dass wirtschaftsethische Argumente im Zusammenklang mit der Ökonomie funktionieren sollten, so ist von seinem anthropologischen Grundansatz her das Ergehen jedes einzelnen Individuums das Hauptkriterium des wirtschaftlichen Gelingens. Von daher findet sich in dieser Arbeit, auch ohne direkte Bezüge zu den Aussagen des ökumenischen Rates oder des reformierten Weltbundes viel von dem wieder, was heute sozialethische Grunderkenntnisse sind.
Wenn man will kann man den von Nils Ole Oermann verwendete Begriff "Chancengerechtigkeit" sich im Wort Teilhabe wiederfinden, das sich zugleich an den Armen orientiert. Wie schon bei Oermann sind es auch in diesem Band die unterschiedlichen Praxisfelder, in denen die ethischen Grundentscheidungen auftauchen: Weltwirtschaft und Globalisierung, Familienpolitik, die Frage des Geldes, Zuwanderungspolitik, Arbeitsmarktpolitik und Mitbestimmung. Wirtschaftsethisch grundlegend ist der Artikel von Gerhard Wegner, "So hatte das Ludwig Ehrhard nicht gemeint!" Transformationen der Sozialen Marktwirtschaft. Hier wird deutlich, dass das Grundmodell Deutschlands einer sozial abgesicherten Freiheit nicht erst seit Ludwig Erhard besteht. Auch in dieser Untersuchung wird der Begriff der "Teilhabe" gestärkt, da er sich sowohl auf die Grundfunktion der Wirtschaft als auch auf die Option für die Armen bezieht. In der Rede des Ratspräsidenten Bischof Wolfgang Huber sowie im Abschnitt "Berichte aus der Praxis" wird auf das Arbeitsplatzsiegel "Arbeit Plus" der EKD Bezug genommen, was zeigt, dass Wirtschaftsethik es nicht bei bloßen Worten belassen muss. Interessant ist allerdings, dass sich dieser Band, obwohl er die Situation der Wirtschaft im Blick hat, ausdrücklich sozialethisch versteht. Hier wird mehr von Wirtschaftspolitik als von Wirtschaftsethik gesprochen. Es gibt also offensichtlich zwei Herangehensweisen an das Thema Wirtschaft, die sich erstaunlicherweise nun aber inhaltlich annähern, diejenige, die den Weg über den Dialog mit der Wirtschaftswissenschaft nimmt und diejenige, die sich zuerst der sozialen Frage zuwendet, diese natürlich in den Zusammenhängen des Wirtschaftens aufsucht und sich daher eher als arbeitnehmerorientiert versteht. Es mag sein, dass es wirklich nicht sehr viele ausgearbeitete Formen von Wirtschaftsethik in der Evangelischen Theologie gibt, weil diese und die Gremien der Kirche eher sozial orientiert argumentiert haben. Als Beispiel dafür ließe sich das Positionspapier der Evangelischen Kirche von Westfalen zur Mitbestimmung verstehen. Ein zweiter Grund liegt sicherlich auch in der Grundauffassung von Wirtschaft im Sinne einer lutherischen Zwei-Reiche-Lehre, die es dann mit der Kirche selbst nur indirekt zu tun hat. Die Situation der fortschreitenden Globalisierung sowie die theologischen Grundaussagen christlicher Anthropologie lassen die unterschiedlichen Ansätze zu ähnlichen Antworten kommen:
Und es ist klar, dass die Kirche von der aktuellen Situation in der Weltwirtschaft zum Zeugnis gefordert ist, denn die Menschen "sterben sonst drüber." (Fr. von Bodelschwingh) |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/53/cf8.htm
|
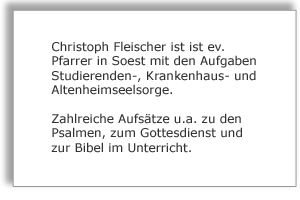 Nils Ole Oermann, der sich mit seiner Arbeit über Evangelische Wirtschaftsethik in Harvard und Berlin habilitiert hat, war bis 2007 persönlicher Referent des Bundespräsidenten Horst Köhler. Dass diese Tätigkeit eine profunde Kenntnis praktischer Fragen mit sich bringt, zeigt er im letzten Abschnitt, in der er die wirtschaftsethischen Fragen auf fünf konkrete Fallstudien bezieht, dem Umgang mit unregierbaren Staaten (failed states), der demografischen Entwicklung Deutschlands, der Frage der Entschuldung verarmter Länder, dem globalen Zugang zur Informationstechnologie sowie neuerer unternehmensethischer Modelle. Dabei werden die inhaltlichen Linien bis in die praktischen Konsequenzen ausgezogen, wenn sie sich nicht sogar zumindest im Abschnitt zu den failed states ein wenig darin verlieren zu scheinen.
Nils Ole Oermann, der sich mit seiner Arbeit über Evangelische Wirtschaftsethik in Harvard und Berlin habilitiert hat, war bis 2007 persönlicher Referent des Bundespräsidenten Horst Köhler. Dass diese Tätigkeit eine profunde Kenntnis praktischer Fragen mit sich bringt, zeigt er im letzten Abschnitt, in der er die wirtschaftsethischen Fragen auf fünf konkrete Fallstudien bezieht, dem Umgang mit unregierbaren Staaten (failed states), der demografischen Entwicklung Deutschlands, der Frage der Entschuldung verarmter Länder, dem globalen Zugang zur Informationstechnologie sowie neuerer unternehmensethischer Modelle. Dabei werden die inhaltlichen Linien bis in die praktischen Konsequenzen ausgezogen, wenn sie sich nicht sogar zumindest im Abschnitt zu den failed states ein wenig darin verlieren zu scheinen. 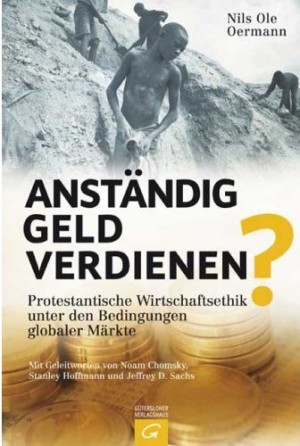 Grundlegend an dieser evangelischen Wirtschaftsethik ist dabei, dass der Autor nicht nur den breiten Strom der katholischen Soziallehre und das Rinnsal evangelischer Wirtschaftsethiken beerben kann, sondern auch das entsprechende Fachgebiet im Bereich der Ökonomik, sowie die Väter der klassischen Volkswirtschaftslehre. Interessant am Schreibstil N. O. Oermanns ist, dass er in die diskursiven Abschnitte immer wieder Sätze einbaut, in denen er persönlich Position bezieht, die also weniger deskriptiv sind, als dass sie Bezüge zum Gesamtthema herstellen. Ich möchte jetzt die Lektüre nicht vorwegnehmen, sondern einfach ein paar solcher Kernformulierungen zitieren, die dann im Grunde auch schon recht gut die Tendenz dieses wichtigen Buches zeigen:
Grundlegend an dieser evangelischen Wirtschaftsethik ist dabei, dass der Autor nicht nur den breiten Strom der katholischen Soziallehre und das Rinnsal evangelischer Wirtschaftsethiken beerben kann, sondern auch das entsprechende Fachgebiet im Bereich der Ökonomik, sowie die Väter der klassischen Volkswirtschaftslehre. Interessant am Schreibstil N. O. Oermanns ist, dass er in die diskursiven Abschnitte immer wieder Sätze einbaut, in denen er persönlich Position bezieht, die also weniger deskriptiv sind, als dass sie Bezüge zum Gesamtthema herstellen. Ich möchte jetzt die Lektüre nicht vorwegnehmen, sondern einfach ein paar solcher Kernformulierungen zitieren, die dann im Grunde auch schon recht gut die Tendenz dieses wichtigen Buches zeigen: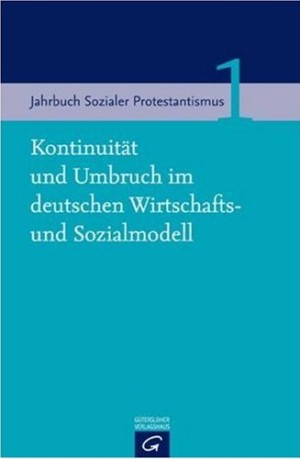 Hierzu liest sich der Reader "Kontinuität und Umbruch im deutschen Wirtschafts- und Sozialmodell" wie ein begleitender Kommentar zur EKD Denkschrift aus dem Jahr 2006 "Gerechte Teilhabe". (Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland. Gütersloher Verlagshaus. Gütersloh 2006)
Hierzu liest sich der Reader "Kontinuität und Umbruch im deutschen Wirtschafts- und Sozialmodell" wie ein begleitender Kommentar zur EKD Denkschrift aus dem Jahr 2006 "Gerechte Teilhabe". (Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland. Gütersloher Verlagshaus. Gütersloh 2006)