
Intimität |
Intimität als ethische Leistung
Die Bedeutung der Grenze für das Problem der IntimitätMarion Oechsler I. EinleitungWas ist Intimität?
Wie hier bereits anklingt, ist das Problem der Intimität ein Problem der Intersubjektivität. Denn das Schaffen eines solchen Bereichs, die Leistung der Abgrenzung, sind spezifisch menschliche Fähigkeiten; es sind nicht Dinge und Objekte der Welt, die die menschliche Intimität bedrohen, sondern das Eindringen durch einen Andern. Nur ein anderer Mensch, ob als Individuum oder in Form einer Institution, kann mich meiner Intimsphäre berauben. Hierfür gibt es natürlich zahllose Beispiele, sehr präsent ist das der Medien, die mitunter ohne eine ausdrückliche Genehmigung der betreffenden Person intime Einzelheiten aus deren Leben an die Öffentlichkeit bringen. Die Missachtung der Intimität und Würde der Person in ihrer extremsten Form geschieht in der Anwendung der Folter. Die Steigerung zum Extrem besteht darin, dass der Angriff auf die Persönlichkeit über die Misshandlung des Körpers geschieht, der ja ein sterbliches und zerbrechliches Objekt in der Welt ist, und von dem mein Leben und meine Persönlichkeit unbedingt abhängen. Die Körperlichkeit, als Bedingung des Lebens und somit als Bedingung jedes einzelnen Entwurfs des Individuums, ist folglich ein wesentlicher Bestandteil der Intimität. Sie ist ohne Berücksichtigung des körperlichen Aspekts nicht denkbar. Im Folgenden werde ich allerdings nicht im Einzelnen auf die Rolle des Körpers eingehen; im Vordergrund soll vielmehr die Auseinandersetzung mit der Subjekt-Objekt-Spaltung des Individuums im Rahmen der Intersubjektivität stehen. Denn jeder Angriff auf den Bereich der Intimität macht sich den Objektcharakter des Individuums zunutze. Der Subjekt- und Objektcharakter des IndividuumsEine Annäherung an den Begriff der Intimität hat immer das philosophische Problem der Subjekt-Objekt-Spaltung des Individuums zur Grundlage. Dieses Problem wiederum hat zwei Ebenen[2]: Zum einen bezeichnet es die Trennung von Individuum und Welt; problematisch wird diese Trennung dadurch, dass das Individuum selbst ein Teil der Welt ist und sich gleichzeitig von ihr distanzieren und sich zu ihr, als zu einem Außen, verhalten kann und muss. Das Individuum hat, anders ausgedrückt, einen Bezug zum Innen und zum Außen; nach innen hin ist es geschlossen, nach außen hin offen. Das bedeutet, dass das Subjekt einerseits eine Totalität bildet, seine Gedanken und Reflexionen, sein Weltbild, können von außen nicht eingesehen werden. Andererseits ist jedes Subjekt in der Welt da. Der Welt, dem Außen gegenüber, ist es offen; das Geschehen der Außenwelt betrifft das Individuum. Dies wird besonders anhand der Intersubjektivität deutlich. Denn die Außenwelt bilden nicht nur Dinge, sondern auch Menschen, und zwar eine Vielzahl anderer Subjekte. Der Einzelne ist also auch dem Andern gegenüber offen, man kann sogar sagen, er ist ihm ausgeliefert. Die Eigenschaft der Offenheit beinhaltet aber auch die Fähigkeit, sich selbst nach außen hin mitzuteilen. Da das Individuum immer Teil der Welt ist, steht seine Geschlossenheit dem Aspekt der Offenheit in jedem Augenblick des Lebens gegenüber. Die zweite Ebene der Subjekt-Objekt-Spaltung beruht auf der spezifisch menschlichen Fähigkeit der Reflexion. Denn das Subjekt denkt nicht nur über die Welt, sondern auch über sich selbst nach; und im Nachdenken über sich selbst wird das Subjekt zum Objekt. An diesem entscheidenden Punkt scheiden sich die philosophischen Geister, und zwar darüber, ob das Subjekt für es selbst zum Objekt wird oder aber für Andere.[3] Hier möchte ich zu Sartre und seinen Ausführungen über die Intersubjektivität in Abgrenzung zur philosophischen Tradition übergehen. Außerdem sollen der darin zentrale Begriff der Scham, sowie der Gedanke der Selbstverfehlung in diesem Zusammenhang erörtert und letztlich in Bezug zum Begriff der Intimität gesetzt werden. II. Die Anwesenheit des Andern bei SartreNach Sartre scheitert die philosophische Tradition bei ihrem Versuch, die Existenz des Andern zu beweisen, primär daran, dass sie von einem erkenntnistheoretischen Standpunkt ausgeht. Er führt ihr Scheitern anhand der Tatsache vor, dass der Solipsismus durch ihre Argumentation nicht widerlegt wird.[4] Daher wählt Sartre eine neue Herangehensweise an das Problem. Sein Ausgangspunkt ist hierbei der Blick des Andern, dessen Anwesenheit bei mir ich über das Gefühl der Scham oder der Furcht realisiere. Seinen Vorgängern gegenüber hat diese Vorgehensweise den großen Vorteil, dass die Evidenz der Anwesenheit des Andern nicht mehr bloß erkannt, sondern vielmehr erlebt wird. Während nämlich alle Erkenntnis bezweifelbar ist, ist das Erlebnis, die Offenbarung des Andern im Gefühl der Scham, unbezweifelbar und evident. Des Weiteren ist die Anwesenheit des Andern, nach Sartre, nicht lediglich auf einzelne Momente bezogen; das Für-Andere-sein ist vielmehr „ein ständiges Faktum meiner menschlichen-Realität, und ich erfasse es mit seiner faktischen Notwendigkeit im kleinsten Gedanken, den ich mir über mich mache“ (501f).[5] Das Für-Andere, die ständige Anwesenheit des Andern bei mir, bildet folglich, neben dem An-sich und dem Für-sich, die dritte und letzte Konstituente des Bewusstseins.[6] Das bedeutet, dass ich mich selbst überhaupt nicht als Ich-selbst erfassen kann, ohne den Andern zu jeder Zeit in meine Reflexion einzubeziehen. Dieser Gedanke und die Konsequenzen, die er für die eigene sowie die Freiheit des Andern bedeutet, bedürfen einer Erläuterung. Das Für-AndereSartre beschreibt zunächst die subjektiven Reaktionen auf den Blick des Andern: die Reaktion der Furcht („Gefühl, angesichts der Freiheit[7] des Andern in Gefahr zu sein“), die der Scham („Gefühl, schließlich das zu sein, was ich bin, aber woanders, dort drüben für den Andern“) und die der Knechtschaft („Gefühl der Entfremdung aller meiner Möglichkeiten“). (482) Es ist mein Gefühl der Scham, das mir den Blick des Andern enthüllt, weshalb ich die Situation, wie oben bereits angedeutet, nicht erkenne, sondern erlebe. Zudem ist die Scham Anerkennung, das Objekt zu sein, das der Andere erblickt, und sie ist zugleich das Geständnis, dass ich dieses Sein bin. Ich erfasse also in diesem Gefühl mein Objekt-Sein; und das, wofür ich mich schäme, ist grundsätzlich die Tatsache, überhaupt Objekt zu sein. Allerdings kann ich, nach Sartre, niemals Objekt für mich sein, da ich immer der bin, der ich bin; Objekt muss ich also für den Andern sein. Der Andere wiederum erscheint mir als ein „reines Subjekt“ (486), das meine Freiheit bedroht: Indem ich meine Objektivierung erlebe, spüre ich die Entfremdung meiner Möglichkeiten. Denn als Objekt bin ich dem Andern ausgeliefert; plötzlich habe nicht mehr ich meine Freiheit in der Hand, sondern der Andere. Das Auftauchen einer grenzenlosen Freiheit mit der Anwesenheit des Andern lässt, in Sartres Worten, meine Freiheit erstarren. Und dennoch bin ich dieses Objekt-Ich, das ich für den Andern bin; doch ich bin es nur „[…] eben in dem Maß, wie es mir entgeht, und ich würde es im Gegenteil als meines zurückweisen, wenn es mit mir selbst in reiner Selbstheit übereinstimmen könnte.“ (511) Ferner ist das Objekt-Ich „[…] weder Erkenntnis noch Erkenntniseinheit, sondern Unbehagen, erlebtes Losreißen von der ek-statischen Einheit des Für-sich, Grenze, die ich nicht erreichen kann und die ich dennoch bin.“ (494) Mein Objekt-Ich als „meine Bindung an den Andern und Symbol unserer absoluten Trennung“ (511)Sartre stellt den Andern in Das Sein und das Nichts als eine bedrohliche Freiheit dar, die mir umso gefährlicher erscheint, als der Andere „[…] das Geheimnis meines Seins [besitzt], er weiß, was ich bin.“(636) So, wie der Andere mich sieht, vermag ich selbst mich niemals zu sehen, was in der Struktur des Für-sich begründet liegt, das zu sein, was es nicht ist und nicht das zu sein, was es ist. Somit hat der Andere mir gegenüber einen großen Vorteil; er kann zu mir in eine Beziehung treten, die ich zu mir selbst nicht einnehmen kann. Da ich aber dieses Unbehagen gegenüber meinem Objekt-Ich spüre, gegenüber dem, wofür der Andere mich hält, und das ich zugleich bin, ohne es je erreichen zu können, reiße ich mich davon los. Und im Losreißen von meinem Objekt-Ich anerkenne ich dieses einerseits, behaupte aber auch zugleich meine Selbstheit, meine eigene Freiheit dem Andern gegenüber. Für dieses Losreißen bin ich selbst verantwortlich, nur ich kann und muss es fortwährend wählen, indem ich die Freiheit des Andern zurückweise. „Ich kann den Andern nur auf Distanz halten, wenn ich eine Grenze für meine Subjektivität akzeptiere. Aber diese Grenze kann weder von mir kommen noch durch mich gedacht werden […] Die Grenze zwischen zwei Bewusstseinen, insofern sie durch das begrenzende Bewusstsein hervorgebracht und durch das begrenzte Bewusstsein übernommen wird, das also ist mein Objekt-Ich.“ (512) Ich muss mein Objekt-sein für den Andern anerkennen, um mich von ihm distanzieren zu können. Sartre schreibt weiter, dass ein Selbstentwurf nur dann gelingt, wenn ich mich erfasse, insofern ich für das Sein des Andern, „das nicht zu sein ich mich mache“ (515), verantwortlich bin. Nur ich kann und muss die Möglichkeiten des Andern zurückweisen, um meine Möglichkeiten als meine eigenen erkennen und verwirklichen zu können. Mein Für-Andere-sein ist mein Objekt-Ich, es ist die unerreichbare Grenze; es ist „[…] dieses zwischen zwei Negationen entgegengesetzten Ursprungs und umgekehrter Richtung hin und her gerissene Sein; denn der Andere ist nicht dieses Ich, von dem er die Intuition hat, und ich habe nicht die Intuition von diesem Ich, das ich bin.“ (513) Das Problem der FreiheitSartre negiert den Gedanken eines allen Menschen gemeinsamen Wesens, weil die darin vollzogene Verallgemeinerung des Menschen auf Kosten des Individuums geschieht. Aus diesem Grund nähert er sich dem Problem der Anwesenheit des Andern über den Blick und gibt dem Individuum dadurch einerseits seine völlige Freiheit zurück. Denn als solches ist es ja absolut selbstbestimmt, und seine Möglichkeiten sind seine ganz eigenen, individuellen Möglichkeiten. Andererseits aber, und hierin kommt der ambivalente Charakter der Freiheit verstärkt zum Ausdruck, erfährt es durch die Anwesenheit einer fremden Freiheit die Begrenzung seiner eigenen. Der Gedanke der Freiheit besteht bei Sartre wesentlich in der lebenslangen Aufgabe der Selbstverwirklichung. Es geht ihm darum, zu zeigen, dass das Dasein keineswegs selbstverständlich ist, dass das Individuum jederzeit mit dem Problem seines Selbstentwurfs und somit auch immer zugleich mit der Möglichkeit der Selbstverfehlung konfrontiert ist. Bereits im zweiten Kapitel des ersten Teils in Das Sein und das Nichts beschreibt er die Gefahr der Selbstverfehlung anhand des Phänomens der Unaufrichtigkeit. Diese ist stets gegenwärtig, da sie in der Beschaffenheit des Für-sich konstitutiv begründet liegt. Der Selbstentwurf gelingt nur, wenn das Individuum „authentisch“ handelt: wenn es seine Freiheit, mithin seine Faktizität und seine Transzendenz als solche annimmt und diese beiden Aspekte wirksam koordiniert. In der Unaufrichtigkeit hingegen wird diese Koordination, die die Bedingung der Verwirklichung des Seins ist, verfehlt. Das, was tatsächlich ist, und das, was möglich werden kann, wird in keinen Zusammenhang gebracht, der eine Entscheidung und Konsequenzen erfordert. Was in der Unaufrichtigkeit geschieht, ist vielmehr, dass die Faktizität als Transzendenz seiend und die Transzendenz als Faktizität seiend behauptet wird. Ersteres bedeutet, dass man das Gegebene nicht als Gegebenes erfasst, sondern es zur Möglichkeit macht; Letzteres, dass man das über das Gegebene hinaus Mögliche bereits als gegeben betrachtet. Sartre erklärt das Phänomen der Unaufrichtigkeit ausgehend von der Angst; denn gerade wenn wir Angst haben, was nach Sartre Angst sein bedeutet, suchen wir nach einem Ausweg. Allerdings kann dieser Weg eben niemals weg von dem, was wir selbst sind, führen; deswegen vermischen und verschleiern wir das Gegebene und das Mögliche innerhalb unseres eigenen Bewusstseins. Ich denke, dass uns neben der Angst ein weiterer, ebenso menschlicher Zug zur Unaufrichtigkeit bewegt, nämlich der Wunsch, Endgültigkeit zu vermeiden, sich nicht durch eine Entscheidung festzulegen. Selbstverwirklichung und Selbstverfehlung unter dem Aspekt des Für-AndereDurch die Bewusstseins-Konstituente des Für-Andere kommt nun eine weitere Dimension für das Problem des Selbstentwurfs hinzu, nämlich die Freiheit des Andern. Die Verwirklichung des Seins unter diesem Aspekt hängt wesentlich von dem Umgang mit der eigenen Furcht und somit auch mit dem eigenen Objekt-Ich ab: „Wenn ich mich auf meine eigenen Möglichkeiten hin werfe, entgehe ich der Furcht in dem Maß, in dem ich meine Objektheit als unwesentlich betrachte. Das kann nur sein, wenn ich mich erfasse, insofern ich für das Sein des Andern verantwortlich bin. Der Andere wird dann das, was nicht zu sein ich mich mache […]“. (515) Die Reaktionen auf die Anwesenheit des Andern (Scham, Furcht und Stolz) zeigen mir diesen einerseits als unerreichbares Subjekt an, andererseits „[…] schließen [sie] ein Verstehen meiner Selbstheit in sich ein, das mir zur Motivation dienen kann und muss, den Andern als Objektheit zu konstituieren.“ (520) Ich muss also, um meine eigene Freiheit zurück zu gewinnen, den Andern als Objekt betrachten. Was Sartre anhand der Ausführung des Für-Andere-seins zunächst vor allem tut, ist, aufzuzeigen, dass die Anwesenheit des Andern in meiner Welt ein Problem ist, dass sich mein Umgang damit nicht von selbst versteht. Verschärft wird das Problem durch die Unerreichbarkeit meines Objekt-Ichs; dadurch, dass es einen Teil meines Selbst gibt, den ich nicht erfassen kann, der ich zwar bin, aber immer nur insofern er mir entgeht. Das Problem des Für-Andere bildet also auf eine Art eine Erweiterung des Problems des Für-sich, in der Reflexion niemals mit sich selbst übereinstimmen zu können. Ebenso wie das Für-sich birgt folglich auch das Für-Andere ein ständiges Risiko der Unaufrichtigkeit. Allerdings geht es darin weniger um die Koordination von Faktizität und Transzendenz als vielmehr um die Konstituierung des Subjekt- und Objekt-Ichs sowie des Subjekt- und Objekt-Andern. Sartre nennt schließlich zwei „authentische Haltungen“ (519), die ich gegenüber der Freiheit des Andern einnehmen kann: die der Scham, in der ich den Andern als Subjekt anerkenne, durch das ich mein Objekt-sein erfahre; und die des Hochmuts, in dem ich meine Freiheit gegenüber dem Objekt-Andern erfasse. Die Haltungen jenseits dieser beiden betrachtet Sartre als unaufrichtig; als Beispiele nennt er die Haltung der Demut gegenüber Gott, den ich lediglich als reines Subjekt anerkenne, wodurch ich in meiner Objektheit verharre, weil Gott in dieser Haltung niemals zum Objekt konstituiert wird. Zum andern zählt er die Haltungen des Stolzes und der Eitelkeit zur Unaufrichtigkeit. Darin versuche ich nämlich, „[…] mich als den Andern durch meine Objektheit affizierend zu erfassen.“ (519) Indem ich mich bemühe, auf den Andern und sein potentielles Urteil über mich einzuwirken, handle ich nicht mehr authentisch, weil ich nicht daran festhalte, der zu sein, der ich bin. Vielmehr räume ich dem Andern dadurch Macht über meine Freiheit ein, anstatt sie ihm gegenüber zu behaupten. Ihm zuviel Macht über meine Transzendenz zuzugestehen, darin liegt die Unaufrichtigkeit in meiner Haltung dem Andern gegenüber. Sartre schreibt, dass ich der Furcht, die unbedingt mit dem Gefühl der Scham zusammenhängt, nur entgehen kann, indem ich meine Objektheit als unwesentlich betrachte. Es geht ihm also auch bezüglich des Für-Andere-Seins darum, Authentizität zu erlangen, indem ich meine situativ bedingte Scham erfasse, um darauf wiederum mit Hochmut, mit der Behauptung meiner eigenen Freiheit, zu reagieren. Wenn ich dagegen meiner Scham, wie etwa in Sartres Beispiel zum religiösen Glauben, zuviel Raum lasse, oder wenn ich meinen Hochmut in Stolz oder Eitelkeit „steigere“, überlasse ich meine Freiheit dem Anderen und handle unaufrichtig. Die Begründung der Eigenverantwortlichkeit im Für-AndereSartres Bestimmung des Für-Andere als Konstituente des Bewusstseins unterstreicht den für seine Philosophie unentbehrlichen Gedanken der (authentischen) Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Das zentrale Moment bildet hierbei das Objekt-Ich mit seiner wesentlichen Eigenschaft, vom Subjekt zwar als das Ich, das es ist, erfasst zu werden, zugleich aber nur insofern es dies für den Andern ist. Genau darauf, auf dem Für-Andere, beruht wesentlich die Betonung der Selbstbestimmung: Wenn man nämlich grundsätzlich annimmt, dass ich mich mir selbst entfremden, für mich selbst zum Objekt werden kann, dann hat dies zur Folge, dass ich mich, beispielsweise, von meinen eigenen Gefühlen distanzieren kann. Eben dies ist in Sartres Augen aber die Bewegung der Unaufrichtigkeit; ihr setzt er entgegen, dass das Subjekt, zum Beispiel, die Angst ist, die es hat, dass es die Scham ist, die es fühlt. Diese Gefühle sind Erlebnisse; da ich sie erlebe, ist es mir unmöglich, sie zu erkennen. Mein Ich als solches zu erfassen, setzt eine Reflexion voraus. Jede Reflexion bezieht aber, wie wir gesehen haben, den Andern bereits mit ein. Somit „[…] bin [ich] für mich nur als reine Verweisung auf Andere.“ (470) Sartre schreibt weiterhin: „Mein Sein für-Andere ist ein Sturz durch die absolute Leere auf die Objektivität hin. Und da dieser Sturz Entfremdung ist, kann ich mich für mich selbst nicht als Objekt sein machen, denn in keinem Fall kann ich mich mir selbst entfremden.“ (493) Sartres Negation der Selbstentfremdung anhand der Beschreibung des Objekt-Ichs entspricht seiner Forderung nach Authentizität. Dadurch, dass ich selbst für das Sein des Andern verantwortlich bin, indem ich seine Freiheit zurückweise – und nur durch dieses Vorgehen kann ich ja meine eigene Freiheit behaupten - wird der Gedanke der Eigenverantwortlichkeit verstärkt. Sartres Abgrenzung von der philosophischen Tradition besteht also zum einen in der Negation eines gemeinsamen „Wesens“ des Menschen sowie in der Negation des hegelschen Gedankens der Selbstentfremdung. Nur indem er diese beiden Vorstellungen widerlegt und an ihre Stelle das Für-Andere als ständige Konstituente des Bewusstseins setzt, gelangt er zur Behauptung der absoluten Freiheit des Individuums. Diese sartresche Freiheit wiederum ist nicht zu trennen vom Gedanken der Eigenverantwortlichkeit, dem, wie gezeigt wurde, durch die ständige Anwesenheit des Andern wesentliche Bedeutung zukommt. Nachdem die Bedeutung des Für-Andere in Sartres Philosophie dargelegt wurde, werde ich, ausgehend von der Scham, auf das Problem der Intimität zurückkommen. III. Intimität und die GrenzeScham und IntimitätAusgehend von folgenden Zitaten diskutiere ich die Bedeutung von Scham und Intimität: „Die Scham realisiert […] eine intime Beziehung von mir zu mir: durch die Scham habe ich einen Aspekt meines Seins entdeckt.“ (405) „[…] der Andere ist der unentbehrliche Vermittler zwischen mir und mir selbst: ich schäme mich meiner, wie ich Anderen erscheine. (406) „So ist die Scham ein vereinigendes Erfassen dreier Dimensionen: Ich schäme mich über mich vor Anderen.“ (518) Indem Sartre die Beziehung von mir zu mir als eine „intime“ bezeichnet, verdeutlicht er nochmals, dass er den Selbstbezug in der Reflexion nicht als einen zwischen Subjekt und einem ihm selbst entfremdeten Objekt verstanden wissen will. Wie die Übersetzung des lateinischen Begriffs intimus, u. a., mit vertrautest, vertraulich, eng befreundet zeigt, steht jede intime Beziehung im Widerspruch zum Fremden. Fremd ist und bleibt mir nur der Andere, weshalb ich ihn ja auch als Objekt konstituieren kann und muss; nicht aber mein Objekt-Ich. Mein Objekt-Ich, als Grenze zwischen mir und dem Andern, erfasse ich ja gerade und nur über die intime Beziehung von mir zu mir als reales Sein und zwar als Aspekt meines Seins. Das bedeutet, dass ich zum einen diesen Raum der Intimität brauche, um mich als dieses Ich seiend erfassen zu können; zum andern aber kann ich diesen Raum ohne die Anwesenheit des Andern, des Fremden, überhaupt nicht schaffen. Mir würde dann das wesentliche Moment fehlen, von dem ich mich abgrenzen muss. Deshalb ist der Andere, nach Sartre, der „unentbehrliche Vermittler“ zwischen mir und mir selbst. In der Einleitung habe ich die Grenze zwischen dem persönlichen und dem öffentlichen Bereich, oder auch zwischen dem Bereich des Vertrauten und des Fremden, als eine „unsichtbare“ bezeichnet. Sie muss, wie Sartre deutlich zeigt, fortwährend durch das Individuum gesetzt werden; denn jeder Selbstentwurf hängt von ihr ab. Das Individuum ist nur dadurch Individuum, dass es sich von den Andern abgrenzt und sich ihnen gegenüber als solches behauptet. Eben um dies zu verdeutlichen, geht Sartre von der fundamentalen Scham angesichts eines fremden Blicks aus. Denn diese Scham ist nicht „konstruiert“, sie entsteht nicht etwa durch Reflexion, vielmehr ist sie ein Gefühl, das ich plötzlich habe und erlebe. Die Evidenz dieses Erlebnisses, sowie die der Scham wesentliche Eigenschaft, „vereinigendes Erfassens dreier Dimensionen“ zu sein, begründet mein Für-Andere-sein als konstitutives Moment meines Bewusstseins. Des Weiteren ist das Gefühl der Scham in Sartres Augen deshalb so zentral, weil sie eine reflexiv bedingte Reaktion nach sich zieht. Mit dieser Reaktion entscheide ich selbst über meine Haltung, ob ich sie unaufrichtig werden lasse[8], oder aber, ob ich eine aufrichtige, authentische Haltung einnehme. Dass dies eine große Schwierigkeit für das Individuum bedeutet, und inwiefern das Problem der Intimität als selbst gewählte Grenze daran grundlegend Teil hat, soll im Folgenden an einem Beispiel aus Kierkegaards Entweder-Oder illustriert werden. Intimität als „ethische Leistung“Bisher bin ich auf den Begriff der Intimität vor allem in seiner Bedeutung für die Selbstverwirklichung des Individuums eingegangen. Darin habe ich ihn, in Abgrenzung zur Öffentlichkeit, als einen persönlichen, lebensnotwendigen, bedrohten und schutzbedürftigen Bereich charakterisiert. Im Folgenden möchte ich auf die Bedeutung der Intimität im Rahmen zwischenmenschlicher Beziehungen eingehen. Die Aspekte der Intimität sind vielfältig, weil sie in den unterschiedlichsten Kontexten eine Rolle spielt. Ihre wesentliche Bestimmung aber liegt darin, dass sie nicht von vorneherein vorhanden ist, sondern immer erst durch Abgrenzung zustande kommt. Das Ziehen der Grenze wiederum ist mit Verantwortung verbunden. Indem ich mir einen intimen, persönlichen Bereich schaffe, übernehme ich Verantwortung mir selbst gegenüber; indem ich den des Andern wahre, übernehme ich Verantwortung dem Andern gegenüber. In dem Maße, wie das Problem der Intimität ein Problem der Intersubjektivität darstellt, ist es, meines Erachtens, auch ein ethisches Problem. Den ethischen Aspekt der Intimität sehe ich einerseits in der grundsätzlichen Tatsache, dass jeder Gedanke und jede Handlung zugleich Ausdruck meiner Entscheidung über die Grenze zwischen mir und dem Andern sind. Außerdem denke ich, dass der Umgang mit Intimität ein wesentlicher Bestandteil des eigenen Lebensentwurfs ist. Um dies zu veranschaulichen, und um das Problem der Intimität aus einer neuen Perspektive zu betrachten, gehe ich auf Kierkegaards Entweder-Oder[9] ein. Kierkegaard stellt zwei unterschiedliche Lebensformen einander gegenüber. Aus den Gedanken und Reflexionen der fiktiven Figur A geht hervor, dass er eine ästhetische Lebensweise gewählt hat, wohingegen die Briefe der fiktiven Figur B an A ausdrücken, dass dieser sich für eine ethisch-religiöse Lebensweise entschieden hat. A sucht Befriedigung im augenblicklichen Lustgewinn, wodurch er immer wieder auf die Erfahrung der Unlust zurückgeworfen wird; der Entwurf Bs hingegen ist nach dauerhaftem Glück, nach Kontinuität ausgerichtet. Die ästhetische Lebensweise beruht vor allem auf einem grundlegenden Zweifel, einem Mangel an Sinn; die ethisch-religiöse dagegen auf der Überwindung des Zweifels und auf dem Glauben an Gott. In einem seiner Briefe[10] unternimmt B den Versuch, die Ehe vor den Vorurteilen As ästhetisch zu rechtfertigen. Zunächst ruft B A ein von Letzterem in allen Einzelheiten durchkalkuliertes Szenario einer ästhetischen Ehe ins Gedächtnis. Diese ist vor allem geprägt vom Ideal der Heimlichkeit, das den gegenseitigen Reiz erhalten und jegliche Wiederholung vermeiden soll: „Dein Prinzip war offenbar Geheimnistuerei, Mystifikation, verfeinerte Koketterie […] Man muss […] einander so fremd sein, dass die Vertraulichkeit interessant wird, so vertraut, dass das Fremde ein reizender Widerstand wird.“ (646f, S.K.)[11] Des Weiteren bezeichnet er den Entwurf As als im Wesentlichen unästhetisch, da er die Aufgabe nicht „mit erotischem Ernst“ (649, S.K.) gestellt und daher auch nicht gelöst habe: Du hast Dich stets an einer Unmittelbarkeit als solcher festgeklammert, an einer Naturbestimmung, und hast es nicht gewagt, sie in einem gemeinsamen Bewusstsein sich verklären zu lassen; denn das ist es, was ich mit den Worten Aufrichtigkeit und Offenheit ausgedrückt habe. Du fürchtest, wenn das Rätselhafte vorbei ist, so werde die Liebe aufhören; ich hingegen meine, wenn dies vorbei ist, so fängt sie erst an. Du fürchtest, dass man wohl nicht ganz wissen dürfte, was man liebt, Du rechnest auf das Inkommansurable als ein absolut wichtiges Ingrediens; ich halte dafür: erst wenn man weiß, was man liebt, liebt man in Wahrheit. (649, S.K.) Hieraus geht hervor, dass A den intimen Aspekt der ehelichen Liebe mit Heimlichkeit verwechselt; bei B zeichnet er sich aber gerade durch Offenheit und Aufrichtigkeit aus. Nicht nur bezüglich der Ehe, sondern auch in anderen zwischenmenschlichen Bereichen zeigt sich, dass A die Vertraulichkeit flieht, weil sie den Widerstand nimmt, aus dem sich für ihn der ästhetische Reiz ergibt. Er will vielmehr in allen Bereichen des Lebens ein Fremder bleiben; indem er sich nicht auf eine bestimmte Möglichkeit hin entwirft, legt er sich auch nicht fest und bleibt eine Art Phänomen. Das Reizvolle seiner Lebensweise besteht für ihn genau darin, für den Andern durch die Wahrung der Distanz ein unfassbares Mysterium zu bleiben. Aus Angst vor der Wiederholung behält er sich seine Möglichkeiten offen; eine Entscheidung würde ja bedeuten, eine Grenze zu ziehen, was in seinen Augen eine Eingrenzung seiner Individualität und Genialität bedeuten würde. Er will, in Sartres Worten, nicht zum Objekt werden, und hält an sich selbst als an einem „reinen Subjekt“ (486) fest. Somit behauptet A dem Andern gegenüber den Standpunkt des Beobachters, sein Interesse am Andern ist ein experimentelles und beruht auf Neugierde. (534, S.K.) Man kann sagen, dass B an dem Punkt ansetzt, an dem A zurückweicht. Für B bildet, seiner ethisch-religiösen Haltung gemäß, die Eingrenzung gerade die Grundlage für ein erfülltes Leben. Das ästhetisch Schöne liegt für ihn im Dauerhaften, in dem er nicht etwa Wiederholung, sondern vielmehr täglich das Neue sieht. Diese Perspektive beruht darauf, dass er das Leben mit Ernst (534, S.K.) und als eine Aufgabe betrachtet. Sein Weltbild, mithin seine ethisch-religiöse Lebensweise, beruhen grundsätzlich auf der Grenze, die er vor Gott zieht. Er sieht das Erbauliche „[…] in dem Gedanken, dass wir gegen Gott immer Unrecht haben.“ (923, S.K.)[12] Mit seiner Entscheidung für die Ehe zieht B eine Grenze, innerhalb derer sich die Liebe, seiner Ansicht nach, erst zu wahrer Liebe entwickelt. Die Grundlage hierfür bildet der intime, vertrauliche Rahmen, der aber nicht in Heimlichkeit, sondern vielmehr in Offenheit besteht. Das Zulassen und Bejahen der Intimität betrachte ich also ferner als eine ethische Leistung, insofern sie die Grundlage zwischenmenschlicher Beziehungen bildet: A lässt deswegen keine intime Beziehung zu, weil er seinen Standpunkt, von dem aus er über den Andern als über einen Gegenstand der Beobachtung urteilt, nicht verlassen will. Ich denke aber, dass das Zulassen der Intimität in diesem Rahmen die entscheidende Voraussetzung dafür ist, sich gegenseitig als „gleichwertige Subjekte“ zu erfahren. Sartre erkennt, dass die Affekte der Scham und der Angst für das Individuum unangenehme Erlebnisse darstellen; deshalb bezeichnet er das Objekt-Ich auch als „Unbehagen“ (494). Das unangenehme Erlebnis birgt bereits die Reaktion der Flucht, denn von einem unbehaglichen Gefühl versucht man sich ja zu lösen. Dies setzt wiederum voraus, dass die eigene Scham als solche anerkannt wird, was nur geschehen kann, wenn das Individuum sich seinen Objektcharakter für den Andern eingesteht. Man muss, schreibt Sartre, eine Grenze für die eigene Subjektivität akzeptieren (512). Diese Grenze ist die Grundlage für jede „authentische“ Reaktion. Was Kierkegaard anhand der Figur As ausarbeitet, ist ein Lebensentwurf, der keinerlei Grenzen über die eigene Subjektivität anerkennt und sich dadurch, aus der ethischen Perspektive gesehen, die Grundlage für eine Selbstverwirklichung entzieht. Er ist für sich, ebenso wie für Andere, ein Phänomen, gelangt aber nicht zu einem Selbst. Indem B dagegen die Grenze zieht und sich somit als „Objekt“ preisgibt, verwirklicht er die Möglichkeit einer intimen, vertrauten Beziehung zu sich selbst, sowie zu Anderen. Eben darin, dass er weder für sich selbst, noch für Andere fremd sein will und vielmehr in jeglicher Beziehung Offenheit fordert, liegt für ihn die Voraussetzung der Selbstverwirklichung. Der intime Bereich bildet hierbei die Grundlage für die Entwicklung von Offenheit und Aufrichtigkeit. Der Wert der IntimitätSartre untersucht das Verhältnis des Subjekts zu seinem eigenen Sein und Nichts auf einer phänomenologisch-ontologischen Ebene. Sein Anliegen ist nicht in erster Linie ein ethisches; es geht ihm grundsätzlich darum, zu differenzieren, was ist und was nicht ist. Dennoch hat seine Forderung nach Authentizität eine ethische Dimension; denn sie gründet darauf, dass es nicht gleichgültig ist, wie das Subjekt sein Leben gestaltet. Um sich zu verwirklichen, muss es sich auf seine eigene Freiheit hin entwerfen. Dies setzt wiederum voraus, dass es die eigene Freiheit als einen Wert erfasst. Dazu bedarf es der ständigen Reflexion über die Rolle des Subjekt- und Objekt-Ichs, ebenso wie des Subjekt- und Objekt-Anderen. Die Herangehensweise Kierkegaards an den Entwurf des Individuums ist eine ethisch-religiöse. In seinem Vorwort zu Die Krankheit zum Tode schreibt er: „Alles Christliche muss in seiner Darstellung dem ärztlichen Bericht am Krankenbett ähneln[…]Dies ist das Verhältnis des Christlichen zum Leben (im Gegensatz zu einer wissenschaftlichen Ferne vom Leben) […]“. Die Wissenschaftlichkeit sei „gleichgültig“ und gehe mit einer „Art unmenschlicher Neugier“ vor.[13] Auch wenn Sartre und Kierkegaard in ihren philosophischen Schriften von unterschiedlichen Standpunkten und Hintergründen ausgehen, spielt die ethische Komponente bei beiden eine entscheidende Rolle. Das Individuum hat die Aufgabe, sein Dasein zu verwirklichen; dies bedeutet, dass es das Leben als einen Wert, sei es der der Freiheit oder der der Demut und des Glaubens, begreifen muss. Der Gedanke des Wertes des Lebens ist deshalb zentral, weil das Individuum sowohl Subjekt- als auch Objektcharakter hat, was besonders in zwischenmenschlichen Beziehungen zum Tragen kommt. Das Individuum lebt in der ständigen Gefahr, vom Andern lediglich als Objekt betrachtet zu werden; Sartre beschreibt dies anhand der Gefühle der Furcht, Scham und Knechtschaft, Kierkegaard verweist auf die Gefahr der Wissenschaftlichkeit sowie der „unmenschlichen Neugier“ im Umgang mit dem Leben. Intimität bildet den Raum, in dem das Individuum für sich sein kann, in dem es Subjekt ist. Jeder Angriff auf die Intimsphäre des Individuums macht sich, wie ich in der Einleitung dargelegt habe, seinen Objektcharakter zunutze. Was bei der Anwendung der Folter geschieht, ist, dass die Person als Informationsquelle missbraucht und ihre Subjektivität negiert wird. Intimität habe ich ferner als ein Problem der Intersubjektivität beschrieben. Dass jede Auseinandersetzung mit der Intersubjektivität auf ethischer Ebene geschehen muss, wird anhand der Missachtung der Intimität des Subjekts sichtbar. Um die Intimität wahren zu können, bedarf es der Anerkennung ihrer als eines unentbehrlichen, lebensnotwendigen Wertes. Dies wiederum erfordert die ständige Reflexion über den eigenen Umgang mit dem Andern; es geht darum, den Andern immer zugleich in seiner Subjektivität zu erfassen.
Anmerkungen
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/53/mo1.htm
|
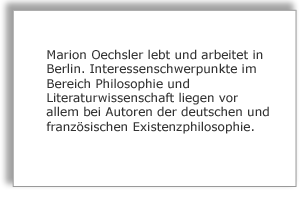 Intimität definiert sich über einen persönlichen Bereich des Individuums, der vom Bereich der Öffentlichkeit abgegrenzt ist. Allerdings ist diese Grenze keine gegebene, wodurch das Thema „Intimität“ zu einem philosophischen Problem wird. Es ist nicht zuletzt deshalb ein schwerwiegendes Problem, weil die Missachtung eben dieser Grenze, das gewaltsame Eindringen in den innersten, persönlichsten Bereich von außen, dem Individuum erheblichen (seelischen) Schaden zufügt. Die Bedrohung der Intimität ist umso größer, als die Grenze eine unsichtbare ist, deren Wahrung im alltäglichen Leben den Regeln der Konvention obliegt. Die Anerkennung des intimen, persönlichsten Bereichs des Individuums als lebensnotwendig, bedroht und schutzbedürftig, findet ihren juristischen Ausdruck im ersten Paragraphen des Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.
Intimität definiert sich über einen persönlichen Bereich des Individuums, der vom Bereich der Öffentlichkeit abgegrenzt ist. Allerdings ist diese Grenze keine gegebene, wodurch das Thema „Intimität“ zu einem philosophischen Problem wird. Es ist nicht zuletzt deshalb ein schwerwiegendes Problem, weil die Missachtung eben dieser Grenze, das gewaltsame Eindringen in den innersten, persönlichsten Bereich von außen, dem Individuum erheblichen (seelischen) Schaden zufügt. Die Bedrohung der Intimität ist umso größer, als die Grenze eine unsichtbare ist, deren Wahrung im alltäglichen Leben den Regeln der Konvention obliegt. Die Anerkennung des intimen, persönlichsten Bereichs des Individuums als lebensnotwendig, bedroht und schutzbedürftig, findet ihren juristischen Ausdruck im ersten Paragraphen des Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.