
Kitsch - Kopie - Nostalgie |
Offenheit und Freundschaft
Grundbegriffe der Gegenwart GottesChristoph Fleischer
Der Hauptteil der Untersuchung Deibls ist nach Vattimos Ansatz zur Religion überschrieben mit „Die Spur der Spur – Religion als Wiederkehr“. Die Auseinandersetzung mit den Quellen des Denkens Vattimos macht es nötig, nun auch Bezüge zur Religionskritik, zu Hegel und zu Nietzsche und besonders zu Martin Heidegger zu beschreiben. Die Lektüre Heideggers ist nicht abgeschlossen, ja sie scheint den Autor manchmal so zu faszinieren, dass er nicht nur in die Sprachwelt Heideggers eintaucht, sondern einige Male darin verbleibt. Interessant ist, dass der Begriff der „Wiederkehr“ nicht formal bleibt, etwa als Wiederbelebung der Religion verstanden, sondern dass Wiederkehr als ein Kennzeichen „der Gottesspur als Spur des Glaubens und seiner Bestreitung“ erscheint und sich die biblische Religion in einem Wechselspiel zwischen Exodus und Wiederkehr vollzieht. Säkularisierung ist als Neuentdeckung des Subjekts, nicht als Auflösung der Religion zu deuten. Auch Nietzsche ist kein Befürworter des endgültigen Abschüttelns religiösen Denkens. Er geht den Weg des Abschieds von der Religion wie Sprossen auf einer Leiter nicht nur herauf, sondern dann auch wieder herunter. Religion kann auch durch die Kritik und die Moderne hindurchgehen und quasi verwandelt wiederkehren. Mit Heidegger taucht dann der Begriff der Verwindung auf, die das abwertende „Überwindung“ ersetzt. Vattimo bringt diese Erfahrung mit dem Begriff „Pietas“ in Verbindung: „Pietas ist die Liebe zum Lebendigen und dessen Spuren.“ Heideggers Entwurf in „Sein und Zeit“, der Leben als Sterblichkeit und Vorlauf auf den eigenen Tod zu deuten vermag, weist den Menschen damit auf die „Endlichkeit seiner Existenz“ hin. Heidegger beschreibt damit das Leben innerhalb seiner Grenzen und deutet es gerade im Horizont der Unverfügbarkeit als „Ereignis“. Was sich ereignet, kann von Vattimo in der Nähe der Pietas gesehen werden. Die Rolle des Göttlichen erweist sich im Umgang mit dem Wort „Ding“, das als Symbol der Unverfügbarkeit den Geschenkcharakter des gegebenen Lebens verdeutlicht. Der Autor kann solche Vorgaben gut in theologische Denkvoraussetzungen einfügen und zeigt damit auch, wie aktuell im Grunde die existentiale Interpretation nach wie vor ist, wenn auch die Nennung der dieser von Heidegger beeinflussten Richtung zugeneigten evangelischen Theologen hier komplett entfällt. Der Charakter des Glaubens als persönlich zu verantwortende Interpretation führt an Grundaussagen der Theologen des 20. Jahrhunderts heran, die allerdings unter der Maßgabe der Rede von „Kenosis“ und des zu erfolgenden sprachlichen Herrschaftsverzichts zu modifizieren wären. Dies kann sowohl an der Verkündigung der Menschwerdung Gottes als auch der Auferweckung Christi gezeigt werden und so beginnt mit Christus die „Geschichte der Interpretation“. Erst mit Christus erscheint die Göttlichkeit Gottes in Symbolen, die das Göttliche sprachlich zu fassen vermögen. Später zeigt Deibl damit, dass sich Vattimo im Rückgriff auf Hegel vom Begriff der Eigentlichkeit distanziert, um von daher den Raum der „Unverfügbarkeit“ auch als „Alltäglichkeit“ zu würdigen. Dadurch gehört die „Säkularisierung“ zur Mitte der christlichen Religion, was sich vom Bild der offenen Stadt her ja schon nahe legte. Das Fazit der Besprechung des Buches von Deibl könnte darin liegen, dass er das Werk Vattimos für theologisches Denken öffnet und gerade dadurch die biblischen Bezüge besprechbar macht. Zuerst kam mit dem Ende der Metaphysik auch der starre Gebrauch der Religion ins Wanken, besonders dann, wenn von institutioneller Seite das Wirken Gottes in Herrschaftsbegriffe gefasst worden ist. Die biblischen Traditionen der Offenheit, der Interpretation, des schwachen Glaubens und der Wiederkehr sind wieder neu zu entdecken und im Kreis der Moderne erneut gegen alle falschen Festlegungen und Bindungen fruchtbar zu machen. Die Kirche kann die Säkularisierung nicht rückgängig machen, sondern sollte in der Entdeckung ihrer Wurzeln diese gerade als ihr eigenes zweites Gesicht erkennen. Die Frage wäre hier, was vielleicht die Einbeziehung evangelischer
Das Buch Jakob Helmut Deibls zeigt, dass sich das Wirken Vattimos in der
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/57/xx.htm
|
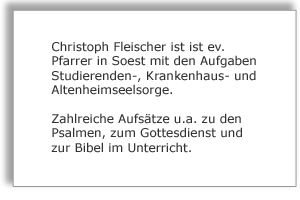 Es ist bezeichnend, dass nach der Beschreibung Jakob Helmut Deibls, der am Stift Melk als Lehrer tätig ist und mit diesem Buch seine theologische Diplomarbeit bei Johann Reikerstörfer in Wien veröffentlicht, in der postmodernen Lektüre christlich religiöser Texte der Schöpfungsgedanke und der Inkarnationsgedanke aufgegriffen und neu interpretiert werden. Mit dem Ende der Metaphysik, das Gianni Vattimo in der Berufung auf Nietzsche und Heidegger postuliert und dem Ende der großen Erzählungen nach Lyotard beginnt keine neue Entmythologisierung. Vielmehr eröffnet dieses Ende im Gegenteil die Aufdeckung des Sinns religiöser Symbole. Der Theologe Deibl verweist daher zu recht immer auch auf biblische Erzähltexte, die solches beispielhaft illustrieren. Nach Deibl ist das Ziel der Geschichte die „offene Stadt“ (Offenbarung 21) und, solange sie es nicht ist, wird der Erlöser draußen geboren, „bleibt zeitlebens ortlos“ und das Zeichen der Erlösung, das Kreuz, steht draußen vor der Stadt. Diese Erlösung bzw. Sinngebung ist im Sinne der Philosophie Gianni Vattimos so zu denken, dass die Überwindung der Geschlossenheit ein Symbol des Friedens ist. Offenbarung kann nicht mehr als „Identifikation von Ereignis und Sinn“ gedeutet werden. Auf Offenbarung, die als „Sinn-Vorgabe“ verstanden wird, folgt zwangsläufig die Interpretation, die offen und als nicht metaphysisch abschließbar gedacht werden kann. Das „christliche Ideal ist nicht die Zurückgezogenheit und das Um-sich-Kreisen der kleinen Herde, ja nicht einmal die moralisch intakte Kontrastgemeinde“. Theologisch gesagt, rückt mit Vattimo der Begriff der Kenosis in den Vordergrund. Das Christentum braucht so gesehen noch nicht einmal „Hüter der Religion“ als „Wächter über die Grenzen des Unverfügbaren“, sondern offenbart sich in der „Schwächung starker Strukturen“ entsprechend dem Bild des neuen Jerusalems ohne Tempel und ohne den Unterschied zwischen sakral und profan. Als Beispiel folgt daraus bei Vattimo die Apologie des Halbgläubigen, der zu glauben glaubt. Hierdurch vollzieht sich gerade im Abschied der Metaphysik ein „Abbau der Herrschaftsverhältnisse in der Gottesbeziehung“, dessen äußeres Zeichen kein Tempel, sondern schwacher Glaube ist. Diese Qualität des Glaubens liegt in der philosophischen Voraussetzung gerade darin begründet, das diese Auffassung das Denken und die Vernunft nicht gegen den Glauben ausspielt und damit etwas das Opfer des Verstandes fordert, so dass nun im Glauben auch Vernunft möglich bleibt.
Es ist bezeichnend, dass nach der Beschreibung Jakob Helmut Deibls, der am Stift Melk als Lehrer tätig ist und mit diesem Buch seine theologische Diplomarbeit bei Johann Reikerstörfer in Wien veröffentlicht, in der postmodernen Lektüre christlich religiöser Texte der Schöpfungsgedanke und der Inkarnationsgedanke aufgegriffen und neu interpretiert werden. Mit dem Ende der Metaphysik, das Gianni Vattimo in der Berufung auf Nietzsche und Heidegger postuliert und dem Ende der großen Erzählungen nach Lyotard beginnt keine neue Entmythologisierung. Vielmehr eröffnet dieses Ende im Gegenteil die Aufdeckung des Sinns religiöser Symbole. Der Theologe Deibl verweist daher zu recht immer auch auf biblische Erzähltexte, die solches beispielhaft illustrieren. Nach Deibl ist das Ziel der Geschichte die „offene Stadt“ (Offenbarung 21) und, solange sie es nicht ist, wird der Erlöser draußen geboren, „bleibt zeitlebens ortlos“ und das Zeichen der Erlösung, das Kreuz, steht draußen vor der Stadt. Diese Erlösung bzw. Sinngebung ist im Sinne der Philosophie Gianni Vattimos so zu denken, dass die Überwindung der Geschlossenheit ein Symbol des Friedens ist. Offenbarung kann nicht mehr als „Identifikation von Ereignis und Sinn“ gedeutet werden. Auf Offenbarung, die als „Sinn-Vorgabe“ verstanden wird, folgt zwangsläufig die Interpretation, die offen und als nicht metaphysisch abschließbar gedacht werden kann. Das „christliche Ideal ist nicht die Zurückgezogenheit und das Um-sich-Kreisen der kleinen Herde, ja nicht einmal die moralisch intakte Kontrastgemeinde“. Theologisch gesagt, rückt mit Vattimo der Begriff der Kenosis in den Vordergrund. Das Christentum braucht so gesehen noch nicht einmal „Hüter der Religion“ als „Wächter über die Grenzen des Unverfügbaren“, sondern offenbart sich in der „Schwächung starker Strukturen“ entsprechend dem Bild des neuen Jerusalems ohne Tempel und ohne den Unterschied zwischen sakral und profan. Als Beispiel folgt daraus bei Vattimo die Apologie des Halbgläubigen, der zu glauben glaubt. Hierdurch vollzieht sich gerade im Abschied der Metaphysik ein „Abbau der Herrschaftsverhältnisse in der Gottesbeziehung“, dessen äußeres Zeichen kein Tempel, sondern schwacher Glaube ist. Diese Qualität des Glaubens liegt in der philosophischen Voraussetzung gerade darin begründet, das diese Auffassung das Denken und die Vernunft nicht gegen den Glauben ausspielt und damit etwas das Opfer des Verstandes fordert, so dass nun im Glauben auch Vernunft möglich bleibt.