
Religion und Politik |
Kirchliche Arbeit im urbanen GemeinwesenJörg Herrmann 1. Die Stadt heute und gestern
Aber Dichte, weitere Verdichtung und Vielfalt bringen auch Probleme mit sich, die gelöst werden müssen: Ich nenne nur Stichworte: Wohnraum, Mobilität, Segregation und Integration, Heterogenität und Differenz, Kommunikation und Toleranz, Anonymität und Gewalt. Zwei biblische Bilder stehen für die dunkle und für die utopische Seite der Stadt: Babylon und Jerusalem. Vor Babel liegt noch Henoch, die erste Stadt der Bibel, von Kain, dem Brudermörder, gegründet, jenseits von Eden. Sie symbolisiert den Beginn kulturellen Schaffens: das Selbstgeschaffene, dasjenige, was der Mensch über das Gegebene hinaus schafft. 2. Religion in der StadtDie europäische Stadt des Mittelalters war ein religiös integrierter und durch die Autorität der Kirche sanktionierter Kosmos. Das hat sich geändert. Mit dem Beginn der Neuzeit rückten Marktplatz und Rathaus immer mehr in den Mittelpunkt der Stadt. Heute ist die europäische Stadt ein multikultureller und multireligiöser Kosmos. Diese Signatur der Stadt wird allerdings nicht unbedingt in ihren Innenstadtbereichen schon so deutlich sichtbar. Denn viele Innenstädte haben einen Umstrukturierungsprozess hinter sich, der aus ihnen Zentren der Prestigearchitektur, des Konsums und der Dienstleistungen gemacht hat. Inmitten dieses demonstrativen Konsums liegen die Innenstadtkirchen, immerhin. Sie bieten hier nach wie vor Gelegenheiten zur Einkehr. Sie sind Orte der Unterbrechung, der Gegenentwürfe zur ökonomischen Steigerungslogik und der Kritik an der weiteren Privatisierung öffentlicher Güter. Hier halten die alten Kirchen die Stellung gegen die Alleinherrschaftsansprüche der modernen Ökonomie, noch keine Minarette. Um den multireligiösen Charakter der Stadt wahrzunehmen, muss man genauer hinsehen und sich in der ganzen Stadt umsehen. Dann zeigt sich zum Beispiel: Allein in Hamburg gibt es über vierzig Moscheen. In einer Weltstadt wie Hamburg finden sich fast alle in der Welt verbreiteten Religionen und Kulte. Aber das heißt noch lange nicht, dass das interreligiöse Gespräch dort auch schon boomt oder sich die Gläubigen aller Religionen im Gemeinwesen die Klinke in die Hand geben. Religionen sind eben auch gerade für Migranten identitätsstiftende Codes, die der Vergewisserung der eigenen Herkunft und dann auch der Abgrenzung nach außen dienen. Der Theologe Wolfgang Grünberg hat davon gesprochen, dass Religionen gerade für Menschen, die aus anderen Regionen der Welt nach Hamburg gekommen sind, so etwas wie eine „transportable Heimat“ seien.[6]
3. Die evangelische Kirche im urbanen KontextWas leistet die Evangelische Kirche für das Funktionieren der Gemeinschaft? Wie wird diese Praxis in der eigenen Tradition begründet? Im Blick auf die Gemeinschaft denke ich an die Stadt, das ist durch meine Einleitung deutlich geworden. Ich versuche also kurz zu beschreiben, was die Kirche heute schon für das urbane Gemeinwesen leistet, wie dieses Engagement in der Tradition begründet ist und woran, insbesondere wieder im Blick auf die Herausforderungen der Großstadt, m.E. in Zukunft noch gearbeitet werden sollte. 3.1. Was wir tunKommunikation und Praxis des Evangeliums, das ist, ganz allgemein gesagt, die Aufgabe der Kirche. In traditioneller Sprache: Verkündigung und Diakonie, das Wort Gottes predigen und den Schwachen helfen – Gottesliebe und Nächstenliebe, wenn man so will. Beides gehört zusammen, so sagt es auch das Doppelgebot der Liebe. Nach christlichem Verständnis ist die tätige Nächstenliebe dabei der Reflex der erfahrenen Gottesliebe. Aus dem Glauben folgt soziales Engagement. In der Gemeindearbeit heißt das zunächst: Gottesdienst mit Wort und Sakrament, Kasualien (Taufe, Trauung, Beerdigung), Seelsorge, Unterricht und Diakonie in unterschiedlichen Formen. Das ist das Pflichtangebot der Kirchengemeinden. Hinzu kommen kirchenmusikalische und zielgruppenspezifische Angebote wie etwa Kinder- und Altenarbeit und besondere Schwerpunkte und Profile. Darüber hinaus und daneben gibt es die übergemeindlichen Einrichtungen mit ihren Angeboten. Diese reichen von den LehrerInnenfortbildungen des Pädagogisch-Theologischen Instituts über die Beratungsarbeit des kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt und der Flüchtlingsbeauftragten bis hin zur Arbeit der Akademie an gesellschaftspolitischen Gegenwartsfragen und dem Medienwerk mit seinen publizistischen Aktivitäten, die nach wie vor dem Grundsatz verpflichtet sind, den „Stummen eine Stimme“ geben zu wollen. Soziologisch gesprochen vermittelt die Kirche Sinnorientierung und Lebensbegleitung, eröffnet Räume spiritueller Kommunikation und Praxis, stiftet Gemeinschaft und trägt mit ihrer gesellschaftsdiakonischen und gesellschaftskritischen Arbeit zur Humanisierung und zum schlichten Funktionieren des Gemeinwesens bei. In der Stadt nun hat sich die Arbeit der Gemeinden zum Teil kontextbezogen in spezifischer Weise entwickelt. Gemeinden haben Arbeitsschwerpunkte ausgebildet, innerhalb derer sie auf die besonderen Herausforderungen ihres Quartiers reagieren. Ich denke an die gemeinwesendiakonische Ausrichtung im Osdorfer Born, an die Kirche der Stille in Altona, an die Musikaktivitäten der Kirchengemeinde in Ottensen, an die Gemeindeakademieaktivitäten in Blankenese und im Alstertal und die stadtteilorientierte Gemeindearbeit mit interkultureller und interreligiöser Ausrichtung in Hamburg-St. Georg-Borgfelde. Ein Sonderfall sind die großen Innenstadtkirchen wie St. Michaelis oder St. Petri, die Personal- oder auch Kasualgemeinden versammeln, die ihre stadtweit ausstrahlenden thematischen Schwerpunkte haben, die eine wichtige Rolle für die Identität und das Gedächtnis der Stadt spielen und die zumeist auch Arbeitsformen der sogenannten Citykirchenarbeit entwickelt haben. Dabei geht es darum, ein einladendes und profiliertes Angebot für die Menschen in der Stadt zu machen, die sich eher als Flaneure, Passanten und Pendler in Sachen Religion erleben. Die religiös interessiert sind, aber nicht gleich sesshaft werden wollen. Zum Spektrum der Angebote gehören Kirchenläden und Kirchencafés, Kirchenführungen, Ausstellungen, Kirchennächte und Wiedereintrittsstellen. Hinzu kommen die vielfältigen auf die Stadt bezogenen Hilfsangebote des Diakonischen Werkes Hamburg. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie die kirchliche Arbeit von den Kirchenmitgliedern selbst bewertet wird. Die seit 1972 durchgeführten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen der EKD zeigen, dass drei Aspekte des kirchlichen Handelns besonders positiv bewertet werden: das diakonische Engagement für Einzelne, die geistliche Begleitung durch Kasualien und der Gottesdienst. [7] 3.2. Wie ist all das in der eigenen Tradition begründet?Das will ich noch etwas genauer ausführen. Zunächst ist zu bemerken, dass das Christentum von Anfang an einen universalen Anspruch hatte, der Gott der Christen war und ist der Schöpfer von Himmel und Erde, nicht nur ein partikularer Teilgott mit begrenzter Bezirksverantwortung. Und diese Universalität ist schon in der hebräischen Bibel präsent, schöpfungstheologisch, aber auch ethisch. So fordert z.B. der Prophet Jeremia die nach Babel deportierten Israeliten auf, sich nicht in sich selbst zurückzuziehen, sondern sich auch und sogar in der Fremde und zugunsten der Einheimischen für das Gemeinwesen einzusetzen. „Suchet der Stadt Bestes“, ruft er ihnen zu. Religion also nicht als „transportable Heimat“ für nostalgische Stunden am migrantischen Lagerfeuer, sondern als Aufforderung, auch hier in der Fremde Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen. Im Neuen Testament lassen sich viele Stellen benennen, die diese Linie fortschreiben. Das reicht vom Missionsauftrag, aller Welt das Evangelium zu verkünden, bis hin zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Auf die Frage, wer denn mein Nächster sei, antwortet Jesus mit der bekannten Geschichte, in der der Nächste eben derjenige Notleidende ist, dem man auf seinem Weg als Nächstem begegnet, und in der ein ethnisch fremder und religiös andersgläubiger Samariter zum Vorbild Grenzen überwindender Nächstenliebe wird. Zentraler Begriff evangelischer Sozialethik ist heute der Begriff der sozialen Gerechtigkeit. Er kondensiert die auch unter der Überschrift „Option für die Armen“ diskutierten biblischen Traditionen wie sie sich u.a. im Buch Exodus, bei den Propheten und im Gleichnis vom Weltgericht finden. Wenn man dies betont, muss man zugleich zugeben, dass die Orientierung an diesen Überlieferungen im Zuge der Kirchenreformprozesse der letzten Jahre manchmal in den Hintergrund getreten ist. Heinrich Bedford-Strohm bemerkt: „Heute ist die Gefahr der Kirche nicht mehr, dass sie sich zu viel um die Welt kümmert und ihre eigene Frömmigkeitsbasis vergisst. Heute ist ein neuerlicher Rückzug in die eigenen Gemeinschaften und ihre spirituellen Kulturen, der einhergeht mit einer Entpolitisierung, die größere Gefahr. Wenn von ‚Kernkompetenzen‘ im EKD-Reformprozess die Rede ist, ist in der Regel Gottesdienst und Seelsorge gemeint. Das Wort ‚Gerechtigkeit‘ fehlt merkwürdigerweise in den meisten Fällen.“[8] In dem 2007 veröffentlichten EKD-Text „Gott in der Stadt. Perspektiven evangelischer Kirche in der Stadt“ werden die unterschiedlichen Aspekte der kirchlichen Arbeit in der Stadt im Anschluss an die traditionelle Unterscheidung eines priesterlichen, eines prophetischen und eines königlichen Amtes Jesu Christi noch differenzierter entfaltet.[9] Bei der priesterlichen Dimension geht es um den Gottesdienst, bei der prophetischen um den öffentlichen Anspruch des Evangeliums und bei der königlichen Dimension um den missionarischen Aufbruch und die Überschreitung der klassischen kirchlichen Milieus. Um Ihnen zu verdeutlichen, wie und woran in diesem Text gedacht wird, zitiere ich einen Absatz, der das prophetische Engagement beschreibt.
Im Blick auf die Arbeitsformen unterscheidet das EKD-Papier zwischen quartiersbezogener, profilbezogener und situativer Arbeit und fordert ein Gesamtkonzept kirchlicher Präsenz in der Stadt, das eine sinnvolle Verhältnisbestimmung der Angebote vornimmt. Es fragt u.a.: „Wie kann ein gesamtstädtischer kirchlicher Handlungsplan entworfen und umgesetzt werden, wenn in der Perspektive einzelner Ortsgemeinden erst einmal alle Anstrengungen nur der eigenen Gemeinde gelten?“[11] Von Antworten sind wir noch weit entfernt, aber die Arbeit nicht zuletzt an dieser Frage gehört zu den Aufgaben der Zukunft. Welche Herausforderungen müssen noch in den Blick genommen werden? 3.3. Woran muss insbesondere gearbeitet werden?Interessant ist zu beobachten, dass die aktuellen Stadtentwicklungs- und Gemeinwesendiakonie-Diskurse an vielen Stellen konvergieren. So schreibt die Stadtplanerin Petra Potz über die aktuellen Grundsätze integrierter Stadtentwicklung („Leipzig Charta“), dass es dabei um eine „Ressorts und Ebenen übergreifende Zusammenarbeit“ gehe, um „die Integration unterschiedlicher Themen- und Handlungsfelder, die Bündelung von Ressourcen und letztendlich auch um den Aufbau neuer interdisziplinärer Entwicklungspartnerschaften für die Belange der Stadtentwicklung“.[12] Wenig später zitiert sie ganz ähnliche Überlegungen aus dem 2007 vom Diakonischen Wert der EKD in Stuttgart herausgegebenen Text „Handlungsoption Gemeinwesendiakonie“[13], in dem gefordert wird, dass sich die Diakonie als Partner gemeinsam mit anderen Trägern an der sozialen Stadtentwicklung und der Mitgestaltung des Sozialraumes beteiligen solle. An erster Stelle steht dabei die Zusammenarbeit in der eigenen Familie gewissermaßen, die Zusammenarbeit nämlich zwischen Kirchengemeinden und diakonischen Diensten, die in der Realität allerdings nach wie vor zu wünschen übrig lässt. Das sieht auch die im EKD-Kirchenamt für Sozial- und Gesellschaftspolitik zuständige Oberkirchenrätin Cornelia Coenen-Marx ähnlich. Sie schreibt: „Mein Eindruck ist, die verschiedenen Gruppen verfolgen noch unterschiedliche Handlungsstrategien – die einen eher religiös-kulturell orientiert, die anderen auf Kommune und soziale Arbeit bezogen. Die quartiersbezogene Entwicklung in den diakonischen Handlungsfeldern wie Pflege und Armutsprojekte, Familienbildungs- und Beratungsarbeit ringt noch um die Kooperation mit Kirchengemeinden. Hier wird noch schmerzlich spürbar, dass die Fachleute und Generalisten in ‚Kirche und Diakonie‘ verschiedene Sprachen sprechen, selbst wenn sie dieselbe Bewegung mitgestalten.“[14] Da könnte also noch manches Pfingstwunder kommen! Auf dem Weg von Babylon nach Jerusalem. Anmerkungen[1] Georg Simmel, Die Großstadt und das Geistesleben, in: ders., Gesamtausgabe Bd. 7, hrsg. Von D. P. Frisby und K. Chr. Köhnke, Frankfurt/M. 1989, 116 – 131. [2] Ders., a.a.O., 116. [3] Vgl. ders., a.a.O., 118ff. [4] Vgl. Gert Mattenklott, Artikel „Stadt“, in: Christoph Wulf (Hg.), Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie, Weinheim/Basel 1998, 211 – 220, 216. [5] Ebd. [6] Wolfgang Grünberg, Die Sprachen der Stadt. Skizzen zur Großstadtkirche, Leipzig 2004, 118. [7] Vgl. Gerald Kretzschmar, Mitgliederorientierung und Kirchenreform. Die Empirie der Kirchenbindung als Orientierungsgröße für kirchliche Strukturreform, in: Pastoraltheologie 101. Jg., 2012, 152 – 168, 163ff. [8] Heinrich Bedford-Strohm, Quartiersarbeit in Kirche und Diakonie. Vortrag beim EKD-Zukunftskongress am 25.9.2009, http://www.kirche-im-aufbruch.ekd.de/zukunftswerkstatt/programm/forum/diakonie.html. [9] Kirchenamt der EKD (Hg.), Gott in der Stadt. Perspektiven evangelischer Kirche in der Stadt, EKD Texte 93, Hannover 2007, 47ff. [10] Dies., a.a.O., 50. [11] Dies., a.a.O., 63. [12] Petra Potz, Kirche findet Stadt – Potenziale und Perspektiven für eine strategische Plattform der integrierten Stadtentwicklung, in: eNewsletter Wegweiser Bürgergesellschaft 19/2012 vom 12.10.2012, 1-8, 2. [13] Diakonisches Werk der EKD (Hg.), Handlungsoption Gemeinwesendiakonie. Die Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt als Herausforderung und Chance für Kirche und Diakonie, Diakonie Text 12, Stuttgart 2007. [14] Cornelia Coenen-Marx, Überlegungen für eine Strategie der Gemeinwesendiakonie als Teil des kirchlichen Reformprozesses, in: Badische Pfarrvereinsblätter. Mitteilungsblatt des Evangelischen Pfarrvereins in Baden e. V., 5/2012, 158 – 163, 163. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/82/jh26.htm
|
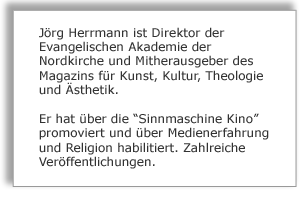 Ich möchte mit ein paar Schlaglichtern auf das beginnen, was uns verbindet: Das Leben in der Stadt. Zunächst: Was kennzeichnet die Stadt? Im Großen und Ganzen gilt immer noch, was Georg Simmel in seinem berühmten Aufsatz „Die Großstadt und das Geistesleben“ von 1903 als charakteristisch für das großstädtische Leben beschrieb.
Ich möchte mit ein paar Schlaglichtern auf das beginnen, was uns verbindet: Das Leben in der Stadt. Zunächst: Was kennzeichnet die Stadt? Im Großen und Ganzen gilt immer noch, was Georg Simmel in seinem berühmten Aufsatz „Die Großstadt und das Geistesleben“ von 1903 als charakteristisch für das großstädtische Leben beschrieb.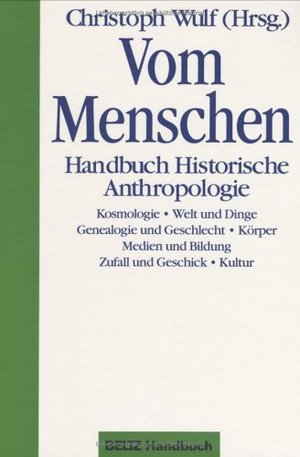 Wie zentral Kultur für die Stadt ist, zeigt auch die früheste Stadtliteratur des Zweistromlandes.
Wie zentral Kultur für die Stadt ist, zeigt auch die früheste Stadtliteratur des Zweistromlandes. Wenn ein Fokus des Lebens in der Stadt die Erfahrung und der Umgang mit Fremdheit ist, so können Religionen in diesem Kontext ganz unterschiedliche Rollen und Funktionen übernehmen: Sie können zur Gastfreundschaft, zur Integration und zum Engagement für das Gemeinwesen anregen, sie können aber auch zu Rückzugstendenzen und zur Bildung von Parallelgesellschaften beitragen. Das gilt im Übrigen auch für das Christentum. Auch dort trifft man fromme Gruppen, die sich im Gemeinwesen nach dem Motto einrichten: „Mag die Welt auch noch so brausen, wir wollen hier im Stillen hausen.“ Aber das ist nicht die Grundlinie des deutschen Protestantismus. Im Gegenteil. Er hat immer die Weltverantwortung des Christentums betont. Engagement im Gemeinwesen ist darum Pflicht und Neigung. Allerdings war dieses Thema eine Zeit lang in den Hintergrund getreten und wird gegenwärtig gerade wieder neu entdeckt.
Wenn ein Fokus des Lebens in der Stadt die Erfahrung und der Umgang mit Fremdheit ist, so können Religionen in diesem Kontext ganz unterschiedliche Rollen und Funktionen übernehmen: Sie können zur Gastfreundschaft, zur Integration und zum Engagement für das Gemeinwesen anregen, sie können aber auch zu Rückzugstendenzen und zur Bildung von Parallelgesellschaften beitragen. Das gilt im Übrigen auch für das Christentum. Auch dort trifft man fromme Gruppen, die sich im Gemeinwesen nach dem Motto einrichten: „Mag die Welt auch noch so brausen, wir wollen hier im Stillen hausen.“ Aber das ist nicht die Grundlinie des deutschen Protestantismus. Im Gegenteil. Er hat immer die Weltverantwortung des Christentums betont. Engagement im Gemeinwesen ist darum Pflicht und Neigung. Allerdings war dieses Thema eine Zeit lang in den Hintergrund getreten und wird gegenwärtig gerade wieder neu entdeckt. „Das Bezeugen des prophetischen Amtes Jesu Christi ist aber grundsätzlich dialogisch angelegt und richtet seinen Fokus auf die Frage nach einer Stadtkultur, die Gerechtigkeit und Beteiligung als gemeinsame Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger für eine Stadt versteht. Zu den wichtigen Formen gehört deshalb neben der Bildungsarbeit der diakonisch anwaltschaftliche Einsatz für die Menschen in der Stadt. Ob der Arme oder der Fremde, das wohlstandsverwahrloste Kind oder die um ihre Rechte betrogene Frau vor Augen tritt, das prophetische Amt Jesu Christi verpflichtet die Kirche, die Stimme zu erheben und gegen menschenunwürdige Zustände einzutreten. Dabei lebt diese Aufgabe nicht von der Vollständigkeit und Umfänglichkeit ihres Tuns, sondern von ihrer exemplarischen Rolle. Die Kirche in der Stadt muss nicht jeden Missstand selbst überwinden können, um die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger zur Überwindung des Missstandes aufzurufen. Das prophetische Amt kann exemplarisch und situativ bezeugt werden, steht aber an dieser Stelle in einer besonderen Verbindung zum diakonischen Handeln der Kirche. Die städtische Spaltung in arm und reich kann von der Kirche nur exemplarisch bearbeitet werden. Aber die Kirche muss das Gemeinwesen fortwährend an einen gerechten Ausgleich erinnern.“
„Das Bezeugen des prophetischen Amtes Jesu Christi ist aber grundsätzlich dialogisch angelegt und richtet seinen Fokus auf die Frage nach einer Stadtkultur, die Gerechtigkeit und Beteiligung als gemeinsame Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger für eine Stadt versteht. Zu den wichtigen Formen gehört deshalb neben der Bildungsarbeit der diakonisch anwaltschaftliche Einsatz für die Menschen in der Stadt. Ob der Arme oder der Fremde, das wohlstandsverwahrloste Kind oder die um ihre Rechte betrogene Frau vor Augen tritt, das prophetische Amt Jesu Christi verpflichtet die Kirche, die Stimme zu erheben und gegen menschenunwürdige Zustände einzutreten. Dabei lebt diese Aufgabe nicht von der Vollständigkeit und Umfänglichkeit ihres Tuns, sondern von ihrer exemplarischen Rolle. Die Kirche in der Stadt muss nicht jeden Missstand selbst überwinden können, um die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger zur Überwindung des Missstandes aufzurufen. Das prophetische Amt kann exemplarisch und situativ bezeugt werden, steht aber an dieser Stelle in einer besonderen Verbindung zum diakonischen Handeln der Kirche. Die städtische Spaltung in arm und reich kann von der Kirche nur exemplarisch bearbeitet werden. Aber die Kirche muss das Gemeinwesen fortwährend an einen gerechten Ausgleich erinnern.“