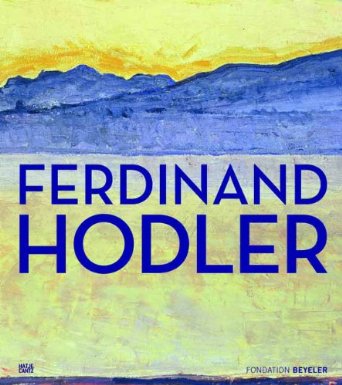White Cube |
Was nicht mehr gedeutet werden kannZum Spätwerk des Schweizer Malers Ferdinand HodlerWolfgang Vögele 1.
Dem Schweizer Maler Ferdinand Hodler (1853-1918) müssen solche Szenen des Totengebets vertraut gewesen sein, denn er verlor früh seine Mutter und alle seine Geschwister durch die Tuberkulose. Und gegen Ende seines Malerlebens sollte er Krankheit, Sterben und Tod seiner Geliebten Valentine Godé-Darel in einer Reihe von Zeichnungen und Bildern festhalten. Das Bild von der „Andacht“ verweist auf Religion, Ewigkeit und Unendlichkeit, aber mit einer Deutlichkeit, die sich im Spätwerk des Malers nicht mehr finden wird. Gefaltete Hände, gesenkte Köpfe und geschlossene Augen verweisen auf die Anwesenheit Gottes, an den sich die im Gebet gemurmelten Worte voller Ehrfurcht richten. Holders späte Bilder zeugen von einem Prozess der Reduktion und Konzentration. Sie zeigen die Anstrengungen eines Malers, der sich einer fragenden, suchenden Religion verschrieben hat und sich allen konkreten Antwortversuchen verweigert. Sie überwinden die Alternative von symbolistischer und realistischer Malerei. 2.Die Fondation Beyeler stellte gerade in Riehen in der Nähe von Basel an der deutsch-schweizer Grenze dieses Spätwerk Hodlers[1] aus und sorgte mit dieser konzentrierten, kompakten Ausstellung dafür, dass eine Reihe von Vorurteilen, die über den Schweizer Maler im Umlauf sind, gründlich widerlegt werden.
3.Es ist auffällig, dass sich Hodler in seinen letzten Jahren auf wenige malerische Genres konzentriert: Selbstporträts, Berg- und Seelandschaften, das Sterben seiner Geliebten und schließlich das monumentale Werk „Blick in die Unendlichkeit“, welches zusammen mit einer Reihe von Vorstudien im letzten Saal die Ausstellung beschließt. Wieso malt ein Künstler wie Hodler bevorzugt Selbstporträts? Die Bilder zeigen einen dick- und querschädeligen Mann in den Fünfzigern und Sechzigern, den Vollbart manchmal wild wuchernd, manchmal akkurat getrimmt, einen Blick, der in vielen Porträts stechend und abweisend wirkt, so gar nicht passend zu Anzugjacke, Krawatte und Stehkragenhemd. Die Bilder haben allesamt etwas Abweisendes, Befremdendes, eine Doppeldeutigkeit: auf der einen Seite der Maler, der sich zu sich selbst und seinen Lebensthemen hindurchgekämpft hat, auf der anderen Seite der bekannte Künstler, dem die Aufmerksamkeit der Gesellschaft und das Lob der Kunstkritiker nicht gleichgültig sind. Die strengen, energischen Stirnfalten, die auf vielen der Selbstporträts ins Auge fallen, verraten den Grübler, den Menschen, der angesichts vieler Erfahrungen von Tod und Sterben zu verbittern droht, den unablässigen Fragensteller. Die Geheimratsecken, die immer größer werden, zeigen den Alterungsprozess. Und die Abfolge der Bilder bewegt sich vom Interesse an sehr realistischen Porträts, auf denen ganz detailliert jedes einzelne Barthaar unterschieden werden kann, zu Porträts, auf denen Pinselstriche, Farbgebung, eben das Malerische wichtiger sind als das dargestellte Gesicht.[2] Offensichtlich verändert sich Hodlers Interesse von der Darstellung zur Malerei. Und ihn scheinen die kleinen, im Alltag kaum wahrnehmbaren Veränderungsprozesse der Lebensgeschichte beschäftigt zu haben, wie sie am (eigenen) Gesicht deutlich werden. Das eigene Leben fixiert er nicht in einem, dem einzig gültigen exemplarischen Porträt. Statt wieder-holt er sich, malt sein Gesicht immer wieder neu und bringt so den Prozess des Alterns zum Vorschein, und darüber hinaus Vorgänge der Verbitterung, des Grübelns, des Meditierens über Fragen nach Lebenssinn, vielleicht auch der Abwehr von Gesellschaft und Welt. Hodlers Porträts zeigen Selbstbildnisse als einen Prozess der Selbsterkenntnis. Aber die Selbsterkenntnis ist in diesem Fall keine vorrangig philosophische oder psychologische, sondern je länger Hodler sich dem Thema des Selbstporträts stellt, desto deutlicher werden die Bilder als Malerei sichtbar, die eben nicht mehr nur Mittel zum Zweck der Darstellung einer Person ist. 4.Ähnliches lässt sich an den Landschaftsbildern Hodlers ablesen. Sie zeigen Gebirgsbäche, Alpengipfel, Seen – meistens menschenleer und auch ohne Gebäude, ohne jedes Zeichen von Zivilisation.
Hodler sprach davon, er wolle „planetarische Landschaften“ malen. Bei einem Spaziergang fragte er einen Bewunderer: „Sehen Sie wie da drüben alles in Linien und Raum aufgeht? Ist Ihnen nicht, als ob Sie am Rand der Erde stünden und frei mit dem All verkehrten?“[3] Das Wort von den planetarischen Landschaften ist dunkel und vieldeutig. Aber das im Gespräch von Hodler geäußerte Stichwort vom „All“, dem Kosmos, lässt etwas von jener „Unendlichkeit“ ahnen, auf die in der Riehener Ausstellung alles hinausläuft. Unendlichkeit ist ein Begriff schwacher, zurückhaltender Transzendenz. Was Hodler da malt, sind keine gefälligen Schweizer Bergpanoramen, die tausendfach reproduziert und fotografiert wurden und längst in ihrer billigen Mischung aus Kitsch und Tourismus entlarvt sind. Hodler hatte sich einer Kunsttheorie verschrieben, die er Parallelismus nannte. Diese Theorie wurde oft belächelt, und sie machte seine Gebirgs- und Seelandschaften in ihrer konsequent horizontalen, an parallelen Linien orientierten Anordnung leicht wieder erkennbar. Und dennoch liegt gerade in dieser Parallelität ein Moment von Unendlichkeit, das auf das Stichwort des Planetarischen, des Inkommensurablen von Natur und Landschaft zurückweist. Die (Gebirgs-)Landschaft wird zur Frage nach der Unendlichkeit, weil in ihr etwas Offenes, Unabgeschlossenes zum Ausdruck kommt – so wie in den Parallelen, die sich auch in der Unendlichkeit nicht schneiden werden. Es ist ein Verdienst der Riehener Ausstellung, dass sie Landschaftsbilder in ihrer Serienhaftigkeit zeigt. Hodler achtete, wie bei seinen Selbstporträts, auf kleinste Veränderungen des Lichtfalls, der Spiegelungen auf dem Wasser, der Wolkenkonstellationen. Wer immer wieder dieselbe Landschaft und dasselbe Gesicht malt, stellt die Frage nach Wechsel, Wandel und Veränderung im (individuellen) Leben und auf der Erde, also malerisch und geographisch in der Landschaft. Und auch in den Landschaftsbildern ist derselbe Prozess zu bemerken wie bei den Porträts: Hodlers Interesse wendet sich von (foto-)realistischer Darstellung ab hin zu Form, Farbe, Pinselauftrag. Malerei ist wichtiger als Darstellung. Damit lässt sich in den Landschaften etwas erkennen, was ich als Abwendung vom Symbolismus kennzeichnen würde: Mit den Landschaftsbildern stellt Hodler sozusagen die Frage nach einer neuen – in theologischer, vielleicht zu starker Sprache formuliert – Schöpfungsfrömmigkeit, mit einer Beimischung von Pantheismus. Er stellt die Frage nach dem Sinn des „Planeten“, ohne darauf eine Antwort zu geben und wahrscheinlich auch ohne eine Antwort zu wissen. Die Landschaftsbilder geraten Hodler konzentriert und symbolisch, ohne simpel und symbolistisch zu sein. Sie verweisen auf etwas, das außerhalb ihrer selbst liegt, aber dieser Verweis wird weder platt in den Vordergrund gerückt noch in seiner Zurückhaltung aufgeklärt. Er ist nichts als – vorhanden. In diesem Sinne bleiben Hodlers Landschaften, wenn man es in religiöser Sprache ausdrücken will, mystisch. Ihnen haftet etwas Schwebendes, nicht in Sprache und Begriffe Aufzulösendes an, das etwas anderes ist als Symbolismus mit seiner Doppelwelt von Zeichen und Referent. Aus Hodlers Landschaftsbildern spricht eine Sehnsucht nach dem Umfassenden, nach dem mysterium fascinosum et tremendum, ohne dass dieses Geheimnis mit einer bestimmten Religion identifiziert würde. Der (religiösen) Sehnsucht entspricht auf der anderen Seite eine Scheu, das Religiöse, Unendliche, über die irdische Wirklichkeit Hinausgreifende auch zum Thema der Reflexion wie der Malerei zu machen. Gegen Ende seines Lebens, als Hodler aus Krankheitsgründen Wohnung und Atelier nicht mehr verlassen konnte, konzentrierte er sich in seinen Bild auf das Panorama, das ihm aus dem Fenster des Ateliers heraus vor Augen lag: den Genfer See, seine Ufer, die Berge und Bergketten dahinter. Diese Bilderserie zählen zu den berührendsten der ganzen Ausstellung, gerade in ihrer Einfachheit und Serialität, die den Blick auf die Veränderung von Nuancen und Details lenkt. 5.
Besonders deutlich wird das am Bild, das die tote Valentine in ihrem Sterbebett zeigt. Zum einen zeigen sich dieselben horizontalen Parallelen wie auf den Berglandschaften. Und das Totenbild erinnert an in Basel hängende Altarbild (Predella) von Hans Holbein, den Leichnam Christi im Grabe aus den Jahren 1521-22. Abgesehen davon, dass dieses Bild eine erhebliche kulturelle Wirkungsgeschichte besitzt, vom Schriftsteller Dostojewski bis zum Opernregisseur Herbert Wernicke, auch Hodler hat dieses Bild bei einem Besuch in Basel im Jahr 1875 gesehen und war davon tief erschüttert. Holbeins Altartafel zeigt den toten Jesus mit seinen Verletzungen und Wundmalen, der bis zum Tod am Kreuz gelitten hat. Die parallele Darstellung Valentines nähert ihr langwährendes, durch eine Krebskrankheit bedingtes Leiden an das Leiden Christi an. Holbeins Bild erschütterte spätere Betrachter deshalb, weil sie in ihm das Sterben als einen abgeschlossenen Akt, ohne jede Hoffnung auf Auferstehung oder ein wie auch immer geartetes Weiterleben nach dem Tode dargestellt sahen. Auch bei Hodler ist durch den Parallelismus zu Holbeins Bild die Drastik, Körperlichkeit und Endgültigkeit des Todes in seiner Grausamkeit und Unfaßbarkeit in den Mittelpunkt gestellt. Die Tote liegt allein, einsam und isoliert da. Niemand scheint ihr die Totenwache zu halten. Und das Totenbild Hodlers verweigert sich in seiner gleichsam materialistischen Darstellung des Todes jedem Symbolismus. Gar nichts verweist auf die christliche Auferstehungshoffnung. Und dennoch kann man auch für dieses Bild sagen, dass die Drastik der Todesdarstellung auch die Frage nach dem Jenseits des Tod, die Frage nach Trost und Erbarmen weckt, ohne dass damit bestimmte religiöse Option, schon gar keine christliche, ins thematische Spielfeld des Bildes käme. Das war bei Hans Holbein selbstverständlich noch anders. Auch hier zeigt sich: Hodler malt und zeichnet nicht einfach symbolisch. Die Bilder sind nicht Schatten irgendeiner intellektuellen oder ästhetisch zu ermittelnden Über-Welt von Werten oder gar einer systematischen Metaphysik oder Religion. Dennoch markieren sie die Leerstellen, die sich nach dem Plausibilitätsverlust von Metaphysik und Religion im 19.Jahrhundert ergeben haben. Auch die Bilder der sterbenden und toten Valentine lassen sich als Fragen nach dem Jenseits des Wirklichen verstehen. 6.Diese Frage- und Denkbewegung läßt sich auch am letzten und größten der ausgestellten Bilder Hodlers nachvollziehen. Das monumentale Werk „Der Blick in die Unendlichkeit“ (1913-1916) präsentieren die Kuratoren zusammen mit einer Reihe von Vorstudien und Skizzen im letzten Saal der Ausstellung. Das Bild verblüfft zunächst durch sein riesiges Format. Gegenüber dem wandfüllenden Großformat hängt eine kleinere Version desselben Bildes, die Hodler in seinem Atelier behalten hatte. Das Bild zeigt fünf Frauen in langen blauen Trägerkleidern. Sie stehen nebeneinander. Alle haben sie die nackten Arme leicht zur Seite gespreizt. Die Hände sind zu Gesten gekrümmt, die sich nicht deuten lassen. Der Kopf ist jeweils zur rechten Seite geneigt. Hier ist die horizontale Parallelität ins Vertikale umgeschlagen.
So gleichmäßig wie die Frauen nebeneinander stehen, scheinen sie zu tanzen oder zu schreiten. Vielleicht befinden sie sich in Trance. Unter den enganliegenden Kleidern werden die Silhouetten von Bauch, Hüfte und Beinen sichtbar. Der Hintergrund ist ein milder Hellbraun- bis Gelbton, vielleicht eine Wüste, aber der Betrachter erhält vom Maler keine weiteren Anhaltspunkte. Alle Aufmerksamkeit ist auf die fünf tanzenden Frauen gelenkt. Alle stehen sie parallel und aufrecht, unterscheiden sich nur in ihren Gesten, in Kopfhaltung und Körperspannung. Man könnte auch meinen, sie seien betrunken, aber dafür ist zu viel Parallelität und Gleichklang in ihren Bewegungen. Sie haben sich abgestimmt. Sie beten. Meditieren. Vollziehen ein unbekanntes religiöses Ritual. Handelt es sich um Priesterinnen, Vestalinnen, Klageweiber, Nymphen? Deutlich ist der Versuch der Frauen, sich aus der Welt der Endlichkeit zu befreien und dorthin einen Blick zu werfen, wo mehr als Berge, Gebirgsbäche und Seen zu sehen ist. Die Frauen versuchen sich an einem Blick in die Unendlichkeit. Der Titel des Bildes ist das Äußerste, was sich Hodler an Metaphysik oder Spiritualität gestattet. Dieser Blick in die Unendlichkeit folgt keiner Religion oder Weltanschauung. Der Blick reduziert sich auf das bloße Faktum, er verbindet sich mit keinem –Ismus; er ist Ausdruck einer spirituellen Sehnsucht, bei der sich der Maler jeder Konkretisierung dieser Sehnsucht verweigert. Nirgendwo in dem Bild wird deutlich, ob die fünf Priesterinnen wirklich die Unendlichkeit sehen. Die Unendlichkeit wird einzig in den Frauen sichtbar, in ihrer Symmetrie, ihrer Parallelität, ihrem Tanzen und ihrem Rhythmus. Vergleicht man nun dieses großformatige Bild mit dem frühen Andachtsbild, das ich am Anfang erwähnt habe, so zeigt sich, wie weit sich Hodler von Symbolismus und Realismus verabschiedet hat. Wie die Landschafts- und Sterbensbilder atmet auch dieses Bild, das am ehesten als ein Bild des Symbolismus verstanden werden kann, eine bestimmte Sehnsucht. Aber diese Sehnsucht drückt sich nur in Gesten, Gesichtsausdrücken und Körperhaltungen aus. Selten habe ich eine solche im emphatischen Sinn des Wortes sprach-lose und allen Deutungen widerspenstige Malerei gesehen wie bei Hodler.
7.In seinen späten Jahren, als er bereits von seiner Lungenkrankheit gezeichnet war, malte Hodler nicht weniger als früher, wohl aber nur ganz wenige Motive, die er immer wieder variierte. Damit legt er seinen Betrachtern wie von selbst den Vergleich der Bilder nahe, zwischen den verschiedenen Selbstporträts, den Sterbebildern Valentines, den Gebirgs- und Seelandschaften. Der späte Hodler war ein Maler von Serien – wie der Monet der Seerosenbilder oder wie der Cézanne des Montagne Ste. Victoire. In seinen späten Bildern war Hodler kein Symbolist mehr, schon gar nicht im platten, naiven Sinn dieses Wortes. Und trotzdem haben seine Bilder etwas Symbolisches. Hodler war als Maler ein Metaphysiker ohne jenseitige Wirklichkeit, er malte Transzendenz ohne Referenzpunkt. Er war ein Maler der Konzentration, der Verdichtung. Er war ein Realist mit Sehnsucht nach dem Planetarischen und Unendlichen. Ausstellungskatalog: Anmerkungen |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/83/wv03.htm
|
 Auf Ferdinand Hodlers Bild „Die Andacht“ aus dem Jahr 1882 ist eine Gruppe ins Gebet versunkener Menschen zu sehen. Links im Vordergrund hat ein vollbärtiger Mann in einer schwarzen Kutte, vielleicht ein Mönch oder ein Pfarrer, die Hände fest zum Gebet gefaltet, so verbissen, dass Knöchel der Hand hervortreten. Die Familie mit vielen Töchtern, die um ihn herum stehen, tun es ihm nach, viele mit geschlossenen Augen, mindestens aber mit gesenktem Blick. Vielleicht besucht der Mönch eine größere Familie, vielleicht ist gerade die Großmutter oder der Großvater gestorben, und nun sprechen Pfarrer und Familie gemeinsam nach Sterben und Tod ein Vaterunser und einen Psalm.
Auf Ferdinand Hodlers Bild „Die Andacht“ aus dem Jahr 1882 ist eine Gruppe ins Gebet versunkener Menschen zu sehen. Links im Vordergrund hat ein vollbärtiger Mann in einer schwarzen Kutte, vielleicht ein Mönch oder ein Pfarrer, die Hände fest zum Gebet gefaltet, so verbissen, dass Knöchel der Hand hervortreten. Die Familie mit vielen Töchtern, die um ihn herum stehen, tun es ihm nach, viele mit geschlossenen Augen, mindestens aber mit gesenktem Blick. Vielleicht besucht der Mönch eine größere Familie, vielleicht ist gerade die Großmutter oder der Großvater gestorben, und nun sprechen Pfarrer und Familie gemeinsam nach Sterben und Tod ein Vaterunser und einen Psalm. Hodler gilt zum einen als Schweizer Nationalmaler, der es bis auf die
Hodler gilt zum einen als Schweizer Nationalmaler, der es bis auf die 
 Die (malende) Frage nach der Veränderung von Individuum und Landschaft hat Hodler weiter entwickelt und ergründet in der Frage nach Sterben und Tod. Hodler hat bei seiner Geliebten
Die (malende) Frage nach der Veränderung von Individuum und Landschaft hat Hodler weiter entwickelt und ergründet in der Frage nach Sterben und Tod. Hodler hat bei seiner Geliebten 

 Im übrigen: Hodler hat auch einmal fünf Männer gemalt, die „
Im übrigen: Hodler hat auch einmal fünf Männer gemalt, die „