
Kultur |
Den Vater durchs Leben tragenÜber Väter und das Vater-Buch von Botho StraußWolfgang Vögele 1. Übertragung
Christopherus spricht den Knaben an und beklagt sich, dass er so schwer an ihm tragen musste. Der Junge hat sich selbst und den Fährmann in Gefahr gebracht. Aber der Junge sagt: Christopherus, das ist gar nicht verwunderlich, denn du hast nicht nur die Welt auf deinen Schultern getragen, sondern auch den, der die Welt erschaffen hat. Denn ich bin Christus, dein König. Und damit du erkennst, dass ich die Wahrheit sage, nimm deinen Stab und stecke ihn am anderen Ufer neben deine Hütte. Am nächsten Tag wird er blühen und Frucht tragen. Beide verabschieden sich und Christopherus führt aus, was ihm der Knabe gesagt hatte. Am nächsten Morgen steht neben seiner Hütte eine Palme. Christopherus ist ein sprechender Name und bedeutet: der, der Christus trägt. Durch diese Legende stieg der Fährmann zum verehrten Heiligen der Reisenden, der Fahrenden und der Touristen auf. Wer zu Zeiten, als das Reisen noch gefährlicher war, einen längeren Weg begann, bat vorher um seinen Schutz. Die Legende vom Fährmann, der ohne es zu wissen, Christus getragen hat, wirkte über den Bereich katholischer Heiligenfrömmigkeit hinaus.
Der Karlsruher Philosoph Peter Sloterdijk, der wie mein Vater keine großen Sympathien für Christentum und Kirche hegt, schrieb in seinen Notizheften einmal, auf Christopherus anspielend: "Besser Christus einmal über den Fluss tragen als den Vater durchs ganze Leben."[1] Nun sind die meisten Menschen mit Gepäck belastet, an dem sie schwer zu tragen haben, angefangen beim körperlichen Übergewicht. Dazu komm Wissensballast, seelische Belastungen, die einem Menschen das Leben schwer, sodass sie ihr Päckchen zu tragen haben. Je älter ein Mensch wird, desto mehr Erinnerungen aus seiner Lebensgeschichte trägt er mit sich herum. Dieses biographische Päckchen nimmt an Gewicht zu und macht das Laufen, Waten, Gehen zunehmend schwerer. Erfahrungen mit Vater, Mutter, Geschwister, Verwandten gehören von Anfang an zu diesem Päckchen dazu. Das Päckchen kann sich zur Last und Qual auswachsen, doch manchmal befreien die familiären Erfahrungen auch und erleichtern die Last. Ich will mich in diesem Essay auf den Vater konzentrieren. Er gehört von Anfang an prägend und bestimmend zu dem, was Söhne und Töchter an Lebensgeschichte mit sich tragen. Christopherus weiß nicht, dass er das Jesuskind, das die Sünde der Menschen auf seinen Rücken, auf sein Joch (Mt 11,29) nahm, durch den Fluss trägt. Er spürt die Schwere der Last. In der Gefahr der Stromschnellen weiß er gar nicht, wen er trägt. Das Motiv des Unbekannten wird noch weitere Bedeutung gewinnen. Sloterdijks Bemerkung prägt die Einsicht, dass jeder Mensch ein schwereres oder leichteres Päckchen durch den Fluss des Lebens trägt. Das Päckchen ist auf den Rücken geschnallt. Die Träger können nicht sehen, was sie da tragen. Es mutet erstaunlich an, dass Sloterdijk, der Agnostiker, es vorziehen würde, Christus an Stelle des eigenen Vaters zu tragen.[2] Denn ein Vater kann die Lebensgeschichte seiner Söhne und Töchter in eklatanter Weise belasten und so dem Lebensweg quasi magnetisch eine völlig andere Richtung geben. Wer sich nicht von den überkommenen Vorlasten der Familiengeschichte befreit, wird im Fluss des Lebens untergehen. Sloterdijk schweift in der Folge seiner Notizen schnell ab zum adoptierten Vater, der als weiser Lehrer, als Meister, als Ratgeber an die Stelle des biologischen Vaters tritt[3]. Der Sohn kann sich seinen biologischen Vater nicht auswählen. Wenn der Sohn aber zum Schüler wird, dann kann er sich den Lehrer und Meister auswählen, der lehrend und beratend durchs Leben helfen soll. Es geht also um die psychologischen Lasten des Lebens, die durch den Vater auf die Kinder überkommen. Es geht um Herkunft. Es geht darum, das Gewicht dieser Lasten zu erkennen und zu erleichtern - oder Muskelkräfte zu entwickeln, die helfen, selbst bei schweren Lasten nicht in die Knie zu gehen. Es geht um psychologische Logistik. 2. Erwachsene KinderChristopherus wusste, welche Aufgabe ihm zugeteilt war. Er brachte an einer Furt Reisende über den Fluss. Er besaß offensichtlich die nötigen Kräfte, Menschen auf seinem Rücken zu tragen. Andere Menschen wissen gar nicht, dass sie eine Last tragen und dass diese Last ihnen das Leben schwer macht. Das muss nicht unbedingt der eigene Vater sein. Aber Vater und Mutter haben sozusagen die erste Chance, für die Kinder zur Last zu werden. Beide helfen ihren Kindern, eine pädagogische Bahn ins Leben hinein zu finden. Sie nehmen ihre Kinder sozusagen an der Hand, bis sie groß genug sind, um selbst zu laufen und eigenständig durchs Leben zu gehen. Bleibt man im Bild des Christopherus, so haben sie einen Rucksack mit lebensnotwendigen Dingen dabei, der ihnen das Leben erleichtert. Im schlechteren Fall geraten Erziehung und Bildung durch die Eltern zu einer Belastung, die das Leben der Kinder erschwert. Bei den meisten Menschen werden sich wohl Anteile des Erleichternden wie des Erschwerenden im Rucksack befinden. Im Laufe des Lebens, mit Heranwachsen und Erwachsensein wechselt die Rolle von Eltern und Kindern. Erwachsen ist, wer allein durchs Leben gehen kann und die helfende und schützende Hand der Eltern nicht mehr benötigt. Der amerikanische Philosoph Robert Nozick hat das mit folgenden Worten ausgedrückt: "Erwachsen zu sein ist eine Existenzweise, in der man kein Kind mehr ist, und daher eine Art und Weise, sich zu seinen Eltern zu verhalten, bei der man ihnen nicht nur Vater oder Mutter wird, sondern es auch nicht mehr nötig hat oder erwartet, dass sie als die eigenen Eltern auftreten; und dazu gehört auch, dass man nicht mehr erwartet, die Welt möge ein symbolischer Vertreter der Eltern sein. Wenn man jetzt versucht, etwas von der Welt zu erhalten, das symbolisch die angemessene Liebe unserer Eltern darstellt, so ist das eine unerfüllbare Aufgabe. Möglich ist, einen Ersatz für diese Liebe zu finden, etwas anderes, das für uns, die wir jetzt erwachsen sind, einige derselben oder analoge Funktionen erfüllt."[4] Für Nozick liegt die Befreiung des Erwachsenseins gerade darin, dass die erwachsenen Söhne und Töchter, es nicht mehr nötig haben, die schützende Hand ihrer Eltern zu ergreifen. Sie versuchen, ihre Probleme selbst zu lösen statt sich dafür stets an Vater und Mutter zu wenden. Es gehört zu den Vertracktheiten der Eltern-Kind-Beziehung, dass manche Eltern allzu gerne bereit sind, stellvertretend für Kinder deren Probleme zu lösen. An der Oberfläche ist dann beiden gedient, in der psychologischen Tiefe behindern sich Eltern und Kinder gegenseitig. Am Anfang des Lebens ist das ja auch nötig: Kinder benötigen einen Schutzraum, um langsam und nachhaltig all die Fähigkeiten erwerben zu können, die helfen, das Erwachsenenleben zu bestehen. So weit, so gut. Aber spätestens dann, wenn die Kinder erwachsen sind, muss diese Hilfe zum Stillstand kommen. Das bedeutet nicht, dass die Beziehung der Kinder zu ihren Eltern endet, aber sie verwandelt und erhält eine neue, psychologisch auszuhandelnde Gestalt. Wer sich als erwachsener Mensch noch wie ein Sohn verhält, der empfindet die Eltern im übrigen nicht als Last, der führt sein Leben weiterhin so, als würde er geschützt von seinen Eltern begleitet. In diesem Falle belasten nicht die Eltern ihre Töchter und Söhne, sondern umgekehrt belasten die Töchter und Söhne ihre Eltern, weil sie einen Schutz in Anspruch nehmen, dem sie längst entwachsen sein sollten. Nozick rät den Söhnen und Töchtern, die das nicht richtig schaffen, selbst Eltern zu werden. Denn indem sie anfangen, ihre eigenen Kinder zu schützen und auf dem Weg ins Erwachsenenleben zu begleiten, befreien sie sich gleichzeitig von den eigenen Eltern, die als Großeltern eine neue Rolle finden. Die familiär-psychologische Balance bleibt also in doppelter Hinsicht prekär: Manche Väter und Mütter wollen ihre Söhne und Töchter nicht loslassen. Sie wollen unter allen Umständen Eltern bleiben, weil sie ihre machtvolle Rolle als Ratgeber und Beschützer nicht aufgeben wollen. Und manche Söhne und Töchter wollen ihre Eltern nicht loslassen, weil es in der Sohn- und Tochterrolle einfacher ist, beschützt und verantwortungs-los (im eigentlichen Sinne des Wortes) durchs Leben zu streunen. Psychologisch ist ein großer familiärer Verwandlungsprozess im Gange, ein Verschieben von Lasten, das leicht aus dem Gleichgewicht geraten kann. 3. Kampf mit dem unbekannten VaterSigmund Freud sah diesen familiären Verwandlungsprozess nicht so harmonisch und freundlich. Mit dem Bild von der Urhorde und dem Ödipusmythos macht er Väter und Söhne zu Konkurrenten und Rivalen. In der Urhorde[5] herrscht ein prekäres Kräftegleichgewicht, das von roher Gewalt, Stärken und Schwächen bestimmt wird. Die heranwachsenden Söhne lauern nur auf ihre Chance, selbst an die Spitzenposition des Patriarchen zu treten. Dafür müssen sie sich gegen ihre Konkurrenten und gegen den Patriarchen selbst durchsetzen. Die Urhorde lebte in einer feindlichen Umgebung, in der die knappen Ressourcen nur schwer zu erlangen sind. Der Platz des regierenden Patriarchen bleibt so lange unumstritten, wie er die Konkurrenten, und das sind seine Söhne, noch in Schach halten kann. Der leitende Patriarch hat zwar ein Interesse an starken und mächtigen Söhnen, aber so stark, dass sie seine eigene Machtposition gefährden, sollen sie nicht werden. Deswegen leitet er Machtkonflikte und Aggressionen mit Vorliebe auf Konkurrenzen zwischen den Söhnen ab. Sie verschleißen sich im Kampf gegeneinander, während die wahre Macht des Patriarchen unangetastet bleibt. Resigniert müssen die nachkommenden Söhne schließlich abwandern und anderswo versuchen, eigene Horden zu gründen. Dieses Bild des Vater-Sohn-Konflikts wirkt sehr viel dramatischer, brutaler und gefährlicher als das was Mit dieser Darstellung bildet Freud als gefährlichen Kampf ab, was Nozick Jahrzehnte nach Freud als einen hoffentlich gelingenden langen und nachhaltigen Bildungsprozess begreifen sollte. Der von Freud ebenfalls aufgenommene antike Mythos von Ödipus weist in manchem erstaunliche Ähnlichkeiten zur Christopheruslegende auf. Christopherus weiß nicht, wen er über den Fluss getragen hat. Ödipus ahnt nicht, wen er da im Streit geschlagen hat. Beide werden über ihre Unwissenheit aufgeklärt.
Bekanntlich setzen die königlichen Eltern Ödipus aus, weil ihnen vorhergesagt wurde, dass Ödipus seine Mutter heiraten und seinen Vater ermorden würde. Der von den Eltern beauftragte Hirte kann sich aus Mitleid nicht überwinden, den Knaben zu töten und zieht ihn bei sich auf. Das Orakel von Delphi bestätigt Ödipus die Vorhersagen an die Eltern. Deswegen flieht er, denn er hat ja keineswegs vor, die Eltern umzubringen. Bei einem Handgemenge mit anderen Reisenden tötet er dann nichtsahnend seinen Vater. Weil er Theben von der Sphinx befreit, erhält er unwissend seine eigene Mutter, Iokaste zur Frau. Sie gebiert ihm Zwillinge. Als Ödipus begreift, was er getan und angerichtet hat, blendet er sich selbst. Ödipus wird zum Meisterbeispiel des Sohnes, der aus seiner Familiengeschichte heraus nichtsahnend Gewalt erzeugt, ohne das zu wollen. Freuds Familienkonstellation, die er mit Hilfe des Ödipus-Mythos beschreibt, ist nicht durch Liebe und Geborgenheit geprägt, sondern durch Konflikte. Mit Hilfe des Motivs von der Urhorde und dem Ödipusmythos gibt er diesen Konflikten eine erzählerische Gestalt. Patienten, die daraus Symptome entwickeln, können diese Konflikte durch die Sitzungen auf der psychoanalytischen Couch erinnern, bearbeiten und schließlich wieder vergessen. Für Freud ist das Erwachsenwerden nicht der schöne und angenehme Tausch zwischen Kind- und Elternrolle, wie ihn sich Nozick idealerweise vorstellt, er sieht stattdessen zwischen Eltern und Kind, besonders zwischen Vater und Sohn Konflikte auf Leben und Tod, die sich tragischerweise selbst dann noch auswirken, wenn Eltern wie Kinder versuchen, diesen Konflikten bzw. ihren tödlichen Folgen aus dem Weg zu gehen. Aus dem Ödipusmythos ist herauszulesen: Wer den Vater eben nicht psychologisch umbringen kann oder will, der bringt einen anderen um. Von dieser anderen Person wird sich dann herausstellen, dass es doch der (eigene) Vater war. Man kann in der Zwanghaftigkeit des erzählten Geschehens eine Form von Tragik, wenn nicht sogar eine theologische Dimension erblicken. Diesen letzten Schritt wäre Freud nicht mitgegangen, aber er hätte von der psychologischen Notwendigkeit bestimmter Konfliktlösungen auf dem Weg des Erwachsenwerdens gesprochen. Freud hielt diesen konflikthaften Weg des Erwachsenwerdens für offen, er sah darin einen gangbaren Weg, mit oder ohne Sitzungen auf der Couch. Söhne und Töchter müssen nicht die Kinder ihrer Eltern bleiben. Wenn sie die ödipalen Konflikte bestanden haben, spricht nichts dagegen, dass sie erwachsen werden. 4. Furcht vor dem Vater
Gegen den übermächtigen Vater vermag der Sohn nichts auszurichten, er zieht sich zusammen in einen Zustand der Furcht, die so stark wird, dass sie am Ende nicht mehr nur das familiäre Verhältnis zum Vater, sondern das Verhältnis zur Welt überhaupt bestimmt. Damit ist Nozicks These vom Erwachsenwerden als langwährender, aber insgesamt zwangloser Rollenwechsel vom Kind zum Vater von vornherein unmöglich geworden. Es ist nicht zu sehen, wie die übergroße Furcht vor dem Vater aufzulösen wäre. Die Furcht entlädt sich in dem sehr langen Brief, den Kafka weder seinem Vater gezeigt noch publiziert hat. Aus der Furcht vor dem Vater wird die Furcht vor dem Gesetz, die Furcht vor dem Richter und die Furcht vor der Staatsmacht, wie sie Kafka selbst später in seinen Romanen "Das Schloss" (1926) und "Der Prozess" (1925), beide posthum veröffentlicht, beschrieben hat. Das Schreiben bietet für dieses Grundgefühl der Furcht nur bedingt einen Ausweg, für Kafka erfüllt sie die Funktion einer Selbstverständigung, einer persönlichen Tätigkeit, die er nicht öffentlich machen wollte, obwohl sich sowohl im Brief an den Vater wie auch in den einschlägigen Romanen und Erzählungen eine Lebenshaltung zeigt, die für die gesamte Moderne denkwürdig werden sollte. Denn nicht nur der Sohn fürchtet sich vor der väterlichen Autorität, sondern das Individuum als solches fürchtet sich vor allem, was es an äußerer Autorität (Macht, Staat, Recht, Ökonomie) bedrängt und dessen Gesetze, Regeln und Organisationsformen es nicht durchschaut. Insofern weitet sich Kafkas Perspektive von der privaten Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater zur philosophischen Meditation über den modernen Menschen als einem bedrängten, gebeutelten und gequälten Wesen. Ödipus' Tragik lag darin, dass er dem Konflikt mit seinem Vater nicht entkommen konnte. Die Tragik des Kafka'schen Sohnes liegt darin, dass dieser Sohn gar nicht erwachsen werden kann, weil er stets mit neuen externen Autoritäten konfrontiert wird, die über ihn Macht ausüben und seine Individualität zerstören wollen. Der Sohn des "Briefes an den Vater" kann gar nicht erwachsen werden. Nicht dass er das nicht wollte, aber der Vater selbst, das Gesetz, die Behörden, die Autoritäten lassen es nicht zu. Kafkas Sohn wird deshalb stets ein furchtsamer Sohn bleiben, weil sich die Zahl der unverständlichen väterlichen Autoritäten vervielfacht hat. Kafkas Interpreten sahen hier eine Schlüsselerfahrung der Moderne auf den literarischen und psychologischen Punkt gebracht. 5. Väterliche Herkunft
Der Vater schrieb eine Biographie, die schnell eine zweite Auflage erreichte und ins Holländische übersetzt wurde. Er gab eine hektographierte satirische Zeitschrift heraus, die bald niemand mehr las. Alle Artikel dafür schrieb er selbst. Der Sohn nahm solche Skurrilitäten mit einer gewissen Distanz zur Kenntnis. Wie stets in seinen Romanen erzählt Strauß nicht chronologisch, sondern in Fragmenten, Erinnerungsfetzen, kurzen philosophischen Aphorismen. Gegenwart und Vergangenheit verschlingen sich ineinander, nicht anders als im Bewusstsein aller Söhne und Töchter, die sich gnädig oder barmherzig jeden Tag mit ihren Eltern auseinandersetzen. Bei Strauß ist beides zu spüren: Gnade, die nicht in Überschwänglichkeit ausartet, und Unbarmherzigkeit, die sich aber nicht verhärtet oder verfestigt. Dieses Buch ist weder im Zorn noch in nostalgischer Vaterliebe geschrieben. Der Erzähler, ein alter Mann von siebzig Jahren (wie Strauß selbst), erinnert sich an den unreifen Sohn, der er einmal war. Dieser Sohn bewunderte den Vater. Der alt gewordene Sohn steht vor der schwierigen Aufgabe, den Haushalt der Eltern aufzulösen. Mit jedem eingepackten oder doch weggeworfenen Erinnerungsstück bricht der Gedanke an eine häusliche Szene aus der eigenen Kindheit auf. Der Erzähler fängt an, wieder vom Vater zu träumen. Der Vater war dem Sohn Autorität, Reiseführer, Wegweiser, ein zufriedener mittelständischer Bürger, der den ihm gemäßen sozialen Ort gefunden hatte. Er sorgte energisch dafür, dass die Familie nicht aufs soziale Abstellgleis geriet. Umgekehrt bemühte er sich nicht, gesellschaftlich wieder nach oben zu klettern. Der erzählende Sohn nahm das alles zur Kenntnis, fühlte sich in den von den Eltern geschaffenen Verhältnissen heimisch, solange er zur Schule ging. Sobald er nach dem Abitur wegzog, ließ er diese Verhältnisse ohne große Trauer hinter sich. Die Mutter, die ihren Ehemann um Jahrzehnte überlebte, trat hinter dem spröden Vater zurück. Ihre Beschreibung bleibt skizzenhaft, gewinnt keine genaueren Konturen. Aber im Skizzenhaften, Impressionistischen, Hingetupften, das ganz unvermittelt philosophische Tiefe gewinnen kann, liegt die große Stärke dieses Autors. Vielmehr als einen Abschnitt benötigen Strauß' Beobachtungen und Überlegungen in der Regel nicht. Er trägt dem Umstand Rechnung, dass Erinnerungen sprunghaft, in einem plötzlichen Augenblick auftauchen. Genauso schreibt der Erzähler sie dann auf. Bewusst verzichtet er auf eine biographische oder chronologische Anordnung. Das Bild des Vaters entsteht aus psychologischen Mosaiksteinchen, nicht durch die Reihung auf einer Zeitschiene. Strauß besaß schon immer ein besonderes Talent für alles Vorübergehende, für die Passanten und Flaneure. Ihr Verhalten und ihre Psychologie beobachtete er scharf und verdichtete diese Beobachtungen zu kurzen Szenen, in denen sich Vergeblichkeit, Verzweiflung und Ausweglosigkeit verdichteten, stets angereichert mit Ironie und oft beißendem Spott. Dieses Verfahren, allerdings ohne Ironie, wendet Strauß nun auf seinen eigenen Vater an. Ein Beispiel: Der Vater in der Erzählung baute sich ein Gerüst aus Regeln, mit deren Hilfe er den Alltag bewältigte. Vor der Arbeit unternahm er einen Spaziergang, um 12.30 Uhr folgte das Mittagessen, darauf eine Pause, während er weder die Tür öffnete noch das Telefon abnahm. "Die Behausung und die bergenden Zeremonien, sie sind für den einzelnen zuweilen das, was die Institutionen für die Gemeinschaft bedeuten; diese Regeln, die man durchaus nicht als leer ansehen mag, da sie offenkundig die Selbsterhaltungskräfte stärken."[8] Die Regeln, an die sich der Vater hielt, sind unerlässliche Selbst- und Lebenshilfe, denn sie verhindern Depression, Verzweiflung, Unordnung, Abweichung, Chaos. Dafür kann man in Kauf nehmen, dass sich die Pragmatik und Rationalität dieser Lebensregeln dem Außenstehenden nicht unbedingt erschließt. Der Vater fühlt sich wohl, innerhalb des sozialen wie ethischen Geflechts, das er sich selbst gewebt hat und das er an den Sohn in Teilen weitergibt. Dem Sohn bleibt - anders als Kafkas Sohn - die Freiheit, einige dieser Regeln zu übernehmen, er muss es aber nicht. Je älter der Sohn wird, desto mehr Gelegenheiten nimmt er wahr, sich aus dem Geflecht von Regeln zu befreien, sich eigene Prinzipien zu setzen und sich später eigene väterliche Lehrer zu suchen. Das Verhältnis zum Vater ist bei Strauß durch Sehnsucht und Erinnerung bestimmt: "Das Gedächtnis ist eine Variable der Sehnsucht, sodass Fernweh und Heimweh, Erwartung und Erinnerung in ein und demselben 'Enzym' des Unerreichlichen symmetrisch angeordnet sind."[9] Vater und Sohn nutzen das Gedächtnis, um Sehnsüchte auszubilden. Der Sohn malt sich die Zukunft so aus, wie die erinnerte Vergangenheit einmal war - oder auch nicht war. Der Sohn zielt auf das in der Gegenwart nicht zu Erreichende. Sehnsucht, das ist das Begehren, der "désir" der französischen Psychoanalytiker, welcher Handeln und Denken in der Tiefe steuert. 6. Ein Vater mit Hand und Fuß
Strauß' Erzählung ist von gewichtigen Kritikern als eine Art Biographie gelesen worden, aber dieses Urteil wird dem Charakter der Erzählung nicht vollständig gerecht. Genauso kann man den schmalen Band auch als Sammlung philosophischer Anmerkungen über Väterlichkeit lesen. Darin vermischen sich Psychologie und Biographie. Selbst im hohen Alter, als der Sohn längst selbst zum Vater geworden ist, begleitet der Vater des Erzählers den Sohn noch in seinen Träumen. Strauß beschreibt das Verhältnis zwischen dem (lebenden) Sohn und dem längst verstorbenen Vater so: "So bin ich nun sein Pfad. Durch mich kommt er herüber, geht er zurück. Ich bin sein Wandel, den er braucht, um zwischen Dort und Hier, Abwesenheit und Anwesenheit frei zu verkehren."[11] Das ist ein Schlüsselzitat. Zwischen Vater und Sohn geht es nicht um Mord, Attentat, Furcht und Zittern oder Demütigung. Der Erzähler lässt dem eigenen Vater ein wenig Platz in seinen Träumen und Spaziergangsphantasien. Der Sohn liebt den Vater nicht, aber er hat seinen Frieden mit ihm geschlossen. Seine Gegenwart, das klingt an, könnte er nicht mehr ertragen, aber den toten Vater läßt er gelten, gewährt ihm immer wieder Raum in der eigenen Erinnerung. Das gehört zu den faszinierenden Unaufgeregtheiten dieses Buches. Der Sohn ist erwachsen geworden: Er muss seinen Vater weder umbringen noch in den Himmel loben. Wie lange es gedauert hat, erwachsen zu werden, verrät der Autor nicht. Aber Strauß hat gewartet, bis er siebzig war, um dieses Buch zu publizieren. 7. Erinnertes VaterbildAuch deswegen gehört Erinnerung zu den entscheidenden Stichwörtern. Das Buch ist auch aus der Resignation darüber geschrieben, dass das Individuum sich nicht von der Erinnerung an den Vater befreien kann. Strauß schreibt: "Das Subjekt tritt in die Aura seiner Damaligkeit. Was war, überkommt es wie ein Anfall. Es ist ja kein ruhiges Tal, in das man besinnlich hinabschaut. Was war, liegt immer über dem gegenwärtigen Standpunkt. Ein unbezwingliches Reich, das keine Aufklärung je erobern könnte."[12] Nicht zufällig ist hier vom Vater oder vom Elternhaus, von der "Herkunft" gar nicht die Rede. Viel wichtiger ist, dass die Erinnerung nicht wie eine Festplatte des Gedächtnisses verstanden wird, die man jederzeit durchsuchen und abrufen kann. Erinnerung überkommt einen Menschen vielmehr wie ein "Anfall". Erinnerung kommt plötzlich. Und deswegen beherrscht die Erinnerung das Subjekt, nicht umgekehrt. Nicht der Sohn beherrscht das Vaterbild, sondern die Erinnerung an den Vater beherrscht den Sohn. Sie überkommt ihn immer wieder wie ein Anfall. Deswegen ist für Strauß das Vergessen mindestens eine genauso wichtige Aufgabe wie das Erwachsenwerden.[13] Der erwachsen gewordene Sohn setzt sich nicht mehr mit dem realen Vater auseinander, sondern mit dem Vaterbild, das durch die Erinnerung an ihn in seinem Bewusstsein verankert ist. Der reale Vater mag gestorben sein. Insofern zu ihm beendet. Der Erzähler kann nicht mehr mit ihm reden. Aber die Vatererinnerung lässt sich nicht so einfach vertreiben. Der Mensch ist für Strauß ein "Schaufelsklave in den Gedächtnishalden"[14]. Erinnerungsarbeit als kontinuierlicher, geordneter und systematischer Prozess muss eine Illusion bleiben. Gegen den Freud'schen Sohn, der seinen Vaterkonflikt auf der Couch des Psychoanalytikers dreimal in der Woche eine Stunde lang "durch"-arbeitet, bringt Strauß das Plötzliche, Eruptive und Überwältigende des Erinnerungsprozesses in Stellung. Im Plötzlichen verbinden sich das Vergangene und das Gegenwärtige. Auch bei Strauß brechen dann Paradoxien auf: Denn zum einen war der Vater für den Sohn orientierende, bildende Autorität, zum anderen wird deutlich, dass der Vater in seiner zwanghaften Regelungswut nur seine Verbitterung verpuppte und damit seine Orientierungskraft selbst beschnitt. So verwandelt sich die in der Kindheit naiv respektierte Autorität in der Erinnerung in brüchige, gefährdete Autorität. Das ist einer der Schreckensgedanken jedes Sohnes, dass, wenn er selbst älter wird, die Ähnlichkeit mit dem Vater immer mehr zunimmt. Der junge Mensch hofft auf die Veränderlichkeit menschlichen Lebens, vor allem deshalb, weil er sich vom eigenen Vater unterscheiden will. Der alt gewordene Sohn wundert sich über die Unveränderlichkeit und Unverständlichkeit des Menschen, weil es ihm nicht gelungen ist, die Prägung durch den väterlichen Stempel loszuwerden. Mit Strauß' Vaterbild in "Herkunft" wird mehreres deutlich. Wie Nozick erkennt er den Prozesscharakter der Verwandlung des Sohnes in einen Erwachsenen (und in einen Menschen, der selbst zum Vater wird), er akzentuiert die Bedeutung der plötzlichen Erinnerung und er erkennt als selbst alt gewordener Mensch, dass er dieser Gegenwart (!) des Vaterbildes zeitlebens nicht ausweichen oder entkommen kann. Wie bei Freud ist das Erwachsenwerden des Sohnes von Konflikten und Konkurrenzen geprägt, die verarbeitet werden müssen, allerdings bei Strauß eher in einer literarischen Reflexion als in einer Psychoanalyse. Anders als bei Freud wird bei Strauß die Konflikthaftigkeit des Geschehens ausbalanciert durch Momente der Fürsorge und der Geborgenheit in der Vaterbeziehung, die Strauß nicht verschweigt. Anders als Kafka empfindet Strauß' Erzähler den eigenen Vater nicht als so übermächtig, dass er sich zeitlebens nicht vom übergroßen Druck väterlicher Autorität befreien kann. Strauß' Erzählersohn konnte sich befreien, denn er konnte sich aus dem Elternhaus lösen und erwachsen werden. Das bedeutete aber nicht, dass das Vaterbild aus der Erinnerung und dem Bewusstsein des Erzählers verschwanden. Dass hier eine Differenz zwischen (wirklichem) Vater und Vaterbild eingezogen werden muss, darin besteht die literarische und philosophische Leistung von Strauß. Diese allerdings war stets umstritten. 8. Vaterlos - OrientierungslosWas Strauß erzählerisch verarbeitet, entspricht nicht der Mehrheitsmeinung der Autoren seiner Generation. Diese hat eher Alexander Mitscherlich formuliert in seinen Überlegungen zur vaterlosen Gesellschaft[15], die er zuerst im Jahr 1963 veröffentlichte. Mitscherlich äußert beißende Kritik an einer Vätergeneration, die sich durch Weltkrieg, Nationalsozialismus und Holocaust moralisch kompromittiert hat. Dort wo diese Kompromittierung nicht einfach überspielt oder ignoriert wird, zeigt sie sich als anhaltende Verunsicherung einer "skeptischen Generation" (Helmut Schelsky) über die eigenen moralischen Werte und Handlungsorientierungen. Wer aber als Vater selbst nicht orientiert ist, kann solche Orientierungen auch nicht an seine Söhne und Töchter weitergeben. Diesen wird vorenthalten, was sie eigentlich familienpsychologisch von ihren Vätern und Müttern erwarten können. Wer mit der Erwartung, orientiert zu werden, an den eigenen Vater herantritt und keine Antworten auf seine Fragen findet, findet sich in einem ethischen Vakuum wieder; er ist irritiert und im wahren Sinne des Wortes rat-los. Emotional erzeugt das Verunsicherung und Haltlosigkeit. Es entsteht Aggression, die sich zunächst auf den Vater, aber eben auch auf die Väter (und die Gesellschaft) richtet. Die Väter der fünfziger und sechziger Jahre können mit dieser Aggression nicht richtig umgehen. Ihr interner Konflikt besteht darin, dass sie sich einer Aufgabe stellen sollen, von der sie wissen, dass sie darin einmal individuell und historisch versagt haben. Deswegen fragen sie danach, welche Werte denn im Angesicht der historischen Katastrophe noch Bestand und Geltung haben. Aber die Ratlosigkeit, die sie den Söhnen zumuten, überfordert diese, denn sie wird ihnen psychologisch nicht gerecht. Der interne Konflikt der Söhne besteht darin, dass ihr Orientierungsbedürfnis nicht befriedigt wird. Es bringt sie nicht weiter, wenn sie die fehlende Orientierung bei den Vätern umso heftiger und deutlicher einklagen. Das erzeugt Gefühle der Verlorenheit und Verlassenheit. Resigniert wenden sie sich von den Vätern, die nicht Väter sein wollen, ab und suchen sich Vater-Surrogate. Oder sie verschaffen sich mit Gewalt und Terror selbst diejenige Orientierung, die sie von den Vätern nicht erhalten haben. Die wichtige Phase des Erwachsenwerdens, die durch eine Überwindung der Väterorientierung gekennzeichnet ist, kann nicht durchlaufen werden. Die Bildungs- und Reifungsprozesse kommen ins Stocken: Die Söhne bleiben ewige Söhne, auch wenn sie biologisch erwachsen geworden sind. Wenn man diese fünfzig Jahre alten Thesen Mitscherlichs mit Strauß' Erzählung konfrontiert, so ergeben sich Kongruenzen wie Dissonanzen. Die überragende Rolle der Beziehung von Söhnen und Töchtern zu den Eltern bestimmen die sozialpsychologischen Überlegungen Mitscherlichs ebenso wie Strauß' essayistische Erzählung. Die Beziehung zum Vater konfiguriert die Beziehung zur Wirklichkeit, so Mitscherlich, so Nozick, so Strauß. Und Strauß würde auch die notwendige Konflikthaftigkeit dieser Beziehung nicht leugnen. Aber anders als auch bei Kafka ist die Beziehung nicht ausschließlich konflikthaft geprägt. Es macht eine weitere Stärke der Erzählung von Strauß aus, dass sie die ambivalenten und dynamischen Anteile der Vater-Sohn-Beziehung herausarbeitet: ambivalent, weil er neben Momenten des Konfliktes auch die anderen Momente von Geborgenheit, Schutz und Orientierung betont, die der Sohn genauso erlebt hat wie die Konflikte; dynamisch, weil es Strauß mit wenigen literarischen Pinselstrichen gelingt, die Veränderungen und Verwandlungen dieser Vater-Sohn-Beziehung herauszuarbeiten. Je älter und erwachsener er wird, desto besser durchschaut der Erzähler das Schneckenhaus aus Regeln und Gewohnheiten, in dem sich der Vater selbst gefangen hält. Aber er verurteilt das nicht, er läßt es nicht zum Bruch kommen, sondern er versteht das und setzt sich damit auseinander. Deswegen kann der Erzähler auch annehmen und ertragen, dass er in seiner Gegenwart mit dem toten Vater als bleibender Erinnerung lebt. Deswegen, weil es nicht zum völligen Bruch kommt, nimmt sich der studierende Sohn die Freiheit, sich eigene philosophische und literarische Lehrmeister zu suchen. Sie ergänzen die Defizite an Orientierung, die der leibliche Vater aus welchen Gründen auch immer an seinen Sohn nicht weitergeben konnte. Die etablierte Kritik hat genau diesen fehlenden Bruch der von Mitscherlich beschriebenen Väterkrise der bundesrepublikanischen Gesellschaft der fünfziger und sechziger Jahre stets zum Vorwurf gemacht. Weil Strauß diese väterlose Konfliktlage nicht aufnahm, galt er der Kritik stets als Konservativer, im schlimmeren Fall als Reaktionär. Politisch bewahrt der Konservative die bewährte Tradition, psychologisch akzeptiert er den Vater als Instanz der Orientierung. Genauso verhält sich der Reaktionär, mit dem Unterschied, dass er Vater wie Tradition gedankenlos und ohne eigenen Willen akzeptiert. Gedankenlosigkeit aber ist so ziemlich das letzte, was man Strauß zum Vorwurf machen kann. Psychologisch ist das Verhältnis des Sohnes zu seinem Vater in "Herkunft" gerade durch die reflektierte Beobachtung der verschiedenen Ambivalenzen dieses Verhältnisses ausgezeichnet. Auch der Erzähler hat seinen Vater - wie alle erwachsen werdenden Menschen - verlassen. Aber er hat ihn nicht umgebracht - weder im realen noch im psychologischen oder symbolischen Sinn. Er war noch nach dem Auszug in der Lage, mit dem Vater zu reden. Und er ist es - als Erzähler - auch in der Gegenwart noch, denn der Erzähler träumt ja vom Vater und setzt sich mit dem nicht auszulöschenden Vaterbild auseinander, das sich in seinem Bewusstsein festgesetzt hat. 9. Der Sohn als Vater des Vaters
Vergesslichkeit nimmt im Alter zu, das ist ein normales menschliches Phänomen, ob es sich um Väter handelt oder nicht. Wenn sie sich bei Älteren und Hochbetagten bis zur Demenz steigert, kann es zwischen dem Erkrankten, seinen besorgten Angehörigen und den Betreuern zu skurrilen bis komischen Szenen kommen. Geiger spricht respektvoll und komisch von seinem dementen Vater, von der Hilflosigkeit der Angehörigen und von dem mühsamen Versuch des Sohnes, die Krankheit des Vaters zu akzeptieren. Geiger erzählt: „'Ich habe mir hier die Hände gewaschen', sagte der Vater einmal. 'War das erlaubt?' 'Ja, das ist dein Haus und dein Waschbecken.' Er schaute mich erstaunt an, lächelte verlegen und sagte: 'Meine Güte, hoffentlich vergesse ich das nicht wieder!' Das ist Demenz. Oder besser gesagt: Das ist das Leben – der Stoff, aus dem das Leben gemacht ist.“[16] Der Vater fragt den Sohn nach einer Erlaubnis. In dieser Frage um Erlaubnis findet sich die typische Umkehrung des Vater-Sohn-Verhältnisses. Geigers Buch scheut vor den komischen und verzweifelten Situationen der Demenz nicht zurück. Doch in diesem Essay ist Demenz nicht das Thema. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang: Die Demenzerkrankung greift nicht nur massiv in das Leben des betroffenen Vaters ein, sie zieht auch für das Verhältnis des Vaters zu seinen Kindern und alle anderen Betreuern erhebliche Veränderungen nach sich, die psychologisch verarbeitet werden wollen. Geiger gelingt das mit literarischer Überzeugungskraft[17]; ihm gelingt es, gegenüber dem erkrankten Vater Respekt, Anerkennung und Zuneigung zu bewahren, schon deshalb weil er die komischen Situationen, in die die Demenzerkrankung Vater und Sohn bringt, aufnimmt und mit Humor weitergibt. Geiger schreibt zuerst und vorrangig über die Demenz des Vaters, nicht über das Vater-Sohn-Verhältnis. Sein Buch ist die Beschreibung eines Zustandes, nicht einer Entwicklung und Ursachenforschung. Strauß hat diese Verwandlung des Vater-Sohn-Verhältnisses nicht im Blick. Der Vater des Erzählers wurde nicht zum Pflegefall. Aber über das Altern des Vaters ist nachzudenken. Denn mit dem Alter und einer möglichen Demenz geht ein Verlust einher: Der alternde Mensch verliert Lust, Willen und Energie sein Leben selbst zu gestalten. Das aber wäre Voraussetzung, um Orientierung leisten zu können, nicht mehr paternalistisch-autoritär, sondern im Dialog auf Augenhöhe mit den eigenen Söhnen und Töchtern. Denn die Demenz im wirklichen Leben beeinFlusst genauso die spätere Erinnerung an den Vater wie alle Erinnerungen an die frühe Kindheit mit den Zügen der Modelleisenbahn, Verboten, Strafen, Lehren und Zeichen der Zuneigung. Und es ist zu fürchten: Die vermeintliche Schwäche des alternden Vaters in der letzten, der dementen Phase seines Lebens legt sich als Erinnerungsbild vor all die älteren - schöneren wie schlimmeren Bilder aus Kindheit und Jugend, aus der Zeit, als die Rollen zwischen Vater und Sohn noch nicht getauscht waren. Das Problem stellt sich erst dann, wenn die allgemeine Lebenserwartung so sehr gestiegen ist, dass Eltern nicht an anderen Krankheiten oder infolge von Unfällen sterben, bevor sie dement sind. Der große Erfolg von Geigers Buch zeigt, dass diese letzte Phase väterlichen Lebens in die psychologische Logistik mit aufgenommen werden muss. 10. Ich und der Vater sind einsEs wären noch weitere philosophische[18] und literarische[19] Modelle des Vater-Sohn-Verhältnisses zu nennen, aus der Gegenwart wie aus der Tradition[20]. Dennoch soll zuletzt noch eine im emphatischen Sinn theologische Meditation des Verhältnisses von Vater und Sohn vorgestellt werden. Ich meine das Johannesevangelium. Man könnte auch die Familienkonstellation der Weihnachtsgeschichte (Lk 2) wählen, aber darüber habe ich an anderer Stelle schon etwas gesagt.[21] Der Jesus des Johannesevangelium hebt gegenüber Volk und Jüngern prononciert hervor: "Ich und der Vater sind eins." (Joh 10,30). Nun ließe sich einwenden, dass das Verhältnis zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn definitiv keine psychologische Seite habe und darum in diesem Zusammenhang ohne weiteres ausgeblendet werden kann. Aber dem ist nicht so. Denn im Johannesevangelium trennt die enge Verbindung zwischen Gott dem Vater und Jesus von Nazareth diesen von allen anderen Menschen, inklusive seiner Mutter, die sich bereits bei der Hochzeit von Kana (Joh 2,1ff.) sehr über ihren Sohn wundert. Johannes betont die vollständige Übereinstimmung zwischen dem Willen des Vaters und dem Handeln, Reden und Denken des Sohnes. Damit wird dieses Vater-Sohn-Verhältnis das Gegenbild zu dem Verhältnis der Furcht, das Franz Kafka gegenüber seinem Vater beschreibt. Der Sohn im Johannesevangelium ist sofort Gott, gerade wegen der Inkarnation (vgl. Joh 1,1ff.), er muss nicht erst zum Vater zurückkehren oder mit dem Vater wieder eins werden. Es ist auch keine psychologische Entwicklung nötig. Die mit der Inkarnation ("Das Wort ward Fleisch.") konstituierte Beziehung zwischen Vater und Sohn steht ein für allemal fest und verändert sich durch das Evangelium und die darin beschriebene Lebensgeschichte auch nicht. Die Menschen, die Jesus zuhören und erleben, sind davon auf unterschiedliche Weise irritiert. Besonders die Jünger muss Jesus in langen Abschiedsreden über Trost, Auferbauung und Freundschaft erst darauf einstellen, dass sie auch dann in Glauben und Leben zurechtkommen, wenn er nicht mehr leibhaftig anwesend ist. Denn die Beziehung der Jünger zu Jesus von Nazareth kann man ohne weiteres eine väterliche Beziehung nennen. Jesus ist der Meister, der Rabbi der Jünger. Die Jünger haben eine väterliche Beziehung zum Sohn, und nur durch die Vermittlung des Sohnes haben sie auch eine Beziehung zu Gott dem Vater. All das droht in Gefahr zu geraten, wenn der Sohn hingerichtet wird. Im Bewusstsein, dass er hingerichtet werden wird, spricht Jesus lange mit den Jüngern. Diese Passagen zählen zu den ergreifendsten des gesamten Neuen Testaments. Jesus verspricht den Jüngern zweierlei. Zum einen kündigt er einen Parakleten, einen Tröster an, nämlich den Heiligen Geist. Zum anderen verweist er die Jünger auf die Solidarität im Glauben untereinander. Während des Lebens Jesu, aber auch später, nach Tod und Auferstehung bilden die Jünger einen Freundschaftsbund, in dem sie sich gegenseitig stärken. Oder väterpsychologisch formuliert: Sie leisten sich gegenseitig jene Hilfen und Orientierungen, die sie durch den Tod ihres Meisters am Kreuz verloren haben. An die Stelle der Vater-Beziehung tritt eine Beziehung auf Gegenseitigkeit. Diese Beziehung auf Gegenseitigkeit kommt durch Wahl zustande und nicht durch eine vorgegebene biologische Bindung. Der christliche Glaube verändert damit nach dem Johannesevangelium die sozialen Bindungskräfte: Beziehungen des Glaubens und der Freundschaft treten an die Stelle vorgegebener familiärer Bindungen. Dieser Wandel entsteht daraus, dass der Jesus von Nazareth in einem ganz anderen Sinne Sohn ist als man das im alltäglichen Sprachgebrauch meint. Der Sohn Gottes erlöst die Söhne und Töchter, welche einen biologischen Vater haben. Der Freundschaftsbund der Jünger, dh. die Gemeinde, ist die neue heilige Familie des Glaubens, die an die Stelle der ursprünglichen biologischen Familie tritt.[22] Womit aber nicht gesagt ist, dass der biologischen Familie nun gar keine Bedeutung mehr zukäme. Die familiäre Hierarchie von Vätern und Müttern sowie Töchtern und Söhnen auf der anderen Seite wird durch ein radikales Gleichheitsmodell ersetzt, welches im Glauben an Jesus Christus alle sozialen und psychologischen Unterschiede aufhebt. Daraus ergeben sich bis heute weitreichende theologische Folgerungen. Es wäre nun sehr spannend, die Übergänge vom biologischen Modell der Familie zum Glaubensmodell der Familie, von der Verwandlung des einen in das andere im Johannesevangelium selbst, aber auch in weiteren klassischen theologischen Texten weiter zu verfolgen, aber das soll hier nicht geschehen. Es soll nur die Faszination weitergegeben werden, die daraus entsteht, in einem zweitausend Jahre alten Text plötzlich familienpsychologische und kulturphilosophische Reflexionen zu entdecken, die ohne weiteres mit Kafka, Freud, Strauß, Mitscherlich, um nur diese zu nennen, ins Gespräch zu bringen wären. Botho Strauß im Übrigen hat nicht im hier besprochenen Roman, wohl aber in anderen seiner Bücher erkennen lassen, dass ihn diese theologische Wendung psychologischer Verhältnisse in den Texten des Neuen Testaments durchaus nicht unbeeindruckt gelassen hat. 11. Erwachsen werden ist nicht schwer...
Der gegenseitige Bildungsprozess, der zwischen Vater und Sohn stattfindet, prägt für ein ganzes Leben und gleichzeitig ist er ungeheuer dynamisch, vielseitig, risikobehaftet. Söhne (und Töchter) sind am Anfang hilflose Babies, auf Schutz angewiesen, dann Lernende, Fragesteller, Quengler, Provokateure, Heranwachsende, die auf ihre Selbständigkeit pochen, dann Menschen, die sich aus dem Elternhaus loslösen, Gesprächspartner, die Freiheit gewinnen und herstellen, schließlich möglicherweise Pflegende und Betreuer, die für die alten Eltern diejenigen Schutzräume bereitstellen, welche die Eltern einst für sie selbst als Kinder bereit gestellt haben. Umgekehrt sind Väter (und Mütter[23]) Bezugspersonen, die Orientierung und Schutz gewährleisten, Erzieher, Zurückbleibende, sich sorgende Menschen, die mit dem Heranwachsen der eigenen Kinder Macht verlieren, erst über die Kinder, dann über ihr eigenes Leben, wenn sie im Alter krank und dement werden, und sich, bevor sie sterben, aus dem Leben zurückziehen. Diese wechselnden Rollenmodelle sind untrennbar aufeinander bezogen, sie können nicht voneinander abgelöst werden, nicht einmal im Todesfall. Botho Strauß hat für diese untrennbare Verknüpfung von Vater und Sohn ein Beispiel erzählt. Das Buch lohnt die Lektüre, weil bei ihm Reflexion und Erzählung, Biographie und Alltagsethik sowie emotionale Bindung und deren reflexive Bearbeitung im richtigen Verhältnis stehen.
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/93/wv14.htm |
 Die mittelalterliche Legenda aurea erzählt von dem Fährmann Christopherus, der vor seiner Taufe Reprobus hießt. Eines Nachts ruft ihn ein Junge aus dem Schlaf und bittet Christopherus, ihn durch den Fluss zu tragen. Christopherus wundert sich, setzt sich das Kind auf die Schulter, nimmt seinen Stock und marschiert los, in Richtung des anderen Ufers. Je tiefer das Wasser wird, desto schwerer wird dem kräftigen Christopherus das schmale Kind auf seiner Schulter. Bald fürchtet er sich zu ertrinken. Strömung und Gewicht machen ihm zu schaffen. Nur mit letzter Mühe gelangen die beiden ans andere Ufer.
Die mittelalterliche Legenda aurea erzählt von dem Fährmann Christopherus, der vor seiner Taufe Reprobus hießt. Eines Nachts ruft ihn ein Junge aus dem Schlaf und bittet Christopherus, ihn durch den Fluss zu tragen. Christopherus wundert sich, setzt sich das Kind auf die Schulter, nimmt seinen Stock und marschiert los, in Richtung des anderen Ufers. Je tiefer das Wasser wird, desto schwerer wird dem kräftigen Christopherus das schmale Kind auf seiner Schulter. Bald fürchtet er sich zu ertrinken. Strömung und Gewicht machen ihm zu schaffen. Nur mit letzter Mühe gelangen die beiden ans andere Ufer. Mein Vater, der evangelisch war, aber zu Glauben und Kirche ein eher agnostisches Verhältnis pflegte, befestigte dennoch an den Armaturenbrettern seiner NSU-Kleinwagen stets einen silberfarbenen Magneten, der Christopherus mit dem Jesus-Kind bei der Flussüberquerung zeigte. Und er seinen beiden Söhnen erzählte er regelmäßig die auf dem Magneten abgebildete Legende. Die Söhne waren allerdings damals mehr von den Magnetkräften als von der Erzählung fasziniert. Das soll sich mit diesem Essay ändern.
Mein Vater, der evangelisch war, aber zu Glauben und Kirche ein eher agnostisches Verhältnis pflegte, befestigte dennoch an den Armaturenbrettern seiner NSU-Kleinwagen stets einen silberfarbenen Magneten, der Christopherus mit dem Jesus-Kind bei der Flussüberquerung zeigte. Und er seinen beiden Söhnen erzählte er regelmäßig die auf dem Magneten abgebildete Legende. Die Söhne waren allerdings damals mehr von den Magnetkräften als von der Erzählung fasziniert. Das soll sich mit diesem Essay ändern.
 Das sah Franz Kafka anders, er malte ein noch sehr viel schwärzeres Bild der Vater-Sohn-Beziehung als Freud. Denn Kafka sah in seinem berühmten und zu seinen Lebzeiten unveröffentlichten "Brief an den Vater"
Das sah Franz Kafka anders, er malte ein noch sehr viel schwärzeres Bild der Vater-Sohn-Beziehung als Freud. Denn Kafka sah in seinem berühmten und zu seinen Lebzeiten unveröffentlichten "Brief an den Vater"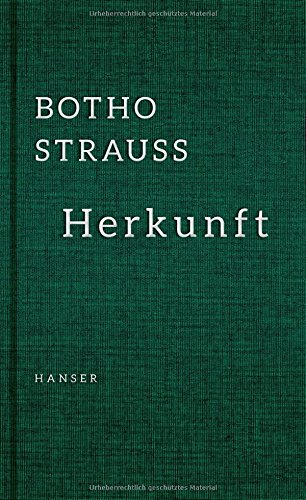
 "Die Hände, die mich führten, ich habe sie niemals verlegen gesehen!"
"Die Hände, die mich führten, ich habe sie niemals verlegen gesehen!"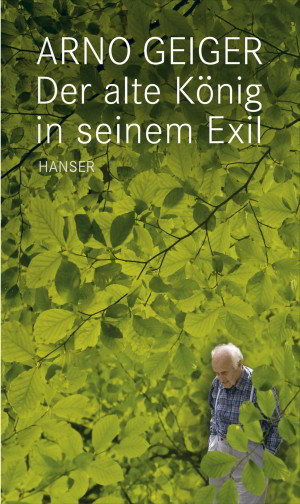
 Vielleicht hatte doch Christopherus Recht, der, ohne es zu merken, lieber das Jesuskind als seinen Vater über den Fluss des Lebens trug. An den hier entfalteten Überlegungen sollte deutlich geworden sein, dass sich an der Beziehung zu den Eltern das Verhältnis eines Menschen zur Wirklichkeit ablesen lässt. Das eine prägt das andere. Vater und Mutter sind die ersten Bezugspersonen, die das Leben des Neugeborenen in eine bestimmte Richtung lenken. Dieser elterliche Bildungsprozess hört selbst dann nicht auf, wenn die Eltern gar nicht mehr leben und nur noch in den Erinnerungsbildern der Kinder weiter existieren. Man kann die Auswirkungen dieses Prozesses gar nicht hoch genug einschätzen. Trotzdem müssen sich Töchter und Söhne irgendwann aus dieser elterlichen Orientierungen befreien, um selbst erwachsen zu werden. Das kann nicht eine vollständige Trennung meinen. Erwachsene Freiheit verwirklicht sich darin, dass Bindungen, auch wenn sie hemmen, nicht alle gekappt, sondern angenommen und gestaltet werden. Erwachsensein heißt, sich vom Sohn- oder Tochtersein zu verabschieden. Das ist ein langer, manchmal ein schmerzlicher, oft ein sehr konflikthafter Prozess. Aber, so war aus diesen Überlegungen zu lernen: Der Prozess ist nicht nur konflikthaft, er hat auch, andere, bessere Seiten.
Vielleicht hatte doch Christopherus Recht, der, ohne es zu merken, lieber das Jesuskind als seinen Vater über den Fluss des Lebens trug. An den hier entfalteten Überlegungen sollte deutlich geworden sein, dass sich an der Beziehung zu den Eltern das Verhältnis eines Menschen zur Wirklichkeit ablesen lässt. Das eine prägt das andere. Vater und Mutter sind die ersten Bezugspersonen, die das Leben des Neugeborenen in eine bestimmte Richtung lenken. Dieser elterliche Bildungsprozess hört selbst dann nicht auf, wenn die Eltern gar nicht mehr leben und nur noch in den Erinnerungsbildern der Kinder weiter existieren. Man kann die Auswirkungen dieses Prozesses gar nicht hoch genug einschätzen. Trotzdem müssen sich Töchter und Söhne irgendwann aus dieser elterlichen Orientierungen befreien, um selbst erwachsen zu werden. Das kann nicht eine vollständige Trennung meinen. Erwachsene Freiheit verwirklicht sich darin, dass Bindungen, auch wenn sie hemmen, nicht alle gekappt, sondern angenommen und gestaltet werden. Erwachsensein heißt, sich vom Sohn- oder Tochtersein zu verabschieden. Das ist ein langer, manchmal ein schmerzlicher, oft ein sehr konflikthafter Prozess. Aber, so war aus diesen Überlegungen zu lernen: Der Prozess ist nicht nur konflikthaft, er hat auch, andere, bessere Seiten. 12. Tua res agitur
12. Tua res agitur