als Spiegelungen der Barmherzigkeit Gottes
Hans-Jürgen Benedict
1. Zwischen Lerchenflug und Einnisten in die Ackerfurche – Jean Paul
 Nach meinem Verständnis besteht die Herrlichkeit Gottes vor allem in seiner Barmherzigkeit. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist“, mahnt Jesus seine Jünger (Lk 6,36). Diese Barmherzigkeit meint nicht nur die barmherzigen Taten[1], sondern auch die lächelnde Barmherzigkeit als Haltung gegenüber dem Weltganzen und seinen Widersprüchen. „When too perfect, lieber Gott böse“ lautet der berühmte Satz des Videokünstlers Nam June Paik. Das könnte von Jean Paul stammen! Was Jean Paul auszeichnet vor seinen berühmten Zeitgenossen Goethe und Schiller, ist seine Neigung zu den kleinen und belächelten Menschen, die er in seinen Romanen und Idyllen zu seinen Helden macht. Hinter Satire und Ironie findet sich eine innige Liebe zu allem, was klein, bedrückt und missachtet ist. „Im Kreis der Armen fand Jean Paul die Tugend des Empfindens, die er in der herzenskalten, frivolen Welt des Adels und der Residenzen vermißte.“[2] Auf literarisch versponnene Weise trug er so auch dem Evangelium der Armen Rechnung. „Jean Paul hasste die frostige Höhenluft der ästhetischen Debatten, in denen sich um Goethe die Schar der Freunde und Bewunderer erging.“[3] Er bemerkte erschrocken, wie der Kult des Schönen und des autonomen klassizistischen Ich die Verantwortung für die Mitmenschen vernachlässigte. Eingedenk der Vergänglichkeit des allzu kurzen menschlichen Lebens ruft er in seiner Novembervision von 1790 aus: „Euch meine Mitbrüder, will ich mehr lieben, euch mehr Freude machen. Wie sollte ich euch in euren zwei Dezembertagen voll Leben quälen, ihr erbleichenden Bilder voll Erdenfarben im zitternden Widerschein des Lebens?“[4] Was ihn auszeichnet, ist Aufmerksamkeit für das Leben und die Menschen um ihn herum. „Die eingeknickten Idylliker, die Armen und Leidenden, die Einfältigen und sogar die im Charakter Beschädigten – sie alle hebt er als seine Mitbrüder ans Licht, nicht aus Überheblichkeit des Mitleids oder in propädeutischer Absicht, um sie für eine ästhetische Erziehung vorzubereiten, sondern weil jede dieser Winkel-Existenzen in engerer Perspektive den gleichen Kreis von Hoffnungen und Träumen, von Anlagen und Verdiensten durchläuft wie jeder Vertreter höherer Stände, seien es Bürger, Adlige oder – in einer nächsten Wirklichkeit, Engel. Das Ideal des hohen Menschen gilt für jedes Staubteilchen der Schöpfung in gleichem Masse.“[5] Heute würde er, in der U-Bahn fahrend, die stummen, müd gearbeiteten Menschen beschreiben. Transzendenz begegnet im Nächsten, sagt Bonhoeffer in Widerstand und Ergebung. Der aufmerksame Blick für den Menschen neben einem als Zeichen der Transzendenz kann nicht nur für den Literaten zur Begegnung mit der verdeckten Herrlichkeit Gottes werden.
Nach meinem Verständnis besteht die Herrlichkeit Gottes vor allem in seiner Barmherzigkeit. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist“, mahnt Jesus seine Jünger (Lk 6,36). Diese Barmherzigkeit meint nicht nur die barmherzigen Taten[1], sondern auch die lächelnde Barmherzigkeit als Haltung gegenüber dem Weltganzen und seinen Widersprüchen. „When too perfect, lieber Gott böse“ lautet der berühmte Satz des Videokünstlers Nam June Paik. Das könnte von Jean Paul stammen! Was Jean Paul auszeichnet vor seinen berühmten Zeitgenossen Goethe und Schiller, ist seine Neigung zu den kleinen und belächelten Menschen, die er in seinen Romanen und Idyllen zu seinen Helden macht. Hinter Satire und Ironie findet sich eine innige Liebe zu allem, was klein, bedrückt und missachtet ist. „Im Kreis der Armen fand Jean Paul die Tugend des Empfindens, die er in der herzenskalten, frivolen Welt des Adels und der Residenzen vermißte.“[2] Auf literarisch versponnene Weise trug er so auch dem Evangelium der Armen Rechnung. „Jean Paul hasste die frostige Höhenluft der ästhetischen Debatten, in denen sich um Goethe die Schar der Freunde und Bewunderer erging.“[3] Er bemerkte erschrocken, wie der Kult des Schönen und des autonomen klassizistischen Ich die Verantwortung für die Mitmenschen vernachlässigte. Eingedenk der Vergänglichkeit des allzu kurzen menschlichen Lebens ruft er in seiner Novembervision von 1790 aus: „Euch meine Mitbrüder, will ich mehr lieben, euch mehr Freude machen. Wie sollte ich euch in euren zwei Dezembertagen voll Leben quälen, ihr erbleichenden Bilder voll Erdenfarben im zitternden Widerschein des Lebens?“[4] Was ihn auszeichnet, ist Aufmerksamkeit für das Leben und die Menschen um ihn herum. „Die eingeknickten Idylliker, die Armen und Leidenden, die Einfältigen und sogar die im Charakter Beschädigten – sie alle hebt er als seine Mitbrüder ans Licht, nicht aus Überheblichkeit des Mitleids oder in propädeutischer Absicht, um sie für eine ästhetische Erziehung vorzubereiten, sondern weil jede dieser Winkel-Existenzen in engerer Perspektive den gleichen Kreis von Hoffnungen und Träumen, von Anlagen und Verdiensten durchläuft wie jeder Vertreter höherer Stände, seien es Bürger, Adlige oder – in einer nächsten Wirklichkeit, Engel. Das Ideal des hohen Menschen gilt für jedes Staubteilchen der Schöpfung in gleichem Masse.“[5] Heute würde er, in der U-Bahn fahrend, die stummen, müd gearbeiteten Menschen beschreiben. Transzendenz begegnet im Nächsten, sagt Bonhoeffer in Widerstand und Ergebung. Der aufmerksame Blick für den Menschen neben einem als Zeichen der Transzendenz kann nicht nur für den Literaten zur Begegnung mit der verdeckten Herrlichkeit Gottes werden.
 Jean Pauls Wendung zum detailgenauen Romancier geschieht in den Jahren nach der Französischen Revolution; diese hat er als geschichtlich notwendig gesehen, auch wenn der die Gräueltaten der Jakobinerherrschaft verurteilte, bis hin zu einer ethisch gewagten Rechtfertigung des Mords an Marat durch Charlotte Corday[6]. Der Umwertung aller gewohnten Denkschemata durch die Revolution stellte er sich nachdrücklicher als andere deutsche Schriftsteller, die von Anfang an wie Goethe dagegen waren oder aber wie Schiller sich nach den Septembermorden von 1792 und der Hinrichtung Ludwig XVI im Januar 1793 von der Revolution lossagten. Während bei Goethe und vor allem Schiller in den Briefen zu ästhetischen Erziehung des Menschen die Erziehung des Ich, der Erziehungsprozess mündiger Individuen, „Freiheit zu geben durch Freiheit“, wie die schöne Schillersche Formel lautet, zur Antwort auf die entgleiste französische Revolution wird, geht bei Jean Paul nach wie vor die Verachtung alles Regelhaften eine für die Weimarer Dichterfürsten bedrohliche Verbindung mit der Sympathie für die politische Unordnung ein.[7]
Jean Pauls Wendung zum detailgenauen Romancier geschieht in den Jahren nach der Französischen Revolution; diese hat er als geschichtlich notwendig gesehen, auch wenn der die Gräueltaten der Jakobinerherrschaft verurteilte, bis hin zu einer ethisch gewagten Rechtfertigung des Mords an Marat durch Charlotte Corday[6]. Der Umwertung aller gewohnten Denkschemata durch die Revolution stellte er sich nachdrücklicher als andere deutsche Schriftsteller, die von Anfang an wie Goethe dagegen waren oder aber wie Schiller sich nach den Septembermorden von 1792 und der Hinrichtung Ludwig XVI im Januar 1793 von der Revolution lossagten. Während bei Goethe und vor allem Schiller in den Briefen zu ästhetischen Erziehung des Menschen die Erziehung des Ich, der Erziehungsprozess mündiger Individuen, „Freiheit zu geben durch Freiheit“, wie die schöne Schillersche Formel lautet, zur Antwort auf die entgleiste französische Revolution wird, geht bei Jean Paul nach wie vor die Verachtung alles Regelhaften eine für die Weimarer Dichterfürsten bedrohliche Verbindung mit der Sympathie für die politische Unordnung ein.[7]
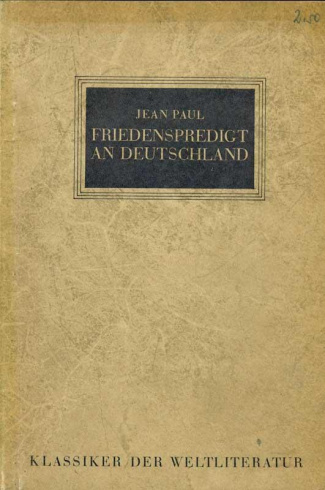 Doch dann nach dem rasanten Aufstieg Napoleons und seiner Eroberung halb Europas, nach dem Tod Schillers (1805) und nach der Niederlage Preußens bei Jena und Auerstädt (1806) wird erstaunlicherweise nicht Goethe, sondern Jean Paul der Trostschriftsteller Deutschlands in den Jahren der französischen Besatzung. 1808 erschien die Friedenspredigt für Deutschland, 1809 die Dämmerungen für Deutschland. Es sind mutige Stellungnahmen gegen das herrschende Unrecht und besonnene Appelle zum Widerstand. Jean Paul wird als politischer Schriftsteller wahrgenommen, während seine literarische Wirkung eher der Vergangenheit angehört. „Jean Paul wird in diesen Jahren, statt Goethe, zum Idealbild des Dichters, der als Mahner und Prophet seinem Volk Halt gibt und Zuversicht.“[8] Jean Paul ist kein Prediger des Franzosenhasses wie Kleist, kein aggressiver Nationalist wie Fichte, aber auch kein Reformer. Er weigert sich während der Freiheitskriege die Franzosen als Erbfeind zu bezeichnen. Das Deutsche ist ihm nur soweit Vorbild als es sich, wie bei Goethe und später Heine („ich bin des freien Rheins weitaus freierer Sohn“) kosmopolitisch über das Nationale erhebt. Wegen seiner Verweigerung der Aufhetzung zum unterschiedslosen Kampf gegen den Feind wird er von Ernst Moritz Arndt mit seinem Bannfluch belegt, dieser beschimpft ihn als „verbrecherischen Verweichlicher“. In seinem letzten Lebensjahrzehnt war er nicht vergessen, aber doch als Schriftsteller wenig präsent. Und wenn er präsent war in der Zeit unmittelbar nach seinem Tod, dann für die Schriftsteller des Jungen Deutschland und des Vormärz als Antipode gegen Goethe. Heine vermerkt seine Sonderstellung 1835 in der Romantischen Schule: „Sein Herz und seine Schriften waren ein und dasselbe (…) diese Ganzheit, die keinen Unterschied zwischen Leben und Schreiben“ macht, dies Künstler und Apostel sein, dieser „Glaube an den Fortschritt“, dies Vertrauen darauf, „dass diese Erde groß genug ist, daß sie jedem hinreichend Raum bietet, die Hütte seines Glücks darauf zu bauen.“[9] So der Pariser Emigrant, der seine fortschrittliche Gesellschaftsauffassung hier in Jean Paul einträgt.
Doch dann nach dem rasanten Aufstieg Napoleons und seiner Eroberung halb Europas, nach dem Tod Schillers (1805) und nach der Niederlage Preußens bei Jena und Auerstädt (1806) wird erstaunlicherweise nicht Goethe, sondern Jean Paul der Trostschriftsteller Deutschlands in den Jahren der französischen Besatzung. 1808 erschien die Friedenspredigt für Deutschland, 1809 die Dämmerungen für Deutschland. Es sind mutige Stellungnahmen gegen das herrschende Unrecht und besonnene Appelle zum Widerstand. Jean Paul wird als politischer Schriftsteller wahrgenommen, während seine literarische Wirkung eher der Vergangenheit angehört. „Jean Paul wird in diesen Jahren, statt Goethe, zum Idealbild des Dichters, der als Mahner und Prophet seinem Volk Halt gibt und Zuversicht.“[8] Jean Paul ist kein Prediger des Franzosenhasses wie Kleist, kein aggressiver Nationalist wie Fichte, aber auch kein Reformer. Er weigert sich während der Freiheitskriege die Franzosen als Erbfeind zu bezeichnen. Das Deutsche ist ihm nur soweit Vorbild als es sich, wie bei Goethe und später Heine („ich bin des freien Rheins weitaus freierer Sohn“) kosmopolitisch über das Nationale erhebt. Wegen seiner Verweigerung der Aufhetzung zum unterschiedslosen Kampf gegen den Feind wird er von Ernst Moritz Arndt mit seinem Bannfluch belegt, dieser beschimpft ihn als „verbrecherischen Verweichlicher“. In seinem letzten Lebensjahrzehnt war er nicht vergessen, aber doch als Schriftsteller wenig präsent. Und wenn er präsent war in der Zeit unmittelbar nach seinem Tod, dann für die Schriftsteller des Jungen Deutschland und des Vormärz als Antipode gegen Goethe. Heine vermerkt seine Sonderstellung 1835 in der Romantischen Schule: „Sein Herz und seine Schriften waren ein und dasselbe (…) diese Ganzheit, die keinen Unterschied zwischen Leben und Schreiben“ macht, dies Künstler und Apostel sein, dieser „Glaube an den Fortschritt“, dies Vertrauen darauf, „dass diese Erde groß genug ist, daß sie jedem hinreichend Raum bietet, die Hütte seines Glücks darauf zu bauen.“[9] So der Pariser Emigrant, der seine fortschrittliche Gesellschaftsauffassung hier in Jean Paul einträgt.

Doch nach der gescheiterten Revolution von 1848 gibt es einen zweiten Wirkungsstrang Jean Pauls, der vor allem durch Idyllen wie Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Fläz, Dr. Katzenberger Badereise und das Leben Fibels bestimmt ist, zumal er den letzten Roman Der Komet nicht abschließen konnte. In diesen Idyllen scheint er ganz in die Grashalm-Perspektive eingesponnen. Diese biedermeierliche Miniaturwelt passte gut in die Zeit der Restauration nach 1848 – die liebevolle Ausmalung des alltäglichen Lebens als Antwort auf die erstarrten Verhältnisse. Die jungen Erzähler schlossen sich hier an – die deutsche Dorfgeschichte wird zur Antwort auf die städtischen Erzählwelten eines Dickens oder Balzacs. „Der Sonderling, dessen innere Fülle aus der Allmacht des humoristischen Erzählers, wird zum herrschenden Typus der deutschen Erzählliteratur zwischen Gottfried Keller und Wilhelm Raabe.“[10] (In der Urfassung des Grünen Heinrich lobt Keller Jean Paul enthusiastisch: alles, was er sich erträumt hatte, schien ihm in Jean Paul tröstend und erfüllend entgegenzutreten. Vaterstelle nehme der Romancier für ihn ein. Doch in der Neufassung des Romans wird diese Passage gestrichen.)
Wieder tritt Goethe in den Vordergrund. Und ganz schlimm wirkte dann das Verdikt Nietzsches aus dem Jahr 1879, Jean Paul sei „das Verhängnis im Schlafrock“. „Jean Paul verstand sich auf viele Kunstgriffe in den Künsten, aber er hatte keine Kunst (…), besaß Gefühl und Ernst, goß aber, wenn er davon zu kosten gab, eine widerliche Tränenbrühe darüber (…) Im ganzen war er das bunte starkriechende Unkraut, welches über Nacht auf den zarten Fruchtfeldern Schillers und Goethes aufschoß; er war ein bequemer guter Mensch, und doch ein Verhängnis – ein Verhängnis im Schlafrock.“[11] Das Verdikt war zwar ungerecht, aber es wirkte.
Jean Pauls Wiederentdeckung geschah durch Mitwirkung der Franzosen, besonders durch Madame de Stael, die 1810 die „Rede des toten Christus“ übersetzte und ihn damit für die französischen Romantiker bis hin zu Nerval, Baudelaire und sogar Lautreamont zu einem vielbewunderten Vorbild machte; in ihren Gedichten klingen die Blütenträume und Vernichtungsvisionen des divin allemand nach. Auf den Seher und Sprachzauberer Jean Paul wird dann am Beginn des 20. Jahrhunderts im George-Kreis zurückgegriffen. In seiner „zauberspiegelnden Poesie“ habe er unserer Sprache „die glühendsten Farben und tiefsten Klänge“ (Stefan George) gegeben. Wegen der offenen Form und des surrealistischen Zuschnitts seiner Romane konnte die literarische Avantgarde nach dem zweiten Weltkrieg an Jean Paul anknüpfen. Der schwer lesbare, aber für seine Bewunderer geniale Sonderling Arno Schmidt wirkte wie ein sinistrer Jean Paul des 20. Jahrhunderts. Zugleich wurde in den 70er-Jahren der politische Schriftsteller (durch Wolfgang Harich) wiederentdeckt und allzu gewagt für den Klassenkampf reklamiert. Bleibt zu hoffen, dass der Dichter, der im Titan „den deutschen Roman zu tragischer Größe gesteigert hatte und der entschlossener in die menschlichen Tiefenschichten eingedrungen war als je ein Autor vor ihm“ weiter seine Leser findet - Leser, die bereit sind, dem „Sprachmagier, der den Überschwang der Metaphernerfindung und die mächtige Rhetorik des Gefühls in die nuancierte und kontrollierte Beschwörung auch der komplexesten Gedankenzusammenhänge gewandelt hatte“[12] auf seinen Himmelsflügen und Seelenerkundungen zu folgen.
2. „Eine Art Idylle“ - Das Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal

„Wie war dein Leben und Sterben so sanft und meerstille, du vergnügtes Schulmeisterlein“. So beginnt einer der schönsten Jean Paul-Texte Das Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal, der in dem Roman Die unsichtbare Loge steht. Der Erzähler schildert kurz seine Kindheit und dann exemplarisch seine Schulausbildung[13], sein Verliebtsein und seine Hochzeit und schließlich in einem Sprung ans Lebensende Wutz letzte Tage. Die Erzählung endet mit seinem Sterben. Weil in dieser Idylle das Sterben gewichtig-ernst den letzten Teil des Büchleins bestimmt, ist es eben auch nur „eine Art Idylle.“
Die Lektüre des Büchleins kann auf zweierlei Weise geschehen – entweder liest man naiv über die schwierigen Stellen und Abschweifungen in Lawrence Sterne‘scher Manier hinweg und freut sich an dem Ergötzlichen, das man als Leser auch so, ohne Anmerkungs-und Erklärungsapparat, versteht. Und davon gibt es einiges, das zum Lachen und Schmunzeln verführt, zumal wenn man es vortrefflich vorgelesen bekommt, wie ich kürzlich in der Lengfeldschen Buchhandlung zu Köln am Rhein durch Dieter Hahn. Oder man geht an eine genaue Entschlüsselung des Textes, bei der aber die Lesefreude ein wenig verloren geht.
Da kann man als Leser von Wutz lernen, zum Beispiel, wie man einen schlechten Tag erträgt. Erste Regel: man freut sich auf etwas: „vor dem Aufstehen freu ich mich auf das Frühstück, den ganzen Vormittag aufs Mittagessen“ und so weiter, durchsetzt von Selbstermunterungen: „das hat meinem Wutz aber geschmeckt.“
Die zweite Regel, sogenannte „Hatztage“ auszuhalten, war „nicht Ergebung, die das unvermeidliche Übel aufnimmt, nicht Abhärtung, die das ungefühlte trägt, nicht die, Philosophie, die das verdünnte verdauet oder Religion, die das belohnte verwindet, sondern der Gedanke ans warme Bett wars.“ Dieser trägt Wutz durch den Tag. „Abends lieg ich auf alle Fälle, sie mögen mich den ganzen Tag zwicken und hetzen. wie sie wollen, unter meiner warmen Zudeck und drücke die Nase ruhig ans Kopfkissen, acht Stunden lang.“ Wenn er dann in der letzten Stunde eines solchen Leidenstages in sein Bett kroch, sagte er sich: „Siehst du Wutz, es ist doch vorbei.“ (I/1,431) Der Gedanke ans warme Bett als Trost – so kurz und praktisch kann eine Lebenskunst sein, über die heute dicke Bücher geschrieben werden.
Die kleine Wutz-Erzählung ist Teil des Romans Die unsichtbare Loge, und in diesem spielt das Thema des Todes eine wichtige Rolle, besonders in der Passage, in der Ottomar seinen Scheintod erzählt bis in die tristen Details seiner Aufbahrung. Die Idylle versetzt dieses Erlebnis in die Form eines theatralischen Berichts vom Sterben des Schulmeisterleins. „Um 11einhalb kamen Wutz beiden besten Jugendfreunde noch einmal vor sein Bett, der Schlaf und der Traum, um gleichsam von ihm Abschied zu nehmen.“ Das klingt tröstlich, doch das Sterben wird dann so genau und realistisch beschrieben, wie ein poetisches Sterbeprotokoll, das das Grauen des verlöschenden Lebens eindrücklich umkreist: „Der Tod schien mir meine Uhr zu stellen, ich hörte ihn den Menschen und seine Freuden käuen, und die Welt und die Zeit schien in einem Strom von Moder sich in den Abgrund hinabzubröckeln.“ (I/1,460) Der Erzähler versetzt sich in seiner Inszenierung des Todes in den Sterbenden und seine letzten Visionen: „ Der Lebensstrom nach seinem Kopfe wurde immer schneller und breiter (…) Es kam ihm vor, als sei er ein fliegender Taufengel an eine Dotterblumenkette gehangen (…) Gegen 4 Uhr morgens konnte er uns nicht mehr sehen, obgleich die Morgenröte in der Stube war, … endlich stürzte der Todesengel den blassen Leichenschauer auf sein Angesicht.“ (ebd)
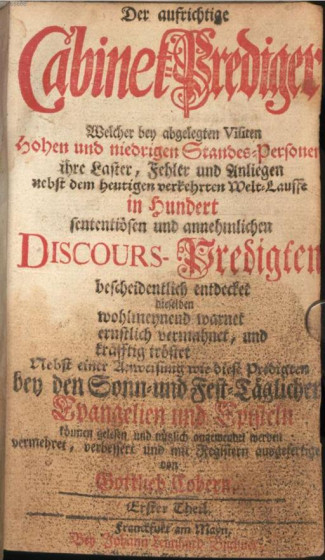 Der Erzähler verlässt das Sterbehaus, einerseits sucht er den Gestorbenen im endlosen Äther nur in einer Richtung (der der Unsterblichkeit der Seele), andererseits sieht er den Totengräber auf dem Gottesacker schon das Grab aushauen und hört das Leichenläuten, „so fühlt ich unser aller Nichts.“ Er stellt sich vor, wie er zu Wutzens „verraseten Grab“ geht, denkt an die Puppe des Nachtschmetterlings und zugleich „an das Lustlager bohrender Regenwürmer“, das der Begrabene auf den Hobelspänen nun abgibt und bricht in den Ruf aus: „Als er noch das Leben hatte, genoß er‘s fröhlicher wie wir alle.“ (I/1,462)
Der Erzähler verlässt das Sterbehaus, einerseits sucht er den Gestorbenen im endlosen Äther nur in einer Richtung (der der Unsterblichkeit der Seele), andererseits sieht er den Totengräber auf dem Gottesacker schon das Grab aushauen und hört das Leichenläuten, „so fühlt ich unser aller Nichts.“ Er stellt sich vor, wie er zu Wutzens „verraseten Grab“ geht, denkt an die Puppe des Nachtschmetterlings und zugleich „an das Lustlager bohrender Regenwürmer“, das der Begrabene auf den Hobelspänen nun abgibt und bricht in den Ruf aus: „Als er noch das Leben hatte, genoß er‘s fröhlicher wie wir alle.“ (I/1,462)
Aber auch dies Fröhlich-Idyllische ist eine sorgfältige Inszenierung, wie Martin Huber[14] gezeigt hat. Das Schulmeisterlein ist vergnügt. Als Junge hat er Vergnügen daran, der Magd Bußpredigten zu halten und seinem Vater aus Cobers Kabinettpredigten (einer damals populären Predigtsammlung) mit eigenen Interpolationen vorzulesen, was er dann später als Schulmeister nachmittags auch tat, wenn er den Kirchgängern die Postille an Pfarrers statt las, aber viel Eigenes hineinpackte. Selbermachen ist sein Motto.
Denn das Schulmeisterlein ist so arm, dass es sich keine Bücher kaufen kann, sondern „sich eigenhändig eine ganze Bibliothek“ schreiben musste. „Sein Schreibzeug war seine Taschendruckerei (…) Jedes neue Meßprodukt, dessen Titel das Meisterlein ansichtig wurde, war nun so geschrieben oder gekauft: denn es setzte sich sogleich hin und machte das Produkt und schenkte es seiner ansehnlichen Büchersammlung,“ (I/1,425f), etwa Lavaters Physiognomische Fragmente, Goethes Werthers Leiden oder den Messias Klopstocks. Wobei Jean Paul die Klopstocksche Unverständlichkeit dadurch karikiert, dass er Wutz seinen Messias so unleserlich schreiben lässt, dass man genau wie bei den Hexametern Klopstocks nichts versteht (I/1,440). Das ging so weit, dass er seine Handschriften bzw. Schreibbücher „für die kanonischen Urkunden hielt, und die gedruckten wären bloße Nachstiche seiner geschriebenen.“ Natürlich steckt hinter dieser Produktionsweise die Armut des Helden wie sein Originalitätsbedürfnis.
 Traumhaft schön ist der „elysäische Zwischenraum“ von acht Wochen zwischen seiner Schulmeisterprüfung und seiner Heirat mit seiner Braut Justine geschildert. „Für keinen Sterblichen fällt ein solches goldnes Alter von acht Wochen wieder vom Himmel, bloß für das Meisterlein funkelte der ganze niedergetauete Himmel auf gestirnten Auen der Erde. Du wiegtest im Äther dich und sahest durch die durchsichtige Erde dich rund mit Himmel und Sonne umzogen und hattest keine Schwere mehr.“ (I/1,439f) Himmel und Erde bietet der theatralische Poet Jean Paul auf, um die Glückseligkeit dieser zwei Monate in höchsten Tönen zu umschreiben, jenen Zustand zwischen Erwartung und Erfüllung, in dem die ganze Welt, Blumen, Blüten, Nachtigallen und Gestirne, die Nacht und ihre Träume mit Seligkeit erfüllen. „In seine Träume tönten die äußern Melodien herein, und in ihnen flog er über Blüten-Bäume, den die wahren vor seinem offenen Fenster ihren Blumen-Atem liehen. Der tagende Traum rückte ihn sanft, wie die lispelnde Mutter das Kind, aus dem Schlaf ins Erwachen hinüber, und er trat mit trinkender Brust in den Lärm der Natur hinaus, wo die Sonne die Erde von Neuem schuf und wo beide sich zu einem brausenden Wollust-Weltmeer ergossen.“ (I/1,440) Das ist so hymnisch-großartig wie der Beginn von Goethes Faust („Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang“) und ist doch zugleich idyllisch als Erfahrung der kleinen Leute geerdet, die daraus Kraft für ihren harten Alltag holen. Jean Paul zieht alle Register seiner literarisch-poetischen Bühnenregie, um den Leser wie einen Zuschauer am Glück seines Brautpaares teilhaben zu lassen. Noch eine Szene sei mitgeteilt, der Abendspaziergang mit seiner Justine, bei dem „zuletzt alles so feierlich wurde, als hätte die Erde selber einen Sonntag, in dem die Höhen und Wälder um diesen Zauberkreis rauchten.“ Die Sonne geht unter, der Mond zieht gen Mittag herauf und der Erzähler bricht in den Ruf aus: „O du Vater des Lichts! Mit viel Farben und Strahlen fassest du deine bleiche Erde ein! - Die Sonne kroch jetzt zu einem einzigen roten Strahle, der mit dem Widerscheine der Abendröte auf dem Gesicht der Braut zusammenkam; und diese, nur mit stummen Gefühlen bekannt, sagte zu Wutz, daß sie in ihrer Kindheit sich oft gesehnet hätte, auf den roten Bergen der Abendröte zu stehen und von ihnen mit der Sonne in die schönen rotgemalten Länder hinunterzusteigen, die hinter der Abendröte lägen.“ (I/1,445) Die Naivität dieser Sehnsucht seiner Braut rührt einem das Herz gerade in Zeitläuften, wo die Länder hinter der Abendröte längst zu unserem Reise-und Erfahrungsschatz gehören und wir doch oft nicht die Tiefe dieser Sehnsucht erreichen. (Später hat Caspar David Friedrich dieses Stehen vor der abendlichen Naturerscheinung in traumhaft schöne Bilder gebannt.) Und es geht ja noch weiter. Das Schulmeisterlein umarmt seine Braut heftig, wie lieb hab ich dich, ruft er, als es vom Fluss wie Flötengetön und Menschengesang erklingt. Es sang, und hier zitiert er die erste Strophe von Höltys Aufmunterung zur Freude: „‚O wie schön ist Gottes Erde / und wert drauf vergnügt zu sein. / Drum will ich, bis ich Asche werde / mich dieser schönen Erde freun.‘ Es war aus der Stadt eine Gondel mit einigen Flöten und singenden Jünglingen. Er und Justine wanderten am Ufer und hielten ihre Hände gefaßt und Justine suchte leise nachzusingen, mehre Himmel gingen neben ihnen. Als die Gondel um eine Erdzunge voll Bäume herumschiffte, hielt Justine ihn sanft an, damit sie nicht nachkämen, und da das Fahrzeug dahinter verschwunden war, fiel sie ihm mit dem errötenden Kusse um den Hals.“ Zarter, zärtlicher kann man den ersten Kuss nicht beschreiben. Das klingt wie in den empfindsamen Gedichten dieser Zeit, etwa Klopstocks Das Rosenband und ist doch als idyllische Szene stärker geerdet. Und wer kennt nicht diese Erfahrung eines vom Fluss oder dem Wege näher kommenden Gesangs, wenig ist schöner als bewegte, sich bewegende Musik. Und der Schluss dieser Szene ist wie das Anstimmen des Abendchorals Hinunter ist der Sonnen Schein. „Sie begleiteten und belauschten von weitem die schiffenden Töne; und Träume spielten um beide, als sie sagte: ‚Es ist spät und die Abendröte hat sich schon weit herumgezogen, und es ist im Dorfe alles still.‘ Sie gingen nach Hause; er öffnete das Fenster seiner mondhellen Stube und schlich mit einem leisen Gutenacht bei seiner Mutter vorüber, die schon schlief.“ (I/1,445f)
Traumhaft schön ist der „elysäische Zwischenraum“ von acht Wochen zwischen seiner Schulmeisterprüfung und seiner Heirat mit seiner Braut Justine geschildert. „Für keinen Sterblichen fällt ein solches goldnes Alter von acht Wochen wieder vom Himmel, bloß für das Meisterlein funkelte der ganze niedergetauete Himmel auf gestirnten Auen der Erde. Du wiegtest im Äther dich und sahest durch die durchsichtige Erde dich rund mit Himmel und Sonne umzogen und hattest keine Schwere mehr.“ (I/1,439f) Himmel und Erde bietet der theatralische Poet Jean Paul auf, um die Glückseligkeit dieser zwei Monate in höchsten Tönen zu umschreiben, jenen Zustand zwischen Erwartung und Erfüllung, in dem die ganze Welt, Blumen, Blüten, Nachtigallen und Gestirne, die Nacht und ihre Träume mit Seligkeit erfüllen. „In seine Träume tönten die äußern Melodien herein, und in ihnen flog er über Blüten-Bäume, den die wahren vor seinem offenen Fenster ihren Blumen-Atem liehen. Der tagende Traum rückte ihn sanft, wie die lispelnde Mutter das Kind, aus dem Schlaf ins Erwachen hinüber, und er trat mit trinkender Brust in den Lärm der Natur hinaus, wo die Sonne die Erde von Neuem schuf und wo beide sich zu einem brausenden Wollust-Weltmeer ergossen.“ (I/1,440) Das ist so hymnisch-großartig wie der Beginn von Goethes Faust („Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang“) und ist doch zugleich idyllisch als Erfahrung der kleinen Leute geerdet, die daraus Kraft für ihren harten Alltag holen. Jean Paul zieht alle Register seiner literarisch-poetischen Bühnenregie, um den Leser wie einen Zuschauer am Glück seines Brautpaares teilhaben zu lassen. Noch eine Szene sei mitgeteilt, der Abendspaziergang mit seiner Justine, bei dem „zuletzt alles so feierlich wurde, als hätte die Erde selber einen Sonntag, in dem die Höhen und Wälder um diesen Zauberkreis rauchten.“ Die Sonne geht unter, der Mond zieht gen Mittag herauf und der Erzähler bricht in den Ruf aus: „O du Vater des Lichts! Mit viel Farben und Strahlen fassest du deine bleiche Erde ein! - Die Sonne kroch jetzt zu einem einzigen roten Strahle, der mit dem Widerscheine der Abendröte auf dem Gesicht der Braut zusammenkam; und diese, nur mit stummen Gefühlen bekannt, sagte zu Wutz, daß sie in ihrer Kindheit sich oft gesehnet hätte, auf den roten Bergen der Abendröte zu stehen und von ihnen mit der Sonne in die schönen rotgemalten Länder hinunterzusteigen, die hinter der Abendröte lägen.“ (I/1,445) Die Naivität dieser Sehnsucht seiner Braut rührt einem das Herz gerade in Zeitläuften, wo die Länder hinter der Abendröte längst zu unserem Reise-und Erfahrungsschatz gehören und wir doch oft nicht die Tiefe dieser Sehnsucht erreichen. (Später hat Caspar David Friedrich dieses Stehen vor der abendlichen Naturerscheinung in traumhaft schöne Bilder gebannt.) Und es geht ja noch weiter. Das Schulmeisterlein umarmt seine Braut heftig, wie lieb hab ich dich, ruft er, als es vom Fluss wie Flötengetön und Menschengesang erklingt. Es sang, und hier zitiert er die erste Strophe von Höltys Aufmunterung zur Freude: „‚O wie schön ist Gottes Erde / und wert drauf vergnügt zu sein. / Drum will ich, bis ich Asche werde / mich dieser schönen Erde freun.‘ Es war aus der Stadt eine Gondel mit einigen Flöten und singenden Jünglingen. Er und Justine wanderten am Ufer und hielten ihre Hände gefaßt und Justine suchte leise nachzusingen, mehre Himmel gingen neben ihnen. Als die Gondel um eine Erdzunge voll Bäume herumschiffte, hielt Justine ihn sanft an, damit sie nicht nachkämen, und da das Fahrzeug dahinter verschwunden war, fiel sie ihm mit dem errötenden Kusse um den Hals.“ Zarter, zärtlicher kann man den ersten Kuss nicht beschreiben. Das klingt wie in den empfindsamen Gedichten dieser Zeit, etwa Klopstocks Das Rosenband und ist doch als idyllische Szene stärker geerdet. Und wer kennt nicht diese Erfahrung eines vom Fluss oder dem Wege näher kommenden Gesangs, wenig ist schöner als bewegte, sich bewegende Musik. Und der Schluss dieser Szene ist wie das Anstimmen des Abendchorals Hinunter ist der Sonnen Schein. „Sie begleiteten und belauschten von weitem die schiffenden Töne; und Träume spielten um beide, als sie sagte: ‚Es ist spät und die Abendröte hat sich schon weit herumgezogen, und es ist im Dorfe alles still.‘ Sie gingen nach Hause; er öffnete das Fenster seiner mondhellen Stube und schlich mit einem leisen Gutenacht bei seiner Mutter vorüber, die schon schlief.“ (I/1,445f)
3. Kindheitserinnerungen
 In der Selberlebensbeschreibung werden ähnlich ursprüngliche Kindheitserfahrungen in einer Dichte und Fülle beschrieben, dass man vor lauter Schönheiten nicht weiß, was zuerst oder später zu nennen. Da ist die erste Liebe zu Augustine, die die Kühe des Abends nach Haus trieb, deren Kuhglockenspiele ihn verzauberten und so das lebenslange akustische Signal des Verliebtseins blieben. Würde er diesen Klängen als alter Mann wiederbegegnen, er würde sagen: „Es sind Töne, von Windharfen herbei gespielt aus weiter Ferne, und ich möchte dabei weinen vor Lust.“ (I/6,1069) Die Liebe verzauberte ihm die Landschaften, die Sterne, die Blüten und Berge, „man nehme einem Menschen diese Liebe, so hat er die zehnte Muse verloren.“ Die Janitscharenmusik, die an den Markttagen durch die Hauptstraßen zog; „und Volk-und Kindertroß zog betäubt und betäubend den Klängen nach, und der Dorfsohn hörte zum ersten mal Trommeln und Querpfeifchen und Janitscharenbecken. In mir entstand ordentlich ein Tonrausch und ich hörte, wie der Betrunkene sieht, die Welt doppelt und im Fliegen“ (I/6,1079). Das Abendläuten als „Schwanengesangs des Tags“, abends draußen essen ohne Licht anzuzünden, die Gänge in tiefer Nacht, Geisterängste, die Kartoffel- und Nussernte, die Aberntung des Muskatellerbirnbaums durch den Vater, die Weihnachtsoper der Kinder und dazwischen die Armut, die die Jugend Jean Pauls prägte. In der Selberlebensbeschreibung schildert er den Besuch des Knaben bei der Patronatsherrschaft derer von Plotho in Zedwitz, schildert „das arme Dorfkind“, das in dem herrschaftlichen Garten mit seinen Laubengängen und Springbrunnen „mit gepreßter und gefüllter Brust umherwankte“ (I/6,1076). Er schildert den Besuch bei den Großeltern in Hof, der vor allem der materiellen Aufbesserung der Familie diente.
In der Selberlebensbeschreibung werden ähnlich ursprüngliche Kindheitserfahrungen in einer Dichte und Fülle beschrieben, dass man vor lauter Schönheiten nicht weiß, was zuerst oder später zu nennen. Da ist die erste Liebe zu Augustine, die die Kühe des Abends nach Haus trieb, deren Kuhglockenspiele ihn verzauberten und so das lebenslange akustische Signal des Verliebtseins blieben. Würde er diesen Klängen als alter Mann wiederbegegnen, er würde sagen: „Es sind Töne, von Windharfen herbei gespielt aus weiter Ferne, und ich möchte dabei weinen vor Lust.“ (I/6,1069) Die Liebe verzauberte ihm die Landschaften, die Sterne, die Blüten und Berge, „man nehme einem Menschen diese Liebe, so hat er die zehnte Muse verloren.“ Die Janitscharenmusik, die an den Markttagen durch die Hauptstraßen zog; „und Volk-und Kindertroß zog betäubt und betäubend den Klängen nach, und der Dorfsohn hörte zum ersten mal Trommeln und Querpfeifchen und Janitscharenbecken. In mir entstand ordentlich ein Tonrausch und ich hörte, wie der Betrunkene sieht, die Welt doppelt und im Fliegen“ (I/6,1079). Das Abendläuten als „Schwanengesangs des Tags“, abends draußen essen ohne Licht anzuzünden, die Gänge in tiefer Nacht, Geisterängste, die Kartoffel- und Nussernte, die Aberntung des Muskatellerbirnbaums durch den Vater, die Weihnachtsoper der Kinder und dazwischen die Armut, die die Jugend Jean Pauls prägte. In der Selberlebensbeschreibung schildert er den Besuch des Knaben bei der Patronatsherrschaft derer von Plotho in Zedwitz, schildert „das arme Dorfkind“, das in dem herrschaftlichen Garten mit seinen Laubengängen und Springbrunnen „mit gepreßter und gefüllter Brust umherwankte“ (I/6,1076). Er schildert den Besuch bei den Großeltern in Hof, der vor allem der materiellen Aufbesserung der Familie diente.
Einmal auf dem Nachhauseweg von den Großeltern folgende Erinnerung: „Noch erinnert er sich eines Sommertags, wo ihn ein noch unerlebtes gegenstandloses Sehnen überfiel, das aus fast lauter Pein und wenig Lust gemischt und ein Wünschen ohne Erinnern war. Ach, es war der ganze Mensch, der sich nach den himmlischen Gütern des Lebens sehnte, die noch unbezeichnet und farbelos im tiefen weiten Dunkel des Herzens lagen. Es gibt eine Zeit der Sehnsucht, wo ihr Gegenstand noch keinen Namen trägt und sie nur sich selber zu nennen vermag.“ (I/6,1077) Dieses gegenstandslose Sehnen als Jugenderfahrung kennen wir vielleicht alle. Immer mal wieder überfällt uns die Erinnerung daran. Jenes Gefühl von Heimat, worin man war und doch nicht war.
Mir geht es so, wenn ich mich an die Fahrt auf dem Heuwagen in dem ostfriesischen Dorf der Verwandten erinnere, wo ich im Sommer meine ersten Schulferien verbrachte. Noch sehe und vor allem fühle ich mich da sitzen hoch auf dem gelben Wagen. Oder ich erinnere mich an das Erlebnis eines kleinstädtischen Jahrmarktes, auf dem eine Artistentochter mich faszinierte - eine fremde Schöne. Noch immer leuchten in meiner Erinnerung die Bilder aus Peterchens Mondfahrt, als ich mich so mit den Kindern identifizierte, die dem armen Maikäfer auf der Suche nach seinem geraubten Beinchen halfen. Unvergesslich auch der Gang mit meiner siebenjährigen Tochter über die Felder im Abendsonnenschein im Wendland, auf dem sie das Gedicht Eichendorffs „Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküßt“ auswendig lernte. Noch höre ich den Wind durch die Felder gehen und zugleich die Stimme meiner kleinen Tochter, die das zitiert.
Auch Jean Paul verbindet das Sehnen vor allem mit dem Schein der Nachmittags- und Abendsonne: „So zauderte er mit der Heimkehr, bis die zerfließende Sonne durch die letzten Kornfelder mit Goldfäden, die sie gerade über die Ähren zog, sein blaues Röckchen stickte“, heißt es im Schulmeisterlein Wutz. So schön diese Passage klingt, sie ist zugleich ein bewusst berechnetes theatralisches Konstrukt des Schriftstellers.
Die Joditzer Zeit beschließt Jean Paul mit dem Lob des „Haus und Winkelsinns“ – in einem Rittersaal oder der Peterskirche könne er weder schreiben noch wohnen, wohl aber auf dem Montblanc oder dem Ätna, „denn nur das enge Menschliche kann ihm nicht klein genug, aber die weite Natur nicht zu ausgedehnt sein, denn die Kleinheit der Menschenwerke verkleinert sich durch sein Vergrößern.“ (I/6,1082) Die Selberlebensbeschreibung endet übrigens mit der Schilderung des ersten Abendmahls des Jungen. Besonders seine Bedingung, dass es unbußfertig genossen die Hölle statt des Himmels gebe, beeindruckt den Knaben zutiefst, treibt ihn zu Reu- und Bußübungen auf dem Dachboden, die auch den Seelenfrieden wieder einkehren lassen. Dann am Tag der ersten Austeilung stieg „die Seligkeit bis zum körperlichen Gefühls-Blitze der Wunder-Vereinigung.“ Er empfand „Liebe für alle, alle Menschen.“ Doch schon nach wenigen Tagen entweicht dies Gefühl, als er in „schuldloser Spiellust“ nach einem Schulkameraden mit einem Steine wirft und mit ihm ringt (I/6,1102f). Mir ging es nach der Konfirmation einmal ähnlich, als mir beim Abendmahl der Kelch vom Pfarrer derart gereicht wurde, dass ich nichts zu trinken bekam. Bin ich verworfen, fragte ich mich lange, bis ich endlich die Ungeschicklichkeit des Geistlichen dafür verantwortlich machen konnte. Erst später als Jüngling, so Jean Paul zum Schluss, habe ihn die Lektüre der alten Stoiker wieder in einen ähnlichen Geisteszustand heiterer Liebe versetzt.

4. Zum Schluss: Unsterblichkeit, Flüge im All und Humor
Hören wir Jean Paul in seinem „Traum über das All“ und die Unsterblichkeit, er steht in dem letzten Roman Der Komet aus dem Jahr 1820[15]. Er träumt, er fliegt mit einer blitzenden Geistgestalt wie ein heutiger Astronaut durch das All, fliegt durch ein Meer von immer neuen Sonnenozeanen.
„Aber siehe, auf einmal erschien der Himmel über uns ausgeleert, kein Sternchen blinkte in der reinen Finsternis. Zuletzt gingen auch alle Sternhimmel hinter uns in einen dünnen Nebel zurück und schwanden auch dahin. Und ich dachte, das All hat sich doch geendigt- und nun erschrak ich vor dem grenzenlosen Nachtkerker der Schöpfung, der hier seine Mauer anfing, vor dem toten Meer des Nichts, in dessen bodenloser Finsternis der Edelstein des lichten All zuletzt unaufhörlich untersank. Da antwortetet die blitzende Gestalt meiner stummen Angst: ‚Kleingläubiger! Blick auf! Das uralte Licht kommt an.‘ Ich blickte auf, schnell kam eine Dämmerung, schnell eine Milchstraße, schnell ein ganzes schimmerndes Sternengewölbe. Seit grauen Jahrtausenden war das Sternenlicht auf dem Weg zu uns gewesen und kam aus den unergründlichen Höhen endlich an. Nun flogen wir, wie durch ein neues Jahrhundert, durch neue Sternenkugel.“ (I/6,684)
 Trotzdem kann der Träumer seine Angst vor der Leere des Alls nicht beschwichtigen. Da berührt ihn die Geistgestalt und spricht sanfter als bisher: „Vor Gott besteht keine Leere; um die Sterne, zwischen den Sternen wohnt das rechte All. Aber dein Geist verträgt nur irdische Bilder des Überirdischen. Schaue die Bilder!“ (I/6,685).
Trotzdem kann der Träumer seine Angst vor der Leere des Alls nicht beschwichtigen. Da berührt ihn die Geistgestalt und spricht sanfter als bisher: „Vor Gott besteht keine Leere; um die Sterne, zwischen den Sternen wohnt das rechte All. Aber dein Geist verträgt nur irdische Bilder des Überirdischen. Schaue die Bilder!“ (I/6,685).
Und der Träumer begreift langsam: „die Unsterblichkeit wohnte in den ungeheuren Räumen des Alls, der Tod nur auf den Welten“. „Auf den Sonnen gingen aufrechte Schatten in Menschengestalt“, „die dunkeln Wandelsterne waren nur Wiegen für die Kindergeister im lichten All“. „Vor der lebendigen Unermeßlichkeit kann es keinen großen Schmerz mehr geben, nur eine Wonne ohne Maß und ein Freudengebet.“ Und er wacht auf und dankt dem Schöpfer „für das Leben auf der Erde und für das künftige ohne sie.“ (I/6,686)
Sicher, das ist vor allem ein poetischer Unsterblichkeitstraum, der Angst vor der Vernichtung abgerungen. „Kleingläubiger blick auf, das uralte Licht kommt an.“ Dieses Gefühl kann die heutige Astrophysik, so gewaltig ihre Leistungen in der Erkundung eines unendlichen Universums sind, nicht zerstören. Sicher, das Himmelsdach ist weg. Wir Erdenbewohner sind nur Partikel in einem explodierenden Universum. Unsere kosmische Bedeutungslosigkeit ist evident. Aber wir können diese Situation erfassen und poetisch aushalten.
Mit Jean Paul muss man sagen: es geht nicht nur um Demut vor dem unfassbar großen Universum, sondern um eine erneuerte Weltliebe. Zwischen Lerchenflug und der Ackerfurche muss sich der Dichter bewegen. Das Gefühl der Vernichtung verwandelt sich in ein neues Weltverhältnis. Angesichts des ungeheuren Raums wird gerade die Verantwortung für das Kleine und Gefährdete wieder wichtig, das Einnisten in die Ackerfurche. Kant nennt es das moralische Gesetz in mir. Also aus dem Gefühl der Vernichtung und Beseligung hinaus müssen wir zu einer neuen Bodenhaftung für diese eine Welt kommen, die einzige, die wir als ihre Bewohner haben.
Zu der Spiegelung der Barmherzigkeit Gottes gehört auch Jean Pauls Humor, Humor als eine Weise, eine nichtperfekte Welt und widersprüchliche Mitmenschen lachend auszuhalten. Zum Beispiel im Siebenkäs die Szene, als sich der Advokat über den Lärm beschwert, den seine kleinbürgerliche Frau Lenette beim ständigen Hausputz macht.[16] Er könne dabei nicht arbeiten. Endlich hört sie auf. Doch da ist es ihm nach einiger Zeit zu still im Haus. Was arbeitest du nicht, ruft er aus. Oder die herrliche Szene mit dem Morgenkaffee, der Siebenkäs von Lenette ans Bett gebracht wird, weil er morgens im Bett die besten Gedanken und Einfälle hat. Den sie aber ankündigen soll, damit er seine Einfälle nicht vergisst. Was schließlich dazu führt, dass sie den Morgenkaffee schon mitten in der Nacht ankündigt.
Oder aus Des Feldpredigers Attila Schmelzles Reise nach Fläz, geschrieben in der Zeit der napoleonischen Kriege um 1806.[17] Ein ängstlicher Feldprediger begibt sich auf eine kleine Reise und trifft dabei alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen. So hat er große Angst vor Gewittern, so dass er selbst bei schönstem Wetter stets mit einem Flanellschirm mit Blitzableiter spazieren ging, denn Gewitter können bekanntlich aus heiterem Himmel kommen. In der Postkutsche fordert er angesichts eines heranziehenden Gewitters die Mitreisenden auf, allen Edelmetallschmuck, den sie an und mit sich tragen, auf dem Boden der Kutsche abzulegen, weswegen er von ihnen als Räuber verdächtigt wird. Der begleitende Dragoner soll etwaige Blitze mit seinem Säbel nach unten ableiten. Auch hat er Angst, schlafzuwandeln und sich dabei zu Tode zu stürzen, weswegen er sich zu Hause nachts immer mit einem Bindfaden am großen Zeh seiner Frau anbindet. Was soll er auf der Reise allein im Gasthaus tun? Er bindet sich am Bettpfosten fest!
Anmerkungen
[1] S. dazu H.-J. Benedict, Barmherzigkeit und Diakonie. Von der rettenden Liebe zum gelingenden Leben, Stuttgart 2008, bes. S. 9-41
[2] Fritz Martini, Deutsche Literaturgeschichte, Stuttgart o.J., 295
[3] Norbert Miller, Jean Paul versus Goethe, in: Jean Paul, Sämtliche Werke hg.v. N. Miller, München 1959 Abtlg. II / Bd. 4, 464.
[6] Jean Paul, Über Charlotte Corday, zuerst 1801, dann in Dr. Katzenbergers Badereise in: I/6, 332f.
[9] Zit. Miller, aaO, 485
[11] zit. Miller, aaO, 491
[13] Jean Paul, Sämtliche Werke, hg.v. N. Miller, München 1959, Bd I/1,428-461. Alle Zitate und Verweise im Text aus dieser Ausgabe.
[14] Martin Huber, Der Text als Bühne. Zu Jean Pauls Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz, 11.6.2004 , in: Goethezeitportal.
[15] Jean Paul, Sämtliche Werke, Abtlg I/6, 682-686, daraus die folgenden Zitate und Verweise im Text.
[16] Jean Paul, Sämtliche Werke, Abtlg I/2, 7ff
[17] Jean Paul, Sämtliche Werke, Abtlg I/6, 7-76

 Nach meinem Verständnis besteht die Herrlichkeit Gottes vor allem in seiner Barmherzigkeit. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist“, mahnt Jesus seine Jünger (Lk 6,36). Diese Barmherzigkeit meint nicht nur die barmherzigen Taten
Nach meinem Verständnis besteht die Herrlichkeit Gottes vor allem in seiner Barmherzigkeit. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist“, mahnt Jesus seine Jünger (Lk 6,36). Diese Barmherzigkeit meint nicht nur die barmherzigen Taten Jean Pauls Wendung zum detailgenauen Romancier geschieht in den Jahren nach der Französischen Revolution; diese hat er als geschichtlich notwendig gesehen, auch wenn der die Gräueltaten der Jakobinerherrschaft verurteilte, bis hin zu einer ethisch gewagten Rechtfertigung des Mords an Marat durch Charlotte Corday
Jean Pauls Wendung zum detailgenauen Romancier geschieht in den Jahren nach der Französischen Revolution; diese hat er als geschichtlich notwendig gesehen, auch wenn der die Gräueltaten der Jakobinerherrschaft verurteilte, bis hin zu einer ethisch gewagten Rechtfertigung des Mords an Marat durch Charlotte Corday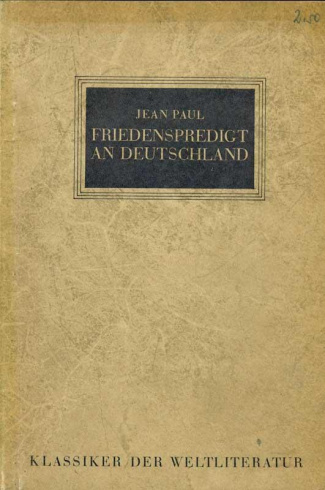 Doch dann nach dem rasanten Aufstieg Napoleons und seiner Eroberung halb Europas, nach dem Tod Schillers (1805) und nach der Niederlage Preußens bei Jena und Auerstädt (1806) wird erstaunlicherweise nicht Goethe, sondern Jean Paul der Trostschriftsteller Deutschlands in den Jahren der französischen Besatzung. 1808 erschien die Friedenspredigt für Deutschland, 1809 die Dämmerungen für Deutschland. Es sind mutige Stellungnahmen gegen das herrschende Unrecht und besonnene Appelle zum Widerstand. Jean Paul wird als politischer Schriftsteller wahrgenommen, während seine literarische Wirkung eher der Vergangenheit angehört. „Jean Paul wird in diesen Jahren, statt Goethe, zum Idealbild des Dichters, der als Mahner und Prophet seinem Volk Halt gibt und Zuversicht.“
Doch dann nach dem rasanten Aufstieg Napoleons und seiner Eroberung halb Europas, nach dem Tod Schillers (1805) und nach der Niederlage Preußens bei Jena und Auerstädt (1806) wird erstaunlicherweise nicht Goethe, sondern Jean Paul der Trostschriftsteller Deutschlands in den Jahren der französischen Besatzung. 1808 erschien die Friedenspredigt für Deutschland, 1809 die Dämmerungen für Deutschland. Es sind mutige Stellungnahmen gegen das herrschende Unrecht und besonnene Appelle zum Widerstand. Jean Paul wird als politischer Schriftsteller wahrgenommen, während seine literarische Wirkung eher der Vergangenheit angehört. „Jean Paul wird in diesen Jahren, statt Goethe, zum Idealbild des Dichters, der als Mahner und Prophet seinem Volk Halt gibt und Zuversicht.“

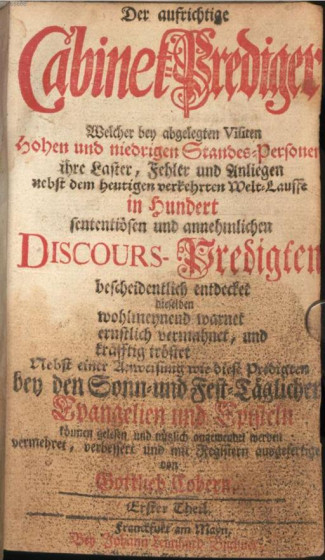 Der Erzähler verlässt das Sterbehaus, einerseits sucht er den Gestorbenen im endlosen Äther nur in einer Richtung (der der Unsterblichkeit der Seele), andererseits sieht er den Totengräber auf dem Gottesacker schon das Grab aushauen und hört das Leichenläuten, „so fühlt ich unser aller Nichts.“ Er stellt sich vor, wie er zu Wutzens „verraseten Grab“ geht, denkt an die Puppe des Nachtschmetterlings und zugleich „an das Lustlager bohrender Regenwürmer“, das der Begrabene auf den Hobelspänen nun abgibt und bricht in den Ruf aus: „Als er noch das Leben hatte, genoß er‘s fröhlicher wie wir alle.“ (I/1,462)
Der Erzähler verlässt das Sterbehaus, einerseits sucht er den Gestorbenen im endlosen Äther nur in einer Richtung (der der Unsterblichkeit der Seele), andererseits sieht er den Totengräber auf dem Gottesacker schon das Grab aushauen und hört das Leichenläuten, „so fühlt ich unser aller Nichts.“ Er stellt sich vor, wie er zu Wutzens „verraseten Grab“ geht, denkt an die Puppe des Nachtschmetterlings und zugleich „an das Lustlager bohrender Regenwürmer“, das der Begrabene auf den Hobelspänen nun abgibt und bricht in den Ruf aus: „Als er noch das Leben hatte, genoß er‘s fröhlicher wie wir alle.“ (I/1,462) Traumhaft schön ist der „elysäische Zwischenraum“ von acht Wochen zwischen seiner Schulmeisterprüfung und seiner Heirat mit seiner Braut Justine geschildert. „Für keinen Sterblichen fällt ein solches goldnes Alter von acht Wochen wieder vom Himmel, bloß für das Meisterlein funkelte der ganze niedergetauete Himmel auf gestirnten Auen der Erde. Du wiegtest im Äther dich und sahest durch die durchsichtige Erde dich rund mit Himmel und Sonne umzogen und hattest keine Schwere mehr.“ (I/1,439f) Himmel und Erde bietet der theatralische Poet Jean Paul auf, um die Glückseligkeit dieser zwei Monate in höchsten Tönen zu umschreiben, jenen Zustand zwischen Erwartung und Erfüllung, in dem die ganze Welt, Blumen, Blüten, Nachtigallen und Gestirne, die Nacht und ihre Träume mit Seligkeit erfüllen. „In seine Träume tönten die äußern Melodien herein, und in ihnen flog er über Blüten-Bäume, den die wahren vor seinem offenen Fenster ihren Blumen-Atem liehen. Der tagende Traum rückte ihn sanft, wie die lispelnde Mutter das Kind, aus dem Schlaf ins Erwachen hinüber, und er trat mit trinkender Brust in den Lärm der Natur hinaus, wo die Sonne die Erde von Neuem schuf und wo beide sich zu einem brausenden Wollust-Weltmeer ergossen.“ (I/1,440) Das ist so hymnisch-großartig wie der Beginn von Goethes Faust („Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang“) und ist doch zugleich idyllisch als Erfahrung der kleinen Leute geerdet, die daraus Kraft für ihren harten Alltag holen. Jean Paul zieht alle Register seiner literarisch-poetischen Bühnenregie, um den Leser wie einen Zuschauer am Glück seines Brautpaares teilhaben zu lassen. Noch eine Szene sei mitgeteilt, der Abendspaziergang mit seiner Justine, bei dem „zuletzt alles so feierlich wurde, als hätte die Erde selber einen Sonntag, in dem die Höhen und Wälder um diesen Zauberkreis rauchten.“ Die Sonne geht unter, der Mond zieht gen Mittag herauf und der Erzähler bricht in den Ruf aus: „O du Vater des Lichts! Mit viel Farben und Strahlen fassest du deine bleiche Erde ein! - Die Sonne kroch jetzt zu einem einzigen roten Strahle, der mit dem Widerscheine der Abendröte auf dem Gesicht der Braut zusammenkam; und diese, nur mit stummen Gefühlen bekannt, sagte zu Wutz, daß sie in ihrer Kindheit sich oft gesehnet hätte, auf den roten Bergen der Abendröte zu stehen und von ihnen mit der Sonne in die schönen rotgemalten Länder hinunterzusteigen, die hinter der Abendröte lägen.“ (I/1,445) Die Naivität dieser Sehnsucht seiner Braut rührt einem das Herz gerade in Zeitläuften, wo die Länder hinter der Abendröte längst zu unserem Reise-und Erfahrungsschatz gehören und wir doch oft nicht die Tiefe dieser Sehnsucht erreichen. (Später hat Caspar David Friedrich dieses Stehen vor der abendlichen Naturerscheinung in traumhaft schöne Bilder gebannt.) Und es geht ja noch weiter. Das Schulmeisterlein umarmt seine Braut heftig, wie lieb hab ich dich, ruft er, als es vom Fluss wie Flötengetön und Menschengesang erklingt. Es sang, und hier zitiert er die erste Strophe von Höltys Aufmunterung zur Freude: „‚O wie schön ist Gottes Erde / und wert drauf vergnügt zu sein. / Drum will ich, bis ich Asche werde / mich dieser schönen Erde freun.‘ Es war aus der Stadt eine Gondel mit einigen Flöten und singenden Jünglingen. Er und Justine wanderten am Ufer und hielten ihre Hände gefaßt und Justine suchte leise nachzusingen, mehre Himmel gingen neben ihnen. Als die Gondel um eine Erdzunge voll Bäume herumschiffte, hielt Justine ihn sanft an, damit sie nicht nachkämen, und da das Fahrzeug dahinter verschwunden war, fiel sie ihm mit dem errötenden Kusse um den Hals.“ Zarter, zärtlicher kann man den ersten Kuss nicht beschreiben. Das klingt wie in den empfindsamen Gedichten dieser Zeit, etwa Klopstocks Das Rosenband und ist doch als idyllische Szene stärker geerdet. Und wer kennt nicht diese Erfahrung eines vom Fluss oder dem Wege näher kommenden Gesangs, wenig ist schöner als bewegte, sich bewegende Musik. Und der Schluss dieser Szene ist wie das Anstimmen des Abendchorals Hinunter ist der Sonnen Schein. „Sie begleiteten und belauschten von weitem die schiffenden Töne; und Träume spielten um beide, als sie sagte: ‚Es ist spät und die Abendröte hat sich schon weit herumgezogen, und es ist im Dorfe alles still.‘ Sie gingen nach Hause; er öffnete das Fenster seiner mondhellen Stube und schlich mit einem leisen Gutenacht bei seiner Mutter vorüber, die schon schlief.“ (I/1,445f)
Traumhaft schön ist der „elysäische Zwischenraum“ von acht Wochen zwischen seiner Schulmeisterprüfung und seiner Heirat mit seiner Braut Justine geschildert. „Für keinen Sterblichen fällt ein solches goldnes Alter von acht Wochen wieder vom Himmel, bloß für das Meisterlein funkelte der ganze niedergetauete Himmel auf gestirnten Auen der Erde. Du wiegtest im Äther dich und sahest durch die durchsichtige Erde dich rund mit Himmel und Sonne umzogen und hattest keine Schwere mehr.“ (I/1,439f) Himmel und Erde bietet der theatralische Poet Jean Paul auf, um die Glückseligkeit dieser zwei Monate in höchsten Tönen zu umschreiben, jenen Zustand zwischen Erwartung und Erfüllung, in dem die ganze Welt, Blumen, Blüten, Nachtigallen und Gestirne, die Nacht und ihre Träume mit Seligkeit erfüllen. „In seine Träume tönten die äußern Melodien herein, und in ihnen flog er über Blüten-Bäume, den die wahren vor seinem offenen Fenster ihren Blumen-Atem liehen. Der tagende Traum rückte ihn sanft, wie die lispelnde Mutter das Kind, aus dem Schlaf ins Erwachen hinüber, und er trat mit trinkender Brust in den Lärm der Natur hinaus, wo die Sonne die Erde von Neuem schuf und wo beide sich zu einem brausenden Wollust-Weltmeer ergossen.“ (I/1,440) Das ist so hymnisch-großartig wie der Beginn von Goethes Faust („Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang“) und ist doch zugleich idyllisch als Erfahrung der kleinen Leute geerdet, die daraus Kraft für ihren harten Alltag holen. Jean Paul zieht alle Register seiner literarisch-poetischen Bühnenregie, um den Leser wie einen Zuschauer am Glück seines Brautpaares teilhaben zu lassen. Noch eine Szene sei mitgeteilt, der Abendspaziergang mit seiner Justine, bei dem „zuletzt alles so feierlich wurde, als hätte die Erde selber einen Sonntag, in dem die Höhen und Wälder um diesen Zauberkreis rauchten.“ Die Sonne geht unter, der Mond zieht gen Mittag herauf und der Erzähler bricht in den Ruf aus: „O du Vater des Lichts! Mit viel Farben und Strahlen fassest du deine bleiche Erde ein! - Die Sonne kroch jetzt zu einem einzigen roten Strahle, der mit dem Widerscheine der Abendröte auf dem Gesicht der Braut zusammenkam; und diese, nur mit stummen Gefühlen bekannt, sagte zu Wutz, daß sie in ihrer Kindheit sich oft gesehnet hätte, auf den roten Bergen der Abendröte zu stehen und von ihnen mit der Sonne in die schönen rotgemalten Länder hinunterzusteigen, die hinter der Abendröte lägen.“ (I/1,445) Die Naivität dieser Sehnsucht seiner Braut rührt einem das Herz gerade in Zeitläuften, wo die Länder hinter der Abendröte längst zu unserem Reise-und Erfahrungsschatz gehören und wir doch oft nicht die Tiefe dieser Sehnsucht erreichen. (Später hat Caspar David Friedrich dieses Stehen vor der abendlichen Naturerscheinung in traumhaft schöne Bilder gebannt.) Und es geht ja noch weiter. Das Schulmeisterlein umarmt seine Braut heftig, wie lieb hab ich dich, ruft er, als es vom Fluss wie Flötengetön und Menschengesang erklingt. Es sang, und hier zitiert er die erste Strophe von Höltys Aufmunterung zur Freude: „‚O wie schön ist Gottes Erde / und wert drauf vergnügt zu sein. / Drum will ich, bis ich Asche werde / mich dieser schönen Erde freun.‘ Es war aus der Stadt eine Gondel mit einigen Flöten und singenden Jünglingen. Er und Justine wanderten am Ufer und hielten ihre Hände gefaßt und Justine suchte leise nachzusingen, mehre Himmel gingen neben ihnen. Als die Gondel um eine Erdzunge voll Bäume herumschiffte, hielt Justine ihn sanft an, damit sie nicht nachkämen, und da das Fahrzeug dahinter verschwunden war, fiel sie ihm mit dem errötenden Kusse um den Hals.“ Zarter, zärtlicher kann man den ersten Kuss nicht beschreiben. Das klingt wie in den empfindsamen Gedichten dieser Zeit, etwa Klopstocks Das Rosenband und ist doch als idyllische Szene stärker geerdet. Und wer kennt nicht diese Erfahrung eines vom Fluss oder dem Wege näher kommenden Gesangs, wenig ist schöner als bewegte, sich bewegende Musik. Und der Schluss dieser Szene ist wie das Anstimmen des Abendchorals Hinunter ist der Sonnen Schein. „Sie begleiteten und belauschten von weitem die schiffenden Töne; und Träume spielten um beide, als sie sagte: ‚Es ist spät und die Abendröte hat sich schon weit herumgezogen, und es ist im Dorfe alles still.‘ Sie gingen nach Hause; er öffnete das Fenster seiner mondhellen Stube und schlich mit einem leisen Gutenacht bei seiner Mutter vorüber, die schon schlief.“ (I/1,445f) In der Selberlebensbeschreibung werden ähnlich ursprüngliche Kindheitserfahrungen in einer Dichte und Fülle beschrieben, dass man vor lauter Schönheiten nicht weiß, was zuerst oder später zu nennen. Da ist die erste Liebe zu Augustine, die die Kühe des Abends nach Haus trieb, deren Kuhglockenspiele ihn verzauberten und so das lebenslange akustische Signal des Verliebtseins blieben. Würde er diesen Klängen als alter Mann wiederbegegnen, er würde sagen: „Es sind Töne, von Windharfen herbei gespielt aus weiter Ferne, und ich möchte dabei weinen vor Lust.“ (I/6,1069) Die Liebe verzauberte ihm die Landschaften, die Sterne, die Blüten und Berge, „man nehme einem Menschen diese Liebe, so hat er die zehnte Muse verloren.“ Die Janitscharenmusik, die an den Markttagen durch die Hauptstraßen zog; „und Volk-und Kindertroß zog betäubt und betäubend den Klängen nach, und der Dorfsohn hörte zum ersten mal Trommeln und Querpfeifchen und Janitscharenbecken. In mir entstand ordentlich ein Tonrausch und ich hörte, wie der Betrunkene sieht, die Welt doppelt und im Fliegen“ (I/6,1079). Das Abendläuten als „Schwanengesangs des Tags“, abends draußen essen ohne Licht anzuzünden, die Gänge in tiefer Nacht, Geisterängste, die Kartoffel- und Nussernte, die Aberntung des Muskatellerbirnbaums durch den Vater, die Weihnachtsoper der Kinder und dazwischen die Armut, die die Jugend Jean Pauls prägte. In der Selberlebensbeschreibung schildert er den Besuch des Knaben bei der Patronatsherrschaft derer von Plotho in Zedwitz, schildert „das arme Dorfkind“, das in dem herrschaftlichen Garten mit seinen Laubengängen und Springbrunnen „mit gepreßter und gefüllter Brust umherwankte“ (I/6,1076). Er schildert den Besuch bei den Großeltern in Hof, der vor allem der materiellen Aufbesserung der Familie diente.
In der Selberlebensbeschreibung werden ähnlich ursprüngliche Kindheitserfahrungen in einer Dichte und Fülle beschrieben, dass man vor lauter Schönheiten nicht weiß, was zuerst oder später zu nennen. Da ist die erste Liebe zu Augustine, die die Kühe des Abends nach Haus trieb, deren Kuhglockenspiele ihn verzauberten und so das lebenslange akustische Signal des Verliebtseins blieben. Würde er diesen Klängen als alter Mann wiederbegegnen, er würde sagen: „Es sind Töne, von Windharfen herbei gespielt aus weiter Ferne, und ich möchte dabei weinen vor Lust.“ (I/6,1069) Die Liebe verzauberte ihm die Landschaften, die Sterne, die Blüten und Berge, „man nehme einem Menschen diese Liebe, so hat er die zehnte Muse verloren.“ Die Janitscharenmusik, die an den Markttagen durch die Hauptstraßen zog; „und Volk-und Kindertroß zog betäubt und betäubend den Klängen nach, und der Dorfsohn hörte zum ersten mal Trommeln und Querpfeifchen und Janitscharenbecken. In mir entstand ordentlich ein Tonrausch und ich hörte, wie der Betrunkene sieht, die Welt doppelt und im Fliegen“ (I/6,1079). Das Abendläuten als „Schwanengesangs des Tags“, abends draußen essen ohne Licht anzuzünden, die Gänge in tiefer Nacht, Geisterängste, die Kartoffel- und Nussernte, die Aberntung des Muskatellerbirnbaums durch den Vater, die Weihnachtsoper der Kinder und dazwischen die Armut, die die Jugend Jean Pauls prägte. In der Selberlebensbeschreibung schildert er den Besuch des Knaben bei der Patronatsherrschaft derer von Plotho in Zedwitz, schildert „das arme Dorfkind“, das in dem herrschaftlichen Garten mit seinen Laubengängen und Springbrunnen „mit gepreßter und gefüllter Brust umherwankte“ (I/6,1076). Er schildert den Besuch bei den Großeltern in Hof, der vor allem der materiellen Aufbesserung der Familie diente.
 Trotzdem kann der Träumer seine Angst vor der Leere des Alls nicht beschwichtigen. Da berührt ihn die Geistgestalt und spricht sanfter als bisher: „Vor Gott besteht keine Leere; um die Sterne, zwischen den Sternen wohnt das rechte All. Aber dein Geist verträgt nur irdische Bilder des Überirdischen. Schaue die Bilder!“ (I/6,685).
Trotzdem kann der Träumer seine Angst vor der Leere des Alls nicht beschwichtigen. Da berührt ihn die Geistgestalt und spricht sanfter als bisher: „Vor Gott besteht keine Leere; um die Sterne, zwischen den Sternen wohnt das rechte All. Aber dein Geist verträgt nur irdische Bilder des Überirdischen. Schaue die Bilder!“ (I/6,685).