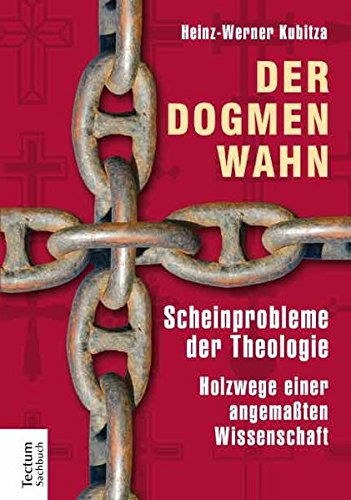Die Stadt und der Tod ... |
Dogmenwahn?Eine RezensionHorst Schwebel „Dogmenwahn“ ist das dritte Buch, in welchem Heinz-Werner Kubitza seine atheistische Grundposition entfaltet. Vorausgegangen sind „Der Jesuswahn. Wie Christen sich ihren Gott erschufen. Die Entzauberung der Welt durch die wissenschaftliche Forschung“ (2011) und „Verführte Jugend. Eine Kritik am Jugendkatechismus Youcat. Vernünftige Antworten auf katholische Fragen“ (2012). Heinz-Werner Kubitza, geb. 1961, ist Doktor der Theologie und leitet den von ihm gegründeten Tectum-Verlag. Der in Marburg ansässige Wissenschaftsverlag hat seit 2011 eine eigene Sparte „Religionskritik und Humanismus“. Sich mit Kubitza auseinander zu setzen, ist nicht einfach, zumal Kubitza auf dem Feld historisch-kritischer Forschung auf dem neuesten Stand ist. Nicht nur weiß er, dass beim Jahweglauben der Monotheismus die letzte Phase in der Entwicklung des einstigen Berg- und Wettergottes ist. Er kennt auch die archäologischen Belege, die Jahwe eine Aschera, ein weibliches Pendant, an die Seite stellen. Das Beharren auf Jahwe war für das Volk Israel nach Kubitza jedoch eine einzige Verlustgeschichte. Trotz fulminanter Versprechungen habe sie von Niederlage zu Niederlage und schließlich zum Verlust von Tempel und Land geführt. Es sei die Diskrepanz zwischen den als Illusion eingestuften Glaubensvorstellungen und den harten historischen Fakten, die nach Kubitza zu einem unerträglichen Aufwand an Dogmenkonstruktionen geführt haben. So habe der bescheidene Auftritt des galiläischen Wanderpredigers Jesus nach dessen Tod zu einer zweiten Karriere als Gott bis in die zweite Person der Trinität geführt. Inkarnation und Satisfaktionslehre, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt habe, um am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben, ist mit all ihrem Begleitwerk für Kubitza ein „Wahngebilde“, bei dessen dogmatischer Ausformulierung auch Herrschaftsinteressen im Spiel waren. Mag Kubitza den über Konzilien aufgebauten Dogmenapparat bis in die zeitgenössischen Dogmatiken attackieren, so hält er selbst an einem Dogma unumstößlich fest: Es gibt keinen Gott. Theologie an einer staatlichen Universität kann nur ein „Parasit“ sein. Die Theologie ist nach Kubitza eine Wissenschaft ohne Gegenstand, weil ihr Gegenstand, nämlich Gott, nicht existiert. Ob Gott existiert oder nicht existiert, lässt sich wissenschaftlich freilich nicht beweisen. Mit welcher Methode sollte das zu bewerkstelligen sein? - Doch was macht Kubitza in seinem Nein so sicher? Was das Auftreten von Religion betrifft, lässt sich doch nicht bestreiten, dass sie von Anbeginn menschlicher Geschichte völkerübergreifend bis auf den heutigen Tag eine wichtige Rolle gespielt hat. Zu allen Zeiten wurden Menschen von der Gottesfrage in Bewegung gesetzt, was zu Taten von unvergleichlicher Güte und Milde, aber auch zu solchen von unvergleichlicher Ignoranz, Intoleranz und Grausamkeit führte. Schaut man bloß auf die Wirkungsgeschichte, so hat Theologie sehr wohl einen Gegenstand. Dieser Einspruch soll aber nicht davon abhalten, zumindest einigen wenigen von Kubitzas Kritikpunkten unser Augenmerk zuzuwenden. Beispielsweise nimmt Kubitza daran Anstoß, dass im Gefolge von Karl Barth zwar jede Form von Religion abgelehnt wird, das Christentum hiervon aber ausgenommen ist: denn der christliche Glaube ist nicht Religion, sondern die Selbstoffenbarung Gottes (Gott hat es so gefallen, Gott hat sich selbst festgelegt, dass . . .). Mit einer solchen Offenbarungskeule ist freilich kein Gespräch mit anderen Positionen mehr möglich. Erschwerend kommt hinzu, wenn die Protagonisten anderer Religionen mit einem ähnlichen Offenbarungsanspruch auftreten. Dem Wandel vom Wanderprediger zum Gott war bereits das erste von Kubitzas christentumskritischen Schriften gewidmet („Der Jesuswahn“, 2011). Im „Dogmenwahn“ erhält diese Kritik noch eine Vertiefung. Dabei nähert er sich der Kritik der Liberalen Theologie, vor allem Adolf von Harnack, an, der die konziliare Dogmenentwicklung für einen Fehler hielt und ein dogmenfreies Christentum forderte? Wenn es das geben kann, ein von hellenistischem Denken befreites Christentum, wäre so manchem anstößigen, nicht mehr nachvollziehbaren Dogmenkonstrukt der Boden unter den Füßen entzogen. Wenn beispielsweise in der Inkarnation der platonisch-plotinische Gott Mensch werden muss, bewegt man sich innerhalb einer Weltsicht, die nicht nur zeitgenössisch nicht mehr nachvollziehbar ist, sondern die auch mit dem Ursprungsgeschehen des Christentums nichts zu tun hat. (Zum Zölibat scheint sie indes wundervoll zu passen!) Öffnet man dann noch den Blick in die Weite des Universums, dann sind der Gottesbund mit Israel, Inkarnation und der stellvertretende Sühnetod für die Sünden der Menschen als historisch lokalisierbares Randproblem auf einem mittelgroßen Planeten schlechterdings nicht mehr vermittelbar. Bei aller an den Dogmatikern von Kubitza vorgebrachten Kritik sollte nicht unterschlagen werden, welchem Schwierigkeitsgrad diese Personen ausgesetzt sind. Zum einen ist es das Ziel, das Evangelium in seiner Tiefe zu erfassen und es in Zeitgenossenschaft glaubwürdig und redlich zu vermitteln. Zum anderen hat das Christentum eine nahezu 2000jährige Geschichte und beruft sich dabei auf alte Schriften, bei denen zum Teil noch einmal 1000 Jahre hinzugelegt werden müssen. Mag der Philosoph für sich selbst und seine Zeit sprechen, so steht der Theologe vor dem Problem, angesichts des geschichtlichen Wandels und den damit verbundenen veränderten Weltbildern und Wahrheitsansprüchen einen Abgleich finden zu müssen. Hierbei haben sich ganz bestimmte Denkstile und Argumentationsmuster entwickelt, die, wenn wie bei Kubitza auf engstem Raum vereinigt, sich als exotisches Blumengebinde mit höchst eigenartigen Pflanzen entpuppen. Mit Verwunderung stellt Kubitza beispielsweise fest, wie bei ernsten Fragen wie der nach der Bestimmung des Menschen die ganze Argumentationslast auf einem mythisch-poetischen Text ruht und wie eine liebenswerte biblische Metapher das Gewicht kantischer Stringenz zugewiesen bekommt. Schließlich soll noch ein Problem angesprochen werden, das genau genommen nichts mit den Dogmen oder gar dem Dogmenwahn zu tun hat, gleichwohl aber für das Verhältnis vom Christentum zur Aufklärung und den bürgerlichen Freiheitsrechten von Bedeutung ist. Auf Seite 66 schreibt Kubitza: „Betrachtet man heutige Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und Freiheitsrechte, Toleranz und Gleichberechtigung, die eine moderne Gesellschaft bestimmen (sollten), dann muss man feststellen, dass eben diese Werte in der mittelalterlichen Vorherrschaft des Christentums über 1000 Jahre keine Rolle gespielt haben, im Gegenteil. Diese Werte konnten erst durchgesetzt werden, nachdem der Einfluss des Christentums zurückgedrängt worden ist, und sie wurden vielfach gegen Christentum und Kirche zur Geltung gebracht.“ - Demgegenüber gibt es die Position, die die Rede vom „dunklen Mittelalter“ bestreitet, gar von einer über das Christentum erfolgten „Verzauberung“ und von den Klöstern als der „Wiege der abendländischen Kultur“ spricht. Die Frage, um die es hier geht, überschreitet freilich das Format einer Buchrezension. Dennoch seien einige Anmerkungen hierzu erlaubt, zumal der Rezensent auch andernorts damit beschäftigt ist. Als im Jahr 380 das Christentum Staatsreligion wurde, bedeutete dies das Ende der antiken Kultur. Die Theater wurden geschlossen, die Bibliotheken aufgelöst und die Tempel mit ihren Statuen und Bildwerken zerstört. Der in Trier lebende Ausonius, der letzte römische Dichter, sprach in Trauer vom „Sterben der Musen“. Bei der Auflösung der Akademie in Alexandria wurde die Philosophin Hypathia vom Mönchsmob gelyncht und ihr toter Körper durch die Stadt geschleift. Weniger als 1 Prozent antiker Literatur hat in den Klöstern, der „Wiege abendländischer Bildung“, Aufnahme gefunden. Die Bildkunst des Mittelalters, sofern man bereit ist, sich dieses Begriffs zu bedienen, war einzig von der christlichen Thematik bestimmt, wobei zu Anfang die Gerichts- und Apokalypse-Thematik überwog, bis dann im Hoch- und im Spätmittelalter der Bereich des Humanum mit Leiden, Schmerz, Trauer, Freundschaft, Mutterschaft, Liebe, freilich noch immer über die biblische Geschichte vermittelt, hinzutrat. Von hier an könnte man von einem Prozess der Kultivierung und Humanisierung sprechen, wobei freilich Natur, Körper und die irdische Sinnenfreude angesichts einer noch immer auf Tod und Ewigkeit ausgerichteten Sichtweise ausgeblendet wurden. Kubitza ist zuzustimmen, wenn er sagt, dass sich die Vorstellung von Aufklärung, Demokratie und Menschenrechten erst zu jener Zeit durchsetzen konnten, als das Christentum auf dem Rückzug war. Aber ohne die Vorstellung vom Menschen als „Ebenbild Gottes“ wäre dies wohl nicht möglich gewesen. Vieles bleibt ambivalent; aber im weltgeschichtlichen Maßstab sind die Staat und Gesellschaft prägenden freiheitlichen Errungenschaften auf dem Boden des Christentums verwirklicht worden. Man wird dem Christentum eine gewisse Affinität zu Freiheit und Bildung nicht absprechen können. Zu Recht verweisen Kubitza und seine Mitstreiter von der Giordano-Bruno-Stiftung auf die Kämpfe hin, die gegen das Christentum ausgetragen werden mussten. Hierzu gehören auch die verhängnisvollen Irrationalismen, die in den Hexenverfolgungen und -verbrennungen ihren Niederschlag gefunden haben. Es gab und gibt Segensreiches, aber ebenso Ignoranz, Wahn und Grausamkeit. Dass sich das Christentum, auch in Gestalt seiner Dogmengebilde, einer von der Aufklärung entgegengebrachten Kritik stellen sollte, ist unbestreitbar. Dennoch mag die Frage erlaubt sein, ob nicht auch die Aufklärung ebenfalls bereit sein sollte, sich einer Metakritik zu stellen. Die Gefahr einer Absolutsetzung der eigenen Position betrifft nämlich nicht allein das Christentum. Die erwünschte Metakritik wäre dann die Wahrnehmung einer „Dialektik der Aufklärung“. Oder mit den Worten von Blaise Pascal: "Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point“. (Das Herz hat Gründe (des raisons), die die Vernunft (la raison) überhaupt nicht kennt) |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/101/hs20.htm |