
Die Stadt und der Tod ... |
Dies ist keine RezensionEin Seufzer über Dietmar Daths Roman „Leider bin ich tot“Wolfgang Vögele
Dieser Roman hat nur einen anonymen Verfasser. Ob dieser Verfasser Dietmar Dath ist, da bin ich mir nicht sicher, denn unter „Hinweis und Dank“ auf Seite 364 heißt es: „Dietmar Dath gibt es überhaupt nicht.“ Das könnte sich darauf beziehen, dass der Verfasser, wie zum Beispiel Michel Houellebecq in seinem Roman „Karte und Gebiet“, im Buch selbst auftritt und sich an einer Recherche beteiligt. Anders als Houellebecq, der in seinem eigenen Roman umgebracht wird, spielt Dath in seinem Werk nur eine Nebenrolle. Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek tritt auch auf, aber er redet nicht viel, was wiederum unglaubwürdig wirkt. Wenn man nach der Lektüre von Daths Roman eines sagen kann, dann dieses: Kein Leser wird bei diesem Roman auf die Idee kommen, Wirklichkeit und Fiktion miteinander zu verwechseln. Der Suhrkamp Verlag, den es in Berlin wirklich gibt, macht seinen Lesern, die es auch geben soll, auf der Umschlagrückseite den Roman mit folgenden Worten schmackhaft: „Dietmar Daths provokanter und verblüffender Roman über Religion – eine Meditation über den Glauben und das Böse, über die Zeit, denkende Winde, Komplexitätstheorie und die Schuld der Väter.“ Jeder Abiturient weiß, dass man als Leser keinem Wort, das auf den vier Umschlagseiten steht, Glauben schenken soll. Ich habe es dennoch getan und bin prompt hereingefallen. Dieses ist kein Buch über Religion, obwohl darin ein Pfarrer, katholische Geheimbündler, ein „Funktionär“ der EKD, eine „Prophetin“, eine Heavy Metal Band und islamistisches Terroristenpärchen vorkommen. Dietmar Dath mag das für Religion halten, obwohl auf der schon erwähnten Seite 364 seines Romans behauptet: „Der Verfasser glaubt an nichts Übernatürliches außerhalb der Kunst (aber er glaubt natürlich an die Kunst).“
Der klerikale EKD-Funktionär gefällt sich in oberflächlich geschäftiger Boshaftigkeit. Er wird so charakterisiert: „Ludger Schlegel war Aufregendem bis jetzt aus dem Weg gegangen. Mitte dreißig, dicklich, bärtig, Stirnglatze, verheiratet, zwei Kinder. Schlegel wollte nichts anderes sein als ein deutscher evangelischer Journalist.“ (S. 107) Was bin ich als Rezensent froh, dass ich keinen Bart mehr trage. – Eine andere Figur, ein Pfarrer, der nur deshalb Theologie studiert hat, weil er sich mit seinem Vater auseinandersetzen wollte, kommt wegen eines Totschlags auf einem Flughafen ins Gefängnis und gewinnt danach keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Er wird zum Obdachlosen. Seine Geschichte ist vermischt mit einer Vielzahl anderer Geschichten, die alle auf geheimnisvolle Weise miteinander zusammenzuhängen scheinen. Aber niemand betet. Niemand meditiert. Niemand predigt. Niemand denkt theologisch nach. Allen ist gemeinsam, dass Religion nur als Mittel zum Zweck von etwas anderem dient.
Die Geschichten von allen Protagonisten sind auf komplizierte Weise miteinander verschachtelt. Dath springt in der Zeit, tut alles, um den chronologischen Ablauf der Geschehnisse möglichst zu verwischen. Man bemerkt, hinter dieser Erzählhaltung steht eine Absicht, die aber nicht auf eine religiöse Haltung hinausläuft, sondern auf die Kritik an einem Wirklichkeitsverständnis, das alle Begebenheiten in ein Schema von Ursache und Wirkung auflöst. Nicht zufällig sagt ausgerechnet Abel, der erfolgreiche schwule Jungregisseur: „Wir glauben nicht, was das schlechte traditionelle Erzählen glaubt. Dass man die Sachen auf eine Perlenschnur gezogen kriegt. Das Grundprinzip ist: Ein Nacheinander gibt es nicht. Niemals.“ (S. 28) Das lineare Erzählen zielt auf chronologische Abfolgen und auf logische Kausalketten. Das nicht-lineare Erzählen des Verfassers Dietmar Dath zielt auf eine angedeutete, schwammig-neblige Philosophie der Synchronizität. Zeit kann angeblich nach vorne in die Zukunft und nach hinten in die Vergangenheit laufen. Eine andere Figur aus Daths Roman präzisiert das später: „Die Zeit, die nicht Vergangenheit ist und nicht Zukunft. Du weißt doch: Das Grundprinzip ist, wir glauben nicht, dass man die Sachen auf die Perlenschnur gezogen kriegt. Das Grundprinzip ist, wir wissen: Niemals nacheinander, Vergangenheit und Zukunft gibt es allerdings trotzdem. Bloß die Reihenfolge steht nicht fest. Jedenfalls nicht auf der lokalen Kurve.“ (S. 255) Und beim dritten Mal noch eine weitere Erläuterung: „Es ist wie … wir sind ja alle auf dem Erdboden, und wir denken, er ist flach. Dabei ist er gebogen. Eine Kugel. Aber aus der Nähe sieht er halt flach aus. So ist das auch mit der Geschichte. Aus der Nähe gibt es immer gerade Linien von Ursache zu Wirkung oder vorher bis nachher, und die Sachen sind ja auch wirklich verbunden, nur eventuell eben nicht flach und gerade. Man kann da durchaus zwischendurch an sich selbst irre werden.“ (S. 302) In dieser Richtung sieht Dath die Religion, aber das bleibt alles verwaschen, suggestiv, schemenhaft. Der Autor macht sich eine Freude daraus, den Lesern in seiner verworrenen Geschichte immer wieder den Boden unter den Füßen hinwegzuziehen. Der Autor scheint sich als eine Art Mischung aus einem Schelm, einem Philosophen und einem FAZ-Redakteur zu verstehen. Heraus kommt eine sonderbare Mischung aus Ironie, sokratischer Hebammen-Kunst und enzyklopädischem Archivwissen, mit der der Leser über vierhundert Seiten lang berieselt wird, in allen literarischen Tonarten von albern bis ernst. Das geschieht in einer Sprache, die sich in auffälligen Metaphern gefällt. Ein Beispiel: „Vergilbte Schurken, die beieinander hockten wie Kalkdämonen auf Kirchenzinnen, grinsten tödlich. Kurts Kniegelenke schmerzten.“ (S. 76) Meine Kniegelenke schmerzen auch, wenn ich solche Vergleiche lese. Aber später im Buch ist es dann nicht mehr so schlimm. Ich gestehe gerne, dass mich dieser Roman ratlos zurückgelassen hat. Eine Geschichte ist es nicht. Eine Geschichte über Religion ist es schon gar nicht. Vielleicht ist es eine Meditation über eine neue Metaphysik, die Politisches, New-Age-Haftes miteinander vereint, und all das rieselt wie ideologisch-philosophisch-erzähltheoretisch-religiöses Konfetti ins Bewusstsein des Lesers, der nach einer gewissen Zeit dann doch lieber in seine eigene Gedankenwelt und vor allem Gegenwart hineindämmert. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/101/wv026.htm |
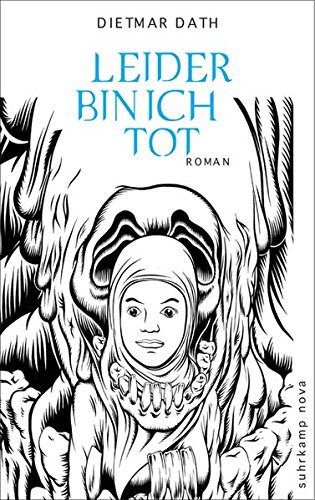

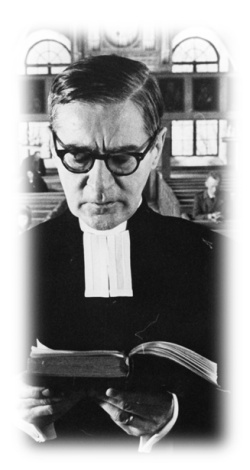 Das mag auch damit zusammenhängen, dass einem die Figuren des von Dath entworfenen Romanspiels nicht richtig lebendig, eher hölzern und konstruiert vorkommen. Sie sind blasse Wände, an denen gelbe Stichwortzettel für Weltanschauung und Habitus kleben: schwuler Filmregisseur, lesbische Regieassistentin, Pfarrer, der seine Gemeinde aufgibt, Kriminalbeamter beim BKA. All diesen Figuren fehlen Persönlichkeit, Psychologie und Tiefgang. Nur ihre Stichworte haben sie perfekt auswendig gelernt und geben sie bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zum Besten. Die Figuren bleiben flach und papieren – wie in einem sehr mäßigen „Tatort“ am Sonntagabend.
Das mag auch damit zusammenhängen, dass einem die Figuren des von Dath entworfenen Romanspiels nicht richtig lebendig, eher hölzern und konstruiert vorkommen. Sie sind blasse Wände, an denen gelbe Stichwortzettel für Weltanschauung und Habitus kleben: schwuler Filmregisseur, lesbische Regieassistentin, Pfarrer, der seine Gemeinde aufgibt, Kriminalbeamter beim BKA. All diesen Figuren fehlen Persönlichkeit, Psychologie und Tiefgang. Nur ihre Stichworte haben sie perfekt auswendig gelernt und geben sie bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zum Besten. Die Figuren bleiben flach und papieren – wie in einem sehr mäßigen „Tatort“ am Sonntagabend.