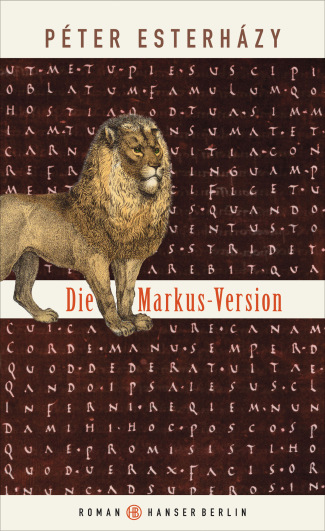Vita brevis ars longa |
Predigt des LöwenÜber Péter Esterházys Roman „Die Markus-Version“Wolfgang Vögele Vor dem Anfang – Post mortem
Es gibt übrigens auch einen protestantischen Ernst, allerdings vielleicht nicht in Ungarn. Esterházy liebte es, mit Worten und Ironie zu spielen. Daraus entstanden Romane, Erzählungen und Essays. Esterházys Tod ist für die Literatur des krisengeschüttelten Europa ein kaum abzuschätzender Verlust. So groß die Trauer über seinen Tod ist, so sehr lohnt sich die Lektüre seiner Romane. Einer davon, der zuletzt auf Deutsch erschienene, soll hier vorgestellt werden. Predigt und RomanUm den Rezensionsteil abzukürzen: Péter Esterházy hat einen außerordentlich lesenswerten kurzen Roman geschrieben, voller Ironie und Weisheit. Das Buch ist zu empfehlen. Viel interessanter als die Rezensionsempfehlung ist jedoch die Frage nach dem Umgang des Autors mit den biblischen Geschichten des Markusevangeliums. Diese häufigen Rückbezüge machen den Roman vergleichbar, und es stellt sich die Frage: Wie unterscheidet sich Esterházys Umgang mit dem Markusevangelium von der Predigt des Pfarrers, der seiner Predigt eine Perikope aus dem Evangelium zugrunde legt? Pfarrer und Autor kombinieren parallel biblische Textstücke mit Lebensgeschichte, Erzählungen, Lesererwartungen und Deutungen. Wo aber sind die Unterschiede? Üblicherweise steuern Predigten auf ein vorhersehbares Ende zu. Sie werden von einem sanften, frommen Schluss her konzipiert. Die Zuhörer in den Kirchenbänken wissen, worauf die geistliche Rede hinausläuft. Predigten können ihren Anfang bei noch so ungewöhnlichen Dingen nehmen, am Ende landen sie bei Jesus Christus, der Gnade Gottes, der Gegenwart des Geistes und beim Segen. In einem bestimmten Sinn ist dagegen ja auch gar nichts zu sagen. Ich sage das trotzdem durchaus selbstkritisch: Wer jeden Sonntag die Kanzel betritt und nicht viel Zeit zum Vorbereiten gefunden hat, der verlässt sich auf seine Lieblingsideen, genauso wie er an der Tankstelle im Vorbeifahren zuverlässig seinen Lieblingsschokoriegel kauft. Auf lange Sicht erhält diese rituelle Verbindung von Lieblingsideen und Vorhersehbarkeit etwas störend Langweiliges, aber die Hörer unter der Kanzel nehmen das in der Regel mit einer Selbstverständlichkeit hin, über die sie sich keine Gedanken mehr machen. So richtig scheint sich daran niemand zu stören. Auch die meisten Krimis enden ganz selbstverständlich mit der Überführung des Täters, das gehört zum formgeschichtlichen Schema eines Krimis einfach dazu[3]. Wer als Autor dieses vorgegebene Schema durchbricht, der irritiert seine Leser. Es stört das Gerechtigkeitsempfinden, wenn der Täter am Ende nicht entlarvt oder nicht bestraft wird, wenn er vielleicht sogar entkommt – falls nicht klar ist, daß er dafür in der nächsten Folge der Serie umso sicherer dingfest gemacht wird. Ein wenig von solcher Irritation würde gelegentlich auch einer Predigt guttun, die Abweichung vom Normalen, Selbstverständlichen, Gewohnten. Es muss ja nicht gerade die seichte Poesie der Predigt-Slammer sein, die ihrerseits schon wieder zum Klischee erstarrt ist. Romane teilen nicht diese Tendenz zur Vorhersehbarkeit. Ohne ein zwingendes Moment des Überraschenden, Unvorhersehbaren funktionieren Romane nicht. Ihr formgeschichtliches Schema ist offener gefasst als das von Predigten. Romane erzählen eine oder mehrere Geschichten, sie nehmen sich einen Anfang, aber das Ende bleibt lange offen. Der Held des Romans kann sterben, kann Reichtum erwerben, kann heiraten, kann resignieren und vieles andere mehr. Das macht den Plot eines Romans gerade spannend, dass das Ende der Geschichte den Leser überrascht. Der ungewöhnliche Anfang macht den Roman interessant, das ungewöhnliche Ende verblüfft die Leser. Der Roman lebt von seinem ungewissen Ausgang. Genau deshalb wird der Leser zum Roman greifen, um von einer Geschichte überrascht zu werden. Ein voraussehbares Ende langweilt die Leser.
Der Schriftsteller Péter Esterházy überrascht seine Leser mit Schalk und Ironie – und mit dem Markusevangelium. Im Erzählen der „Markus-Version“ provoziert der ungarische Autor damit, dass er immer wieder Passagen des Evangeliums in die Geschichte des Romans einblendet. Diese literarische Operation legt den Vergleich mit einer Predigt nahe. Wobei zu beachten ist: Esterházys Roman kann nicht als eine verborgene Predigt verstanden werden, denn der Autor erzählt nicht, um dem Leser heimlich irgendeine evangelische Botschaft nahezubringen. Vielmehr nimmt Esterházy das Markusevangelium als Biographie ernst. Er scheut sich nicht, nach Parallelen und Antithesen zwischen dem Jesus des Löwen-Evangeliums und dem Leben seines Protagonisten zu suchen. Im Fall der Verkündigung ordnet sich der Prediger der Geschichte aus dem Evangelium unter, im Fall von Esterházys Roman ordnet sich das Evangelium der Biographie ein, von der der Autor erzählt. Der stumme KnabeUnd er erzählt die Geschichte eines vermeintlich taubstummen Jungen im sozialistischen Ungarn der fünfziger Jahre. Vielleicht besitzt die Geschichte autobiographische Hintergründe. Um den Roman zu verstehen, ist Gewissheit darüber aber nicht zwingend notwendig. Die Familie des Jungen - Vater, Mutter, Bruder, Großmutter - sie muss von der Stadt aufs Land ziehen, eine repressive Zwangsmaßnahme. Der Dorfpolizist überwacht die Abweichler. Die Großmutter bringt den Kindern das Beten bei, liest ihnen biblische Geschichten vor und erinnert immer wieder an den Gott, dem sie glaubt. Es ist ein Gott, der vor allem Gebete erhört. Esterházy ist ein Spieler mit Worten, er weicht die Härte der Wirklichkeit auf, indem er sich mit Ironie und Witz an ihr reibt und indem er beständig Jesusworte und -geschichten in die mehr als hundert höchstens seitenlangen Kapitel einschmuggelt, alle wie bereits erwähnt aus dem Markusevangelium. Der Autor vermeidet das lineare, chronologische Erzählen, er wechselt beständig und verwirrend die Zeitebenen, und die Leser folgen ihm dabei manchmal atemlos, manchmal lächelnd. Das evangelische Symbol für das Markusevangelium ist der Löwe, zugleich das Wappentier Venedigs, dessen Schutzpatron Markus im gleichnamigen Dom als Heiliger verehrt wird. Der Löwe Markus beißt die Wirklichkeit der fünfziger Jahre in Ungarn.
So beginnt der kurze Roman. Worte sind das Thema, im Modus des Sprechens, das der namenlose erzählende Junge lange verweigert, aber noch sehr viel mehr im Modus des Betens. Der angeblich taubstumme Junge hat ein feines Gespür für Sprache, Worte und Formulierungen. Und er nimmt genau wahr, was um ihn herum geschieht. Er fügt sich das, was um ihn herum geschieht, zu einer geschmeidigen, auf Veränderung bedachten Weltanschauung zusammen. Er denkt nach über das Sprechen, das Beten, das Schweigen, die Stille. Er will sich Bildung und Erziehung nicht aufdrängen lassen, sondern nur das an- und aufnehmen, was er vorher bedacht hat.
Die GroßmutterEs ist die Großmutter, die dem Enkel das Beten beibringt, obwohl sie mit Gott hadert, seit sie ihren Sohn im Krieg verlor.
Dieses Programm kommt einer Predigt schon sehr nahe: von Gott so erzählen, dass man es gar nicht anders denken kann. Die Großmutter ist aus Gründen, die der erzählende Enkel verstehen will, so sehr von Gott überzeugt, dass sie gar nicht anders kann, als auch ihren Enkeln diese Gewissheit beizubringen und weiter zu vermitteln. Das Leid, das sie erlebt hat, konnte sie nicht von ihrem Glauben abbringen. Die Großmutter predigt, ohne eine offiziell berufene Predigerin zu sein. Sie predigt im übrigen einzig und allein ihrem Enkel. Und sie predigt, ohne diesem ihren Glauben aufzudrängen. Die Großmutter ist im Leben des Enkels die weise alte Frau, der er mehr Autorität zubilligt als seinen streitenden Eltern. An ihr orientiert er sich; sie führt ihn geduldig und unaufdringlich ins Leben ein. Darin erinnert diese ungarische Großmutter an die sehr viel berühmtere französische Großmutter des Erzählers in Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, für die der berühmte Glockenturm der Kirche von Combray so etwas wie der Leuchtturm war, der ihre Werte, ihre Einstellung und ihren Habitus symbolisierte. Bei Esterhàzy ist die Großmutter die Lehrerin, die den kleinen Jungen mit dem Beten zu Gott bekanntmacht. Der kleine Junge betet ohne Worte, überhaupt beobachtet er seine Umwelt nur, er hört nur zu und antwortet nicht, weil er sich nicht überrumpeln lassen will. Der stumme Junge wird zum Beter, weil er sich nicht auf frommes Geschwätz einlässt. Er plappert nicht beim Beten. Und er lauscht, ob er selbst diesen Gott hört, den Großmutter offensichtlich bei ihrem Gebet wahrnimmt.
Trotz des gewaltsamen Todes ihres Sohnes hat sich die Großmutter eingefunden in eine charakteristische Konstellation von Glauben und Vertrauen. Man spürt ihr an, dass sie daraus lebt. Der Junge, dem sie von Gott erzählt, will dieses Gottesprogramm ausprobieren. Er will testen, ob er diesen Weg auch gehen, seiner Großmutter nachfolgen kann. Die Großmutter ist die mythische Figur des Glaubens in der Geschichte, unbeirrbar und in sich selbst ruhend. Sie hat ihre Entscheidung getroffen und geht beständig in die Richtung, die sie ursprünglich einmal eingeschlagen hat. Die Kirche im Übrigen taucht in der praktischen Frömmigkeit der Großmutter nicht auf: kein Priester, keine Messe, keine Kommunion, selbstverständlich auch keine klerikalen Funktionäre. Es geht Esterházy nur um die psychologische Aura der Großmutter, die in sich selbst und in ihrem Verhältnis zu Gott ruht. Und deswegen ist diese Großmutter zu bewundern: vor allem die Gelassenheit und die Ruhe, mit der sie sich von keinem Sozialisten und keinem trinkenden Schwiegersohn beirren läßt. Das „Gebet“ der Großmutter ist ein Habitus, mit dem sie dem Leben begegnet. Sie lebt aus der Grundannahme: Es gibt einen gnädigen und barmherzigen Gott. Wenn Katastrophen geschehen, muss der Beter das Leid aushalten und die Warum-Frage zurückstellen. Er muss Trauer aushalten und sich zähmen. In diese Haltung hat sich die Großmutter hineingebetet. Der kleine Junge prüft, ob ihm diese Haltung helfen kann.
GottesprogrammDie Großmutter erzählt dem Jungen von Gott, dem Vater und seinem gekreuzigten Sohn, von dem Vater im Himmel und von Jesus von Nazareth auf der Erde. Im Hören auf ihre Erzählungen zimmert sich der Junge ein kindliches Weltbild zurecht, eine großmütterliche Metaphysik, zugleich naiv und theologisch hoch reflektiert. Das, was der Junge und die Großmutter von Gott erzählen, ist mit der harmlosen Wolkentheologie des lieben Gottes, auf den sich viele Prediger versteifen, nicht zu vergleichen. Die Theologie, die der kleine Junge entwickelt, ist sensibel für die Theodizeefrage:
Der Junge ist fasziniert von den Fragen, die sich aus den theologischen Erzählungen der Großmutter ergeben. Er wird eingenordet auf den grundlegenden Unterschied zwischen Gottes Güte und irdischem Leiden. Das bleibt das theologische Rätsel, dem er sich sein ganzes Leben hindurch verpflichtet fühlt. Irgendwann erleidet die Großmutter einen Schlaganfall, später stirbt sie, und damit stellt sich für den Jungen die Frage nach Gott mit neuer Dringlichkeit. Mit dieser Wendung beginnen dann die längeren Zitate aus dem Markusevangelium. Der schweigende Knabe hat sich in die Stille zurückgezogen. Dass er nicht spricht, heißt nicht, dass er nichts versteht. Seine Großmutter hat ihn in Theologie und Philosophie eingeführt, und in dieser Stille lässt der Junge Fragen und Antworten in sich wachsen. Die Stille, die ihn umgibt, ist wie ein Gewächshaus, in dem sich seine Gedanken langsam entwickeln. Und der Junge entdeckt im Markusevangelium Konflikte, Streit, Folter, Weinen, Kampf, Trotz, Barmherzigkeit, Frechheit, Liebe, Gewalt. Er entdeckt in der Lebensgeschichte des Markusevangeliums seine eigene Lebensgeschichte. Man kann das für vermessen halten, aber dem Jungen hilft es, den schweigenden Gott auszuhalten. AnfängeEsterházys Roman endet nicht grundlos mit dem – modifizierten - Anfang des Markusevangeliums.
So endet der kurze Roman, und das ist sozusagen die kleinstmögliche Form der Theologie: Es gibt kein Ende. Es gibt immer noch einen Anfang. Vorsichtiger formuliert: Es könnte noch einen weiteren Anfang geben. Wir können uns nicht sicher sein. Esterházy holt das Markusevangelium zurück in den Bereich des Menschlichen. Sein geschichtsphilosophisches Programm besteht darin, dass er für jede Katastrophe die Möglichkeit eines Trotzdem, eines Neuanfangs nicht ausschließt. Wenn dieser Jesus des Markusevangeliums über den Tod hinaus strebt und Markus von seiner Auferstehung erzählt, dann könnte das auch für die sterbende Großmutter mit ihrem Schlaganfall gelten, für dauernd betrunkene Väter und für zankhaft atheistische Mütter. Esterházy deutet an, dass der erwachsene Junge, der früher stumm war, in seinem späteren Leben ganz anders über Gott und die Welt denkt. An keiner Stelle kippt der Roman in eine Predigt um. Den Talar hat Esterházy nicht angezogen. Das theologische Programm wird immer wieder durch Ironie und Sarkasmus gebrochen. Der Leser kann sich nie ganz sicher sein. Sicher ist nur der Anfang des Jungen: Bei der glaubenden Großmutter hat er angefangen, sich Gedanken über das Beten zu machen. Und an diesen Anfang seines Lebens mit der betenden Großmutter wird er sich immer wieder erinnern. Geistesblitze |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/102/wv25.htm |
 Während ich an diesem Essay schrieb, kam die traurige Nachricht über den Ticker, dass der ungarische Schriftsteller Péter Esterházy am 14.Juli 2016 einem Krebsleiden erlegen ist. Was ihn ausmachte, kann man mehr noch als an vielen Nachrufen an seiner Rede
Während ich an diesem Essay schrieb, kam die traurige Nachricht über den Ticker, dass der ungarische Schriftsteller Péter Esterházy am 14.Juli 2016 einem Krebsleiden erlegen ist. Was ihn ausmachte, kann man mehr noch als an vielen Nachrufen an seiner Rede