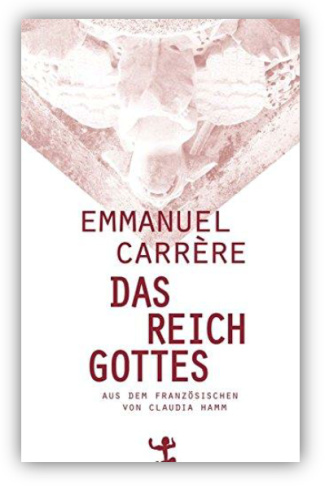Mit Kunst ... ? |
Das Reich GottesVon einem französischen Zweifler betrachtetWolfgang Vögele
Als ich den dicken Band in der Buchhandlung aus dem Regal, Abteilung Romane nahm und zur Kasse trug, zögerte ich noch.[1] Handelte es sich um einen Roman mit integrierten theologischen Abhandlungen oder ein Sachbuch mit Elementen eines Tagebuchs? Oder war das, noch schlimmer, ein Bekenntnisbericht? Das flüchtige Durchblättern der Seiten ergab keinen richtigen Aufschluss. Ich ließ mich dennoch nicht von meinen Zweifeln abschrecken und kaufte den Band – und war nach der Lektüre ebenso sehr überrascht wie angeregt. Je weiter ich mit der Lektüre vordrang, desto mehr fragte ich mich, wieso die all die nachdenklichen, zweifelnden evangelischen Christen, die sich in der theologisch ausgetrockneten Landschaft der Landeskirchen nicht mehr wohl fühlen, dieses Buch nicht zu einem Bestseller machen. In Frankreich ist das längst der Fall, aber das liegt auch an der ungleich stärkeren Popularität Carrères, der mit mehreren Romanen und Drehbüchern hervorgetreten ist und in der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle als Intellektueller spielt. Französische Leser stören sich nicht an einem Bestsellerautor, der sich mit der Bibel beschäftigt. Die einschlägigen bürgerlich-protestantischen Milieus in der Bundesrepublik scheinen nicht zu lesen, was sie nicht kennen. Man bleibt lieber bei seinem eigenen Leisten und lässt sich in Lutherjubiläen, Kürzungs-, Gender- und Marketingdebatten nicht beirren. Dabei verursacht Carrères Buch nachhaltige theologische Irritationen. Ein Teil davon bringt den Leser zum Nachdenken, der andere Teil schreckt ihn ab, vor allem anderen diese merkwürdige Mischung aus Marienkatholizismus, buddhistischer Philosophie und gelegentlich billiger Bekenntnisliteratur, die an die bekannten Ratgeber zur Lebenskunst erinnern. Um den französischen Fachausdruck zu gebrauchen: Carrère betreibt bricolage, religiöse Bastelei. Das ist zugleich die Stärke und die Schwäche des Buches: der biographische Zugang, der dem Leser nichts aufdrängt, aber sich gleichzeitig auch nur das vornimmt, was den Autor persönlich interessiert. Mit zunehmender Dauer der Lektüre nimmt der Anteil an Kitsch ab und der Anteil an Reflexion zu. Das Buch ist mehreres zugleich:
Diese vier Richtungen bleiben nicht ohne Spannung untereinander, und das gibt der Lektüre ihren Reiz. Der Band sprengt die Grenzen zwischen Autobiographie, Sachbuch und Roman, der französische Kulinariker würde von einem pot-au-feu, einem Eintopf sprechen. In der Tat steckt in diesem dicken Band einiges Feuer, die Zutaten wurden lange gekocht und geschmort. Die beständige Selbstreflexion Carrères, seine Sprünge zwischen Exegese, Philosophie und Spiritualität, würden im Übrigen auf einen hugenottischen Protestanten als Autor deuten, wenn er sich nicht einige Jahre in einem fundamentalistischen katholischen Milieu bewegt hätte. Die Erfahrungen mit diesem Milieu sind Gegenstand des ersten Teils des Buches, der Aufzeichnungen über ein Bekehrungserlebnis enthält, den täglichen Gang zur Messe, die Scheu vor der Eucharistie, weil er sich dafür noch zu sündig fühlt, die schwierige Trennung von seiner Frau, Aggressionen gegenüber seiner Psychoanalytikerin, lange Gespräche mit einem buddhistischen Freund und schließlich die „Explosion“ der Konversion und die Rückkehr (oder vielleicht Flucht?) in einen vermeintlich einfacheren Agnostizismus. Teil 2 erzählt die Bekehrung des Paulus nach, dazu die Entstehung der christlichen Gemeinden, wie sie am Anfang der Apostelgeschichte berichtet wird. Dann folgt in Teil 3 ein Bericht über die Abfassung des Lukasevangeliums. Teil 4 schildert die Zerstörung Jerusalems durch den römischen Kaiser Titus und die Christenverfolgungen in Rom. Im letzten Teil fragt sich der Autor, was er aus diesen Darstellungen, die zum einen auf der Lektüre exegetischer Literatur, zum anderen auf Fiktion beruhen, gelernt hat. Die Fiktion ist zu erklären: Dort wo die biblischen Texte schweigen, fragt sich Carrère, wie es gewesen sein könnte – und stellt das dann auch so dar. Trotzdem hält er an der Vermischung von historisch-fiktiver Nacherzählung und dem Bericht über gegenwärtige Erfahrungen fest: In diesem letzten Teil erzählt er von einer Fußwaschung, an der er als Nichtgläubiger an einem Gründonnerstag teilgenommen hat. In all ihrer Ambivalenz für den Nichtgläubigen gerät ihm das zu einer der beeindruckendsten Passagen des Buches. Carrère ist durch diesen Band nicht zum eigenen Glauben zurückgekehrt, aber er wollte besser verstehen, was ihn am Glauben einmal fasziniert hat – und noch fasziniert. Zu den schönsten Passagen des Buches zählt, wie Carrère von seiner fundamentalistischen Patentante Jacqueline berichtet. Jahrelang bemüht sie sich ganz unaufdringlich, ihr Patenkind zum katholischen Glauben zu erziehen, in einer papsttreuen, ultramontanen Variante. Am Ende entschied sich der Patensohn gegen den Glauben, aber nicht gegen seine rührende Patentante. Alles, was er von ihr gelernt hat, will er nicht missen. Denn bei erfuhr er, was ihm seine eigene Mutter vorenthielt. Die ehrgeizige Mutter wollte den Sohn nach ihrem Ideal gestalten und fand deshalb nicht besonders viel Verständnis für seine Nöte und Ängste. Die Patentante dagegen wurde ihm zur unaufdringlichen spirituellen Ratgeberin, die neben dem katholischen Glauben auch Lebensweisheit zu vermitteln suchte. Als junger Mann bemerkte Carrère seinen eigenen Ehrgeiz, darin war er der Sohn seiner Mutter, aber genauso fühlte er sich zur katholischen Spiritualität hingezogen. Seine Auseinandersetzung mit Bibel und Glauben hatte familiäre, psychologische Ursachen. Und deswegen erzählt er ausführlich von seiner Mutter, seiner Patentante, seinen Ehefrauen und seinen Psychoanalytikerinnen. In seiner ‚frommen‘ Phase führte Carrère ein exegetisches Tagebuch, in dem er täglich seine Reflexionen und Gebete über jeweils einen Vers des Johannesevangeliums aufschrieb. Der entscheidende Vers aus dem Neuen Testament aber kommt für Carrère (wie übrigens auch für Helmut Gollwitzer[2], der daraus einen Buchtitel für seinen Bericht über seine russische Kriegsgefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg machte) aus dem Johannesevangelium: „(…) und führen, wohin du nicht willst.“ (44 = Joh 21,18) Für Gollwitzer und Carrère steht das für eine prägende biographische Erfahrung. Beide bemerken, dass sie ihr Leben nicht selbst in der Hand haben. Sie können nicht, unabhängig von anderen Einflüssen, in die Lebensrichtung gehen, die sie geplant haben. Stattdessen sind sie der Kontingenz der Welt oder – je nach Glauben – der Vorsehung Gottes unterworfen. Zu diesem Zeitpunkt gehört das Buch Carrères noch in die Gattung der Konfessionen, der Bekehrungsberichte[3]. Carrère wollte bekehrt werden, und er empfand es als umso schlimmer, dass er nach ein paar katholischen Jahren einsehen musste, dass es ihm niemals gelingen wird. In seiner ‚frommen‘ Phase schrieb Carrère über seinen Wunsch, an der Eucharistie teilzunehmen, aber er zögerte, weil er meinte, dafür nicht würdig genug zu sein (84). Gleichzeitig las er Simone Weil. Die Eucharistie setze den Glauben voraus, mit dem man allerdings erst lange Zeit Erfahrungen machen müsse. So sehr sich Carrère wünschte, die Erfahrung eucharistischer Glaubensgewissheit machen zu können, so sehr wandte er sich gleichzeitig davon ab. Er dachte darüber nach, wie man sich die Wandlung theologisch denken kann, und er resignierte, weil er keine befriedigende rationale Erklärung dafür fand. Genau deshalb, weil er an seinem gegenwärtigen (katholischen) Glauben gescheitert ist, wendet er sich in den nächsten Teilen der Geschichte der Entstehung des Christentums zu. Denn er unterstellt, dass diejenigen, die zum ersten Mal geglaubt haben, ähnliche Erfahrungen des Zweifels gemacht haben müssen wie er. Deswegen beschäftigt er sich mit der Theologie, der Biographie und der Krankengeschichte des Paulus. Wenn die Exegese Carrère nicht mehr weiterhilft, hilft er sich mit der vagen Überlieferung oder mit eigenen Hypothesen oder sogar Spekulationen. Regelmäßig vergleicht er seine ermittelten urchristlichen Geschichten mit der Geschichte des Kommunismus in der Sowjetunion. Am Anfang war das Christentum eine lockere Gruppierung von Outsidern, Querulanten und Fundamentalisten, die sich gegenseitig erbittert bekämpften. Die Glossolalie erklärt er aus der Schlaflosigkeit, mit deren Hilfe sich die ersten Christen in Ekstase versetzten (166). Paulus warnte vor Ekstase und Zungenreden, und Carrère vergleicht das mit der Warnung erfahrener Yoga-Lehrer an junge Schüler, die ihre „Kundalini“ (167) entdecken. Ob Yogalehrer, Buddhisten, Stalinisten, Trotzkisten – Carrère schreckt vor keinem Vergleich mit dem Christentum zurück. Das und die konfessionell-biographische Seite des Buches holen die Geschichte des Urchristentums hinein in die Gegenwart. In wichtigen Punkten unterscheidet sich für Carrère das Christentum von allen anderen Religionen, Philosophien und Lehren. Es sei die Fähigkeit des Christentums, dass es die Fähigkeit habe, „zu verblüffenden Handlungen anzustiften, Handlungen – und nicht nur Worten-, die dem normalen menschlichen Verhalten zuwiderlaufen. Menschen sind nun einmal so gestrickt, daß ihren Freunden Gutes wollen (…) und ihren Feinden Böses. (…) So ist es eben, das ist normal, und niemand hat je behauptet, das sei schlecht. Weder die griechische Weisheitslehre noch die jüdische Frömmigkeit. Doch nun sind da Menschen, die nicht nur das Gegenteil davon behaupten, sondern es auch tun. Zunächst versteht man den Zweck dieser extravaganten Umwertung der Werte nicht. Doch dann beginnt man zu begreifen. Man erkennt den Nutzen, das heißt die Freude, die Kraft und die Lebensintensität, die diese Menschen aus ihrem scheinbar abwegigen Verhalten ziehen. Und dann kennt man nur noch eine Sehnsucht: die, es ihnen gleichzutun.“ (171) Das ist ein Schlüsselzitat. Es beschreibt das, was Carrère vorübergehend am Christentum angezogen hat und trotz seines fehlenden Glaubens an die Auferstehung immer noch anzieht. Er ist fasziniert und abgestoßen zugleich, und er lässt das seine Leser spüren. Sie sind genau orientiert über die emotionalen und rationalen Absichten des Autors. Das kann hilfreich sein, muss es aber nicht, gelegentlich wirkt es peinlich und anbiedernd. Das Christentum stellt Carrère als wirkliche Alternative zum Alltagspragmatismus dar, es überbietet und entlarvt ihn zugleich. Darin liegt seine Kraft. Und das ist auch für den deutschen Protestantismus interessant, der in seiner Mehrheitsposition den Glauben bis zur Unkenntlichkeit mit diesem Alltagspragmatismus identifiziert – so als sei Glaube ein Gutmenschentum höherer religiöser Ordnung. Aber diese Gleichsetzung beraubt den Glauben seiner starken religiösen Kraft. So wird höchstens religiöses Biedermeier reproduziert, an dem sich die klerikalen Bürokraten erfreuen. Carrère schert sich nicht um den deutschen Protestantismus, aber er kümmert sich auch nicht um die französische Variante mit ihren hugenottischen Wurzeln und ihrer stärkeren Mischung aus résistance, Tüchtigkeit und Glaubensfestigkeit. Wer als religiöse Bewegung eine Bartholomäusnacht und weitere Verfolgungen überstanden hat, der ist gegen allzu große Alltagspragmatik und Staatshörigkeit gefeit. Ein weiteres Zitat: „Nein, ich glaube nicht, daß Jesus auferstanden ist. Ich glaube nicht, daß ein Mensch von den Toten zurückgekehrt ist. Aber man kann es glauben, und daß ich es geglaubt habe, weckt meine Neugier, fasziniert, verwirrt mich, wirft mich aus der Bahn – ich weiß nicht, welches Verb hier am besten paßt. Ich schreibe dieses Buch, um mir nicht einzubilden, als Nichtgläubiger mehr zu wissen als jene, die glauben, und als ich, da ich selbst noch glaubte. Ich schreibe dieses Buch, um mir selbst nicht zu sehr recht zu geben.“ (287) Mir gefällt die paradoxe Authentizität, die in dieser Passage sichtbar wird. Er ist das Gegenteil jenes konventionellen bürokratischen Glaubens, der oft bei den Funktionären zu spüren ist. Dort wird oft geflunkert: Glaube erscheint als selbstverständliche Notwendigkeit, die nur noch heimlich, nicht mehr offen in Frage gestellt wird. Das Flunkern besteht darin, den Zweifel zu leugnen. Aber zweifelsfreier Glaube ist mindestens eine Selbsttäuschung. Das ist genau das Gegenteil dessen, was Carrère praktiziert. Er scheut sich nicht, den Leser in die Ausgangsbedingungen seiner exegetischen Werkstatt Einblick nehmen zu lassen. Er schreibt über seine Interessen, Gefühle, sein Begehren. Genau diese Authentizität sucht und entdeckt er auch in den Geschichten des Neuen Testaments, beim Zöllner Zachäus, bei den Freunden des Gelähmten (Mk 2,1ff.) und anderen. Diese Figuren – so Carrère – kann niemand erfunden haben, während ihm anderes sehr wohl erfunden erscheint, zum Beispiel alles, was offensichtlich aufgenommen wurde, um eine Weissagung aus dem Alten Testament zu ‚beweisen‘. Carrère kann die Möglichkeit des Glaubens nicht ganz ausschalten. Besonders denen, die glauben wie seine Patentante, begegnet er mit Respekt und Sympathie, ohne ihren Glauben nachvollziehen zu können. Die Stoiker der Antike, die in den europäischen Buddhisten von heuten Nachfahren gefunden haben, sind ihm zu gleichgültig, nicht leidenschaftlich genug. Die Extremisten und Radikalen konzentrieren sich auf Details, die sie ganz ausleben möchten. Carrère wählt demgegenüber einen anderen Weg, geprägt von der Psychoanalyse: Er setzt sich den Leidenschaften aus, die er empfindet, aber gleichzeitig reflektiert er darüber und lernt darin, mit der Leidenschaft umzugehen. Der deutsche Verlag hat dem Buch ein ausführliches Nachwort der Übersetzerin Claudia Hamm beigegeben. Dieses Nachwort wirkt ein wenig merkwürdig, eine nachgeschobene Rechtfertigung dessen, was eigentlich keine Rechtfertigung braucht, auch nicht für deutsche Leser, welche die querelles unter französischen Intellektuellen nicht kennen. Trotzdem ist interessant, was Claudia über Carrères Gebrauch von Bibelübersetzungen schreibt. Der französische Autor geht ganz frei mit einer Vielzahl von Übersetzungen um; er mischt und kombiniert sie. Im Deutschen ist das nicht möglich, wegen der Vorherrschaft der Luther-Übersetzung – und wegen der strengeren Zitierregeln, die ja schon die Dissertationen mehrerer Minister zu Fall gebracht haben. In Frankreich sieht man das lockerer. Anmerkungen[1] Alle Seitenangaben im Text beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf diesen Band. [2] Helmut Gollwitzer, Und führen wohin du nicht willst, München 1951. [3] Wolfgang Vögele, Nimm und lies. Lektüre, Konversion und Hermeneutik, ta katoptrizomena, H.99, 2016, http://www.theomag.de/99/wv23.htm. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/104/wv28.htm |