
Wiedergänger |
Ex oriente luxEine RezensionWolfgang Vögele Mathias Enard, Kompass, Berlin 2016 (frz. 2015)
Ritter begleiten bei diesen Nachtgedanken Komponisten, Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler, die alle wie er selbst die Sehnsucht nach dem Orient kultiviert haben: Goethe und Mozart, Fernando Pessoa, Friedrich Rückert und viele andere. Enard verbindet das Faszinierende des Orients und seiner wissenschaftlichen Erforschung mit dem bürokratisch drögen Universitätsbetrieb der Forschungsanträge mit Durchschlägen, der wissenschaftlichen Tagungen, der folgenden Sammelbände und der mühsamen Archiv- und Bibliotheksarbeit. Zum akademischen Proletariat, wie man vermuten würde, gehört er nicht, er hat eine unbedeutende Stelle an einer unbedeutenden Universität ergattert, die ihm wenigstens ein Auskommen sichert. Er ist immer noch in seine Kollegin Sarah verliebt, die ihn aber längst auf Distanz hält. Ritter erzählt von Vorträgen und Konferenzen und Expeditionen, von Istanbul, Damaskus, Aleppo, Teheran, von seinen Begleitern, die sich mehr als für die Wissenschaft für Opium, Prostituierte, Alkohol und Politik interessieren. Dissertationen und Forschungsprojekte werden nie abgeschlossen. Alles bleibt Sehnsucht, alles kommt nur auf die faszinierende Fremdheit des Ostens an. Der europäische Kulturwissenschaftler als Nachfahre der ersten Kolonisatoren interessiert sich für das, was ihm selbst fehlt. Er sucht im Orient nach den fehlenden Teilchen seines eigenen Selbst. Kulturwissenschaften und besonders die Orientalistik sind nur ein Vehikel, um diese verborgenen Interessen unter der Oberfläche der Expeditionen und Forschungsaufträge auszuleben. Franz Ritter sucht im Osten von Österreich Musik, Liebe, eine Partnerin, irgendeine Form von Glück, die ihm als Ersatz für Erlösung und Versöhnung dienen könnte. Trotzdem, gerade deswegen verliebt er sich nicht in eine Muslimin, sondern in eine andere Suchende, die Kulturwissenschaftlerin Sarah, die seine Sehnsucht teilt. Er probiert eine Opiumpfeife, aber er schreckt vor dem weiteren Gebrauch zurück, weil er nicht süchtig werden will. Er interessiert sich für den Orient, aber er wird nicht ein Teil von ihm. Er sucht mit verbissener Anstrengung, und er findet einiges. Aber in das Gefundene selbst will er nicht vollständig eintauchen. Der Orientalist will im Orient eine Heimat suchen, aber vor dem Finden schreckt er zurück. Franz gibt seiner Sehnsucht nach, wahrt aber zugleich stets ein letztes Quentchen Distanz. Dieses Muster von Annäherung und Distanzierung wiederholt sich mehrfach. Stets kommt diese Ambivalenz aus Sehnsucht, Zuneigung, Eintauchen in eine fremde Welt auf der einen und aus Distanzierung, Enttäuschung, Fremdheit und Zurückweisung auf der anderen Seite zum Tragen. Nach der Krankheitsdiagnose weiß Franz, daß ihm nur noch wenig Zeit bleibt. Der Forschertyp, den er repräsentiert, ist dem Untergang geweiht. In Syrien, im Irak und anderswo ist die orientalische Welt aktuell dabei, sich mit Hilfe des Westens selbst zu zerstören. Ritter nimmt das mit Trauer zur Kenntnis. Er sieht den bevorstehenden Untergang der orientalischen Welt, und er verbindet das mit seiner Krankheit, der er selbst in absehbarer Zukunft erliegen wird. Er pendelt zwischen dem Orient, Paris und Wien. Die Religion spielt bei dem allem eine seltsam untergeordnete Rolle, kein Wort über Israel und das Judentum, kaum ein Wort über die eigenen katholischen Wurzeln. Franz ist von dem Grundsatz bestimmt: Mir reicht die eigene Kultur nicht, ich such nach dem Anderen, dem Besseren, Verlockenderen, und ich hoffe, es dort zu finden, wo die Sonne aufgeht. Seinen Titel hat der Roman von einem Kompass, den die so lange begehrte Sarah dem fluffigen Franz geschenkt hat. Die Nadel zeigt nicht nach Norden, sondern mit Hilfe eines technischen Tricks stets nach Osten – in die Himmelsrichtung der wissenschaftlichen Sehnsucht. Franz Ritter sammelt Bücher, Noten, Briefe, Manuskripte und stapelt sie in den Regalen seiner Wiener Altbauwohnung. An Sarah bewundert er, dass sie dieses Sammeln nicht nötig zu haben scheint. Aus den Regalen hat er sich eine Art wissenschaftliche Trutzburg gebaut, von der er meint, sie würde ihn vor den Risiken des täglichen Lebens beschützen. Nicht umsonst erinnert der Roman hier an Elias Canettis „Blendung“[1], an den Sinologen und Büchersammler Peter Kien, dessen Bibliotheksburg in einer apokalyptischen Schlussszene in Flammen aufgeht. Ritter ist mit seinen Büchern allein; er zitiert einen spanischen Essayisten, der geschrieben hat: „Die Zeiten sind so schlecht, daß ich mich entschlossen habe, mit mir allein zu reden (…).“[2] Ritter kultiviert das Selbstbild des einsamen Wolfs, des Streuners, der aber dennoch schmerzlich auf Gespräch und Kommunikation, vor allem mit der entfernten Geliebten Sarah angewiesen bleibt. In der Kreiselkommunikation mit sich selbst spinnt Ritter die bekannte philosophische Idee des Anderen aus. Diese Entdeckung des Anderen, das sich vom eigenen Selbst unterscheidet, ist mit Risiken verbunden. Der Fremde findet sich in der unbekannten, orientalischen Welt nicht zurecht, per definitionem. Franz‘ Freundin Sarah löst diesen Widerspruch so auf, daß sie sich immer weiter in den Osten zurückzieht. Sie wird schließlich Buddhistin und sucht Zuflucht in einem indischen Kloster. Aber ihr Meditationslehrer hat verstanden, was sie im Innersten bewegt. Er schickt sie einfach zurück. Die Flucht in den Osten verwandelt sich zur Rückkehr in den Westen. Und darunter leidet sie um so mehr, als derjenige, bei dem sie Zuflucht gesucht hat, sie zurückweist und sie dorthin schickt, wo sie hergekommen ist. Franz flieht nicht, er macht eher den Eindruck eines Stubenhockers. Nach einer Periode der Forschungsreisen bleiben seine Ausflüge in den Orient eher virtuell und intellektuell. Der Leser erfährt nicht, unter welcher Krankheit Franz leidet, auch nicht, ob er wirklich daran sterben wird. Der Schluss bleibt in dieser Hinsicht offen. Dabei ist der Schluß traurig genug. Die Liebe zwischen Franz und Sarah zerbricht endgültig. Weder der eine noch die andere sind in der Lage, dieses Andere ihrer Selbst zu entdecken, und das weder in der anderen Kultur noch in der anderen Person. Gelegentlich neigt Franz Ritter zum Vulgären. Er springt von einem Orientalisten zum nächsten, von der Musikwissenschaft zur arabischen Sprache, von der Geographie zur Theologie der schiitischen Ayatollahs. Jeder neue Gedanke verstärkt den nicht endenden Schwall der Grübeleien. Der Leser beobachtet Franz Ritter dabei, wie er sich selbst in die Tasche lügt. Er gesteht sich nicht ein, dass seine Beziehung zu Sarah längst zerbrochen ist, und er gesteht sich auch nicht ein, dass sich ihm der Gegenstand seiner wissenschaftlichen Forschung längst entzogen hat. Trotzdem liebt er den Orient, und gerade darum muß er die Bürgerkriege, die Zerstörung der Kulturdenkmäler durch den Islamischen Staat mit Verzweiflung zur Kenntnis nehmen. Enard hat auch einen Roman über die politischen Implikationen des Orientalismus geschrieben: der Westen als hegemoniale Macht, die eher an eigenen Interessen als an der Bewahrung von Traditionen, Werten und Kulturdenkmälern, am kulturellen Gedächtnis des Anderen interessiert ist. Trotzdem begibt sich Enard an keiner Stelle auf die Felder des peinlichen Moralismus. Franz Ritter weiß um den Islamischen Staat, die Ölquellen und die Machtinteressen der Wahabiten in Saudi-Arabien und der Schiiten im Iran. Das Bewusstsein von Zerstörung und Entzug mündet am Ende in die Skepsis und Misanthropie eines verkrachten und resignierten Wissenschaftlers. Der Westen als kulturelle Formel, als Mischung aus Christentum, Antike und Aufklärung ist für Ritter bei seinem bevorstehenden Ende angekommen. Doch dem ist auch zu misstrauen, denn Ritters gelegentlich wehleidiger und selbstgerechter Ton speist sich auch daraus, dass er zu oft das eigene wissenschaftliche Scheitern und den Niedergang der europäischen Kultur miteinander verknüpft. Keine Liebe, keine Wissenschaft, keine Erkenntnisse, keine Reisen in den Osten mehr. Anmerkungen |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/105/wv29.htm |
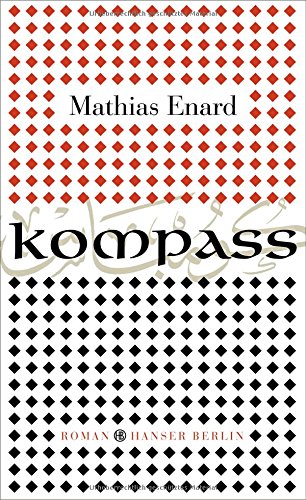 Der französische Orientalist und Schriftsteller Mathias Enard hat einen Roman geschrieben, der im Jahr 2015 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde. Dass es sich um einen Roman handelt, daran kann kein Zweifel bestehen, auch wenn das Werk wie eine wissenschaftliche Monographie mit einer langen Literaturliste versehen ist. Der Schriftsteller setzt sich mit der Geschichte der europäischen Sehnsucht nach dem Orient auseinander. Der Leser empfindet schon nach den ersten Seiten Sympathie für den ein wenig heruntergekommenen österreichischen Musikwissenschaftler Franz Ritter, der sich eine Nacht lang seinen Assoziationen und Reflexionen hingibt. Unablässig fließt der innere Monolog Franz Ritters, nachdem er zuvor die Diagnose einer für ihn tödlichen Krankheit erfahren hat, die nicht näher erläutert wird. Franz Ritter leidet unter Schlaflosigkeit, aus ihr wachsen die Grübeleien, mit Hilfe derer er sein Leben auf den Prüfstand stellt. Sein Denken ist zäh, träge und melancholisch geworden, und gelegentlich ermüdet das ihn selbst – und damit auch den Leser.
Der französische Orientalist und Schriftsteller Mathias Enard hat einen Roman geschrieben, der im Jahr 2015 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde. Dass es sich um einen Roman handelt, daran kann kein Zweifel bestehen, auch wenn das Werk wie eine wissenschaftliche Monographie mit einer langen Literaturliste versehen ist. Der Schriftsteller setzt sich mit der Geschichte der europäischen Sehnsucht nach dem Orient auseinander. Der Leser empfindet schon nach den ersten Seiten Sympathie für den ein wenig heruntergekommenen österreichischen Musikwissenschaftler Franz Ritter, der sich eine Nacht lang seinen Assoziationen und Reflexionen hingibt. Unablässig fließt der innere Monolog Franz Ritters, nachdem er zuvor die Diagnose einer für ihn tödlichen Krankheit erfahren hat, die nicht näher erläutert wird. Franz Ritter leidet unter Schlaflosigkeit, aus ihr wachsen die Grübeleien, mit Hilfe derer er sein Leben auf den Prüfstand stellt. Sein Denken ist zäh, träge und melancholisch geworden, und gelegentlich ermüdet das ihn selbst – und damit auch den Leser.