
Outsider |
Die Gewalt der MusikVier literarische BeispieleHans-Jürgen Benedict
Zum Andenken an Wolfgang Grünberg (1940-2016) Im September 1697 verfasste der englische Poet John Dryden sein Gedicht Alexander’s Feast mit dem Untertitel Or the power of Musick - an Ode wrote in Honour of St. Cecilia. Also geschrieben zu Ehren der Schutzheiligen der Musik, der Heiligen Cäcilie, deren Namenstag auch in England am 22. November gefeiert wurde. Attribut der Heiligen war bekanntlich die Orgel. Bereits von mehreren Komponisten vertont griff Georg Friedrich Händel 1736 auf die Dichtung Drydens zurück und komponierte seine Ode „Das Alexanderfest oder die Macht der Musik“. Entsprechend der barocken Theorie von der Klangrede sollten vor allem die menschlichen Leidenschaften und Affekte musikalisch dargestellt werden. Erzählt wird von einem bei Plutarch erwähnten Fest, dass Alexander der Große nach der Einnahme von Persepolis gegeben hat. Seine Frau, die schöne Athenerin Thais, verleitet in einer von Rachegefühlen bestimmten Rede Alexander und seine Soldaten dazu, die Hauptstadt des eroberten persischen Reichs anzuzünden. Da tritt der heidnische Sänger Timotheus auf und besänftigt mit seiner Kunst die Rasenden. Das gelingt ihm jedoch nur, weil ihm die Heilige Cäcilie mit ihrer Sangeskunst zu Hilfe kommt: „The sweet Enthusiast, from her sacred store / Enlarg’d the former narrow bounds / And added length to solemn sounds, / With nature’s mother-wit, and arts unknown before.“[1] Antikes Erbe und christliche Kunst werden versöhnt, indem zum Schluss beiden der Preis zuerkannt wird[2]. Der schöne Gedanke der transformierenden „Macht der Musik“ aber hat eine erstaunliche literarische Wirkungsgeschichte, die ich im Folgenden beleuchten möchte. 1. Ein Gloria „mit entsetzlichen und gräßlichen Stimmen“ Kleists Legende über die Gewalt der Musik.
Kleist, der die erste kurze Fassung dieser Novelle als Taufangebinde für die Tochter des zum Katholizismus konvertierten Adam Müller verfasste, geht es, wie der Titel sagt, um die Gewalt der Musik als Ausdruck der Macht des Glaubens. So schreibt er in einem Brief aus Dresden an Wilhelmine von Zenge am 21.5.1801: „Nirgends aber fand ich mich tiefer in meinem Innern gerührt als in der Katholischen Kirche (gemeint ist die Hofkirche, HJB),wo die größte erhabenste Musik noch zu den anderen Künsten tritt, das Herz gewaltsam zu bewegen.“ In dem Brief schildert er auch einen Mann, der an den Stufen des Altars niederkniend sein Haupt auf eine höhere Stufe legte und betete. „Ihn quälte kein Zweifel, er glaubt – ich hatte eine unbegreifliche Sehnsucht mich neben ihn niederzuwerfen und zu weinen- Ach nur ein Tropfen Vergessenheit und ich würde mit Wollust katholisch werden.“[5] Wie ernst ist dieser Regressionswunsch zu nehmen? Die romantische Rückwendung zum Katholizismus hat auch Kleist beschäftigt und in der Heiligen Cäcilie stellt er erzählerisch die Macht katholischer Religiosität dar. Aber sein Zweifel und Skeptizismus bleiben. Die Ironie ist nicht zu übersehen, wenn er von einer Legende spricht, das letzte gemeinsame Gloria in excelsis der vier Brüder schildert und das Ganze in die Säkularisierung des Klosters münden lässt. Gleichwohl gelingt Kleist, indem er die Gewalt der alten italienischen Messe schildert, eine besondere Einsicht in Herkunft und Wesen der Musik. Diese Ambivalenz der „geheimnisvollen Kunst“ der Musik beschreibt Kleist so, dass einerseits ein „wunderbarer, himmlischer Trost“ von ihr ausgeht, sie andererseits „aus zauberischen Zeichen (besteht), womit sich ein fürchterlicher Geist geheimnisvoll den Kreis abzustecken scheint“. (311) Man könnte sagen, „im Schicksal der Brüder enthüllt sich der ganze Schrecken der Tonkunst wie also auch des Glaubens, in dessen Dienst sie steht.“[6] Aber die Schilderung des Bilderstürmervorhabens, das die Errungenschaften der Kunst zerstört und auf die Verursacher selbst zurückschlägt, sodass sie wider Willen, geistesverwirrt, selbst das Gloria anstimmen müssen, erlaubt noch eine andere Deutung. Die Brüder stimmen ja das Gloria „mit gräßlichen und entsetzlichen Stimmen“ an, und dann folgt der ungeheuerliche Kommentar „ – so mögen sich Leoparden und Wölfe anhören lassen, wenn sie zur eisigen Winterzeit das Firmament anbrüllen (…) die Fenster von ihrer Lungen sichtbarem Atem getroffen drohten klirrend zusammenzubrechen, als ob man Hände voll schweren Sands gegen ihre Flächen würfe.“ (303) In der Erzählung von der Geburt Christi beim Evangelisten Lukas wird das „Ehre sei Gott in der Höhe“ von Engeln angestimmt. Kleist nun verbindet das Seraphische mit dem Animalischen, indem er das Singen der Brüder mit dem Gebrüll von Raubtieren vergleicht, das Organische mit dem Anorganischen (Sandwerfen). Aber nicht indem er menschliche Stimmen „in Kreatürlichkeit bannt“[7] und sie so bestraft, sondern er wirft sie gewissermaßen zurück an den Anfang der Kunst, als die steinzeitlichen Menschen dem Schrecken gegenüberstehend - Natur-,Opfer- und Tierschrecken vor allem, diesen durch Geräusche, Geschrei kollektiv erträglich zu machen versuchten. Am Anfang der Kunst steht der Opfer-Schrecken, der durch die Wiederholung ritualisiert, besänftigt und zur Kultur wird. Als Beispiel für diese Umwandlung kann das Schofar, das im jüdischen Gottesdienst geblasen wird, dienen. Dieses Widderhorn ist ursprünglich das Horn des klassischen Opfertiers, des Widders und wird jetzt zum ersten Musikinstrument. Christoph Türcke nennt weitere Transformationen des Schreckens: vor allem der unartikulierte Schrei der menschlichen Stimme, der zum Sprechakt wird und dann zum Gesang als erhöhtes Sprechen. Am Anfang der Musik steht das „gemeinsame Überschreien des schreienden Opfers“ durch das zum Chor sich zusammennehmende opfernde Kollektiv. „Erst durch die Gutheißung des Schreckens ist Sinn die Welt gekommen.“ [8] Weil sie den in Heiliger Musik und Architektur kultivierten Schrecken zurücknehmen wollen, fallen die vier Bilderstürmer zurück auf die Anfänge und müssen jenes schreckliche Gloria in excelsis anstimmen. Sie sind zur grässlichen Wiederholung verdammt, weil sie den Fortschritt in der Kunst nicht anerkennen wollten – das führt zum tierischen Gesang der Bilderstürmer, den Kleist ähnlich in seiner Deutung von Caspar David Friedrichs Mönch am Meer verwendete.
„Füchse und Wölfe“ müssten, wenn das Bild mit Wasser der Ostsee und Kreide von Rügen gemalt wäre, “heulen“.[9] Der Mensch aber, der sich angesichts dieses Gemäldes dem Schrecken der nicht einfassbaren Natur aussetzt, dem ist, „als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären“,[10] wie die ungeheuerliche Formulierung Kleists lautet. Er kann, so Blamberger, das Bild nicht ins Ideelle transzendieren. Oder doch, wenn er sich dieser Schreckensherkunft der Kunst bewusst ist. Dem versucht recht verstanden die Legende Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik sich anzunähern. Die in Musik gebannte Macht des Glaubens, die in der Gewalt der Musik sich äußernde Kraft der zivilisierenden Kultur darf nicht leichtfertig aufgegeben werden, sonst schlägt der Frevel auf seine Urheber zurück. Nur wenige Jahre nach der Entstehung von Kleists Novelle haben nach Aufführungen von Bachs Johannes-Passion die sogenannten antisemitischen Hep Hep-Krawalle stattgefunden – die in Bachs gewalt (ät)ige Turba-Chöre musikalisch gebannte Verurteilung der Juden als Mörder Jesu durch die Evangelisten setzt die Hörer in solche Aufregung, dass sie nach der Aufführung mit Hep Hep-Hetzrufen ( Abkürzung für Jerusalem ist verloren) auf die Straße gingen. 2. „Frommer Sinn und Melodie“ – die transformierende Kraft der Musik in Goethes Novelle
Er erreicht die Reitenden und scheint die Fürstin in Gefahr zu bringen. Doch Honorio rettet sie tapfer aus der Bedrängnis mit zwei tödlichen Schüssen auf das Tier. Jammernd erscheint eine Frau mit einem schwarzgelockten Knaben, der eine Flöte trägt. Sie erhebt Klage über den Tod des angeblich zahmen und harmlosen Tieres aus. Der Fürst hat seine Jagd abgebrochen und gibt, als gemeldet wird, dass auch der Löwe los ist und sich bei der alten Stammburg des Fürsten niedergelassen hat, vorsorgliche Anweisungen, wie man sich zu schützen habe. Der Vater hält eine biblisch getönte Rede über die trotz der in ihr vorkommenden Zerstörungen wohlgesetzte Ordnung der Schöpfung, alle Gotteswerke seien weise. Auch der über alles Getier herrschende Löwe habe doch Ehrfurcht gegenüber dem Menschen, dem Ebenbilde Gottes, und er verweist auf die biblische Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Nach der Rede des Vaters stimmt der Knabe, begleitet von dem die Flöte spielenden Vater einen Gesang an: „Aus den Gruben, hier im Graben / Hör ich des Propheten Sang; / Engel schweben, ihn zu laben, / Wäre da dem Guten bang? / Löw und Löwin, hin und wieder / Schmiegen sich um ihn heran; / Ja, die sanften, frommen Lieder / Habens ihnen angetan!“ In einer zweiten Strophe schiebt das Kind die Zeilen durcheinander, sodass es einen neuen Sinn ergibt. In der letzten beginnen alle drei „mit Kraft und Erhebung“ zu singen, es klingt wie eine Mischung von hebräischem Schöpfungspsalm, Jesaja-Vision und dem Hohenlied des Paulus: „Denn der Ewge herrscht auf Erden / Über Meere herrscht sein Blick; / Löwen sollen Lämmer werden / Und die Welle schwankt zurück / Blankes Schwert erstarrt im Hiebe / Glaub und Hoffnung sind erfüllt; / Wundertätig ist die Liebe / Die sich im Gebet enthüllt.“ (509) Die Wirkung ist ungeheuer. „Alles war still, hörte, horchte, und nur erst als die Töne verhallten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt, jeder in seiner Art gerührt.“ (509) Die Familie bittet den Fürsten, den Löwen durch den Gesang des Kindes und das Spiel auf seiner Flöte besänftigt wieder einzufangen zu dürfen. Mit allen nötigen Vorsichtsmaßnahem wird dem Wunsch stattgegeben; das Kind geht in die Burg (man hält als Leser den Atem an, es ist ein wenig wie der Gang hinter der Szene bei der Feuerprobe Taminos und Taminas in Mozarts Zauberflöte) und kommt tatsächlich mit dem leicht humpelnden Löwen zurück. Er führt ihn im Halbkreise, „bis er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt niedersetzte und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können.“ (511) Der Löwe lässt sich dicht neben dem Kind nieder, das ihm einen Dorn aus seiner rechten Vordertatze zieht. „Man meinte sogar in den Zügen des grimmen Tiers einen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit spüren“ (512) zu können. Der Knabe singt, wiederum die Zeilen variierend, eine letzte Strophe, mit der die Novelle schließt: „Und so geht mit guten Kindern/Selger Engel gern zu Rat/Böses Wollen zu verhindern,/Zu befördern schöne Tat./ So beschwören, fest zu bannen/Liebem Sohn ans zarte Knie/Ihn, des Waldes Hochtyrannen/Frommer Sinn und Melodie.“ (513) Die jüdisch-christliche Wurzel dieser Novelle ist unübersehbar. Beutler spricht von der Anstrengung Goethes, „christliche Gläubigkeit zu Naturfrömmigkeit zu wandeln, hier geht es um eine Metamorphose des Religiösen, bei der aber der ursprüngliche Gehalt: Glaubensstärke und schöpferische Kraft nicht geopfert werden: Säkularisation ohne Verluste.[12] In einem Gespräch mit Eckermann 1827 sagt Goethe zur Novelle: „Zu zeigen wie das Unbändige, Unüberwindliche oft besser durch Liebe und Frömmigkeit als durch Gewalt bezwungen werde, war die Aufgabe dieser Novelle. Und dieses schöne Ziel, welches sich im Kinde und Löwen darstellt, reizte mich zur Ausführung. Dies ist das Ideelle, dies die Blume. Und das grüne Blätterwerk der durchaus realen Exposition ist nur deswegen da, der eigentliche Gewinn für unsere höhere Natur liegt im Idealen, das aus dem Herzen des Dichters hervorging.“[13] Goethe gibt damit selbst den Schlüssel an, dem Geheimnis der wunderbaren Wirkung dieser unerhörten Begebenheit auf die Spur zu kommen. Dabei hilft ihm die Besinnung auf die biblische Vorzeit. Wie im Faust II versteht er sich als vollmächtiger Ausleger der alten Geschichten[14], hier des Buches Daniel. Die Figuren aus dem Morgenlande erinnern an eine Patriarchengruppe, ihre Sprache ist biblisch und naturhaft, in der gegenwärtigen Welt wirken sie archaisch, „sie leben unmittelbar zu Gott und das heißt zugleich unmittelbar zur Natur.“[15] Das Elementare ist bei ihnen durch Frömmigkeit und Gesang gebändigt. Es ist vor allem die Macht des Liedes, der Musik, der die Zähmung gelingt. Auch hier sind wieder Anklänge an die Zauberflöte mit Händen zu greifen. Dort zähmt Papageno auf komische Weise den wilden Mohr Monastatos und seine Helfer mit dem Flötenspiel, die wie Marionetten zu tanzen beginnen. Hier ist es frommer Gesang, von dem die Zähmung ausgeht. Im Lied wird ausgehend von der Daniel-Geschichte beschrieben, was nachher geschieht. „Das ‚Wunder‘ der Novelle ist die Wiederherstellung des ersten Schöpfungstages inmitten einer gesitteten Welt“[16], und zwar durch die Gewalt der Musik. Diese verwandelnde Macht der Musik ist durchaus vergleichbar mit derjenigen der uralten italienischen Messe in Kleist Heiliger Cäcilie. Wie dort die aggressiven Bilderstürmer beschwichtigt sie hier die wilden Tiere und den von Leidenschaften aufgewühlten Menschen. Goethe selbst legt von dieser Wirkung der Musik in einem Brief an Zelter aus dem Jahr 1823 Zeugnis ab. Darin schreibt er aus Marienbad (ohnehin aufgewühlt von dem Ulrike-Erlebnis): „Nun doch das eigentlich Wunderbarste! Die ungeheure Gewalt der Musik auf mich in diesen Tagen. Die Stimme der Milter, das Klangreiche der Szymanowska, ja sogar die Exhibitionen des hiesigen Jägerchors falten mich auseinander, wie man eine geballte Faust freundlich flach lässt. Zu einiger Erklärung sage ich mir: Du hast seit zwei Jahren und länger gar keine Musik gehört (…) und nun fällt die Himmlische auf einmal über dich her, durch Vermittlung großer Talente, und übt ihre ganze Gewalt über dich aus (…)Ich bin völlig überzeugt, daß ich im ersten Takte deiner Singakademie den Saal verlassen müsste.“[17] Der durch seine vergebliche Liebe zu Ulrike von Levetzow emotionalisierte Goethe wird durch die beiden genannten Musikdarbietungen, den Gesang der Sopranistin Anna Milder und das Klavierspiel der polnischen Pianistin so überwältigt beziehungsweise „auseinander gefaltet“, dass er seiner Gefühle fast nicht mehr Herr ist. Einen poetischen Ausdruck findet diese starke Empfindung in dem Gedicht Aussöhnung, dass er der polnischen Pianistin Mitte August 1823 in ihr Stammbuch geschrieben hatte (Es steht zwar in der Trilogie der Leidenschaft an letzter Stelle steht, ist aber schon vor der Marienbader Elegie entstanden.) In diesem Gedicht wird ähnlich wie in der Novelle die heilende Wirkung der Musik beschrieben. Die Musik durchdringt des Menschen Wesen, überfüllt ihn mit „ewger Schöne“ und rührt ihn zu Tränen. „Das Auge netzt sich, fühlt im höhern Sehnen / Den Götterwert der Töne wie der Tränen.“ Das Herz merkt, dass es noch lebt und schlägt, dankbar will es sich zeigen und das dichterische Ich bricht in den Ruf aus: „Da fühlte sich – o daß es ewig bliebe -/ Das Doppelglück der Töne wie der Liebe.“[18] Das erstrebte ersehnte Doppelglück ist, so die Konsequenz, eher selten: „o daß es ewig bliebe“. Zurück zur Novelle, in der Goethe fünf Jahre nach der Gewalt der Musikoffenbarung in Marienbad, einer Musiküberwältigung also, diese noch einmal erzählerisch als beschwichtigende Macht der Musik beschreibt. Bei Kleist wird die Gewalt der Musik auch damit erklärt, dass sie von Nonnen „oft mit einer Präzision, einem Verstand und einer Empfindung ausgeübt (wird), die man in männlichen Orchestern vermißt (vielleicht wegen der weiblichen Geschlechtsart dieser Kunst).“[19] Bei Goethe ist es eher die Reinheit des kindlichen Herzens, die die Macht der Musik erzeugt. Die Erzählweise ist vielleicht eine Spur zu schön um wahr zu sein. Aber es geht von ihr eine so wohltätige Wirkung aus, auch und gerade in den Strophen des vom Knaben gesungenen Liedes, dass man sich wie die Personen der Adelsgesellschaft trotz aller realistischen Vorbehalte auf sie einlässt. Diese empfindsame Haltung hat Eckermann 1831 sehr treffend beschrieben: „In der poetischen Region läßt man sich alles gefallen und ist kein Wunder zu unerhört, als daß man es nicht glauben möchte (…) Zu dem Schluß von Goethes Novelle wird im Grunde nichts weiter verlangt, als die Empfindung, daß der Mensch von höheren Mächten nicht ganz verlassen sei, daß sie ihn vielmehr im Auge haben, an ihm teilnehmen, und in der Not ihm helfend zur Seite sind.“[20] Insofern ist Goethes Novelle eine Erzählung, die mit biblischen Anklängen in poetisch-symbolischer Sprache die beschwichtigende Kraft der Musik sanft überwältigend zu beschreiben versteht. 3. Sehnsuchtsschwere Himmelsmusik - Gottfried Kellers Tanzlegendchen. Es gibt einige barocke Orgelprospekte, die neben dem Ahnherrn der geistlichen Musik, dem König David und der Patronin der Kirchenmusik, der Heiligen Cäcilie, auch die neun heidnischen Musen darstellen. So etwa auf dem prächtigen Prospekt der Orgel der St.Nikolai-Kirche in Flensburg. Das ist eine schöne Tradition, auch die vorchristliche Antike in die Geschichte geistlicher Musik zum Lobe Gottes einzubeziehen. Das wirft die Frage auf, ob die Musen, wenn sie denn am Orgelprospekt prangen, auch in den Himmel gekommen sind. Musa „zweifelte ob denn im Himmel auch wirklich getanzt würde, dieser Erdboden schien ihr gut und zweckdienlich, um darauf zu tanzen, folglich würde der Himmel wohl andere Eigenschaften haben.“ Doch König David „setzte ihr auseinander, wie sehr sie in dieser Beziehung im Irrtum sei, und bewies ihr durch viele Bibelstellen sowie durch sein eigenes Beispiel, daß das Tanzen allerdings eine geheiligte Beschäftigung für Selige sei.“ (454) Musa ist noch unschlüssig, da erklingt auf einen Wink Davids eine so unerhört glückselige überirdische Tanzweise, zu der zu tanzen ihr irdischer Leib zu starr und schwer ist, dass Musa das Angebot Davids annimmt. Sie läutert sich zur Heiligen. Sie fastet und betet und nach drei Jahren gibt sie ihren Geist auf und springt in den offenen Himmel. Und jetzt die wunderbare letzte Szene dieses tiefsinnigen Legendchens: „Im Himmel war eben hoher Festtag“ (455), bei dem die neun heidnischen Musen, die sonst in der Hölle einsaßen, auch einmal dabei sein dürfen. Verschüchtert sitzen sie da, von der emsigen Martha umsorgt, bis Musa, die Heilige Cäcilie und andere kunsterfahrene Frauen sich zu ihnen gesellen und sich ein anmutig fröhliches Dasein in dem Frauenkreise entfaltet. Musa saß neben Terpsichore und Cäcilia zwischen Auch König David kommt herbei, bringt einen goldenen Becher, aus dem alle trinken. „Er ging wohlgefällig um den Tisch herum, nicht ohne der lieblichen Erato das Kinn zu streicheln im Vorbeigehen. Als es dergestalt hoch herging an dem Musentisch, erschien sogar unsere liebe Frau in all ihrer Schönheit und Güte, setzte sich auf ein Stündchen zu den Musen und küßte die hehre Urania auf den Mund, als sie ihr beim Abschiede zuflüsterte, sie werde nicht ruhen, bis die Musen für immer im Paradies bleiben könnten. Es ist freilich nicht so gekommen.“ (456) Keller erklärt auch wieso: „Um sich für die erwiesene Güte dankbar zu erweisen, ratschlagten die Musen untereinander und übten in einem abgelegenen Winkel der Unterwelt einen Lobgesang ein, dem sie die Form der im Himmel üblichen feierlichen Choräle zu geben versuchten. Sie teilten sich in zwei Hälften von je vier Stimmen, über welche Urania eine Art Oberstimme führte, und brachten so eine merkwürdige Vokalmusik zuwege. Als nun der nächste Festtag im Himmel gefeiert wurde und die Musen wieder ihren Dienst taten, nahmen sie einen für ihr Vorhaben günstig scheinenden Augenblick wahr, stellten sich auf und begannen sänftlich ihren Gesang, der bald mächtig anschwellte. Aber in diesen Räumen klang er so düster, ja fast trotzig und rauh, und dabei so sehnsuchtsschwer und klagend, daß erst eine erschrockene Stille waltete, dann aber alles Volk von Erdenleid und Heimweh ergriffen wurde und in ein allgemeines Weinen ausbrach. Ein unendliches Seufzen rauschte durch den Himmel; bestürzt eilten die Ältesten und Propheten herbei, indessen die Musen in ihrer guten Meinung immer lauter und melancholischer sangen und das ganze Paradies mit allen Erzvätern, Ältesten und Propheten (…) ausser Fassung geriet. Endlich aber kam die allerhöchste Trinität selber heran, um zum Rechten zu sehen und die eifrigen Musen mit einem lang hinrollenden Donnerschlage zum Schweigen zu bringen. Da kehrten Ruhe und Gleichmut in den Himmel zurück; aber die armen neun Schwestern mußten ihn verlassen und durften ihn seither nicht wieder betreten.“ (456f) Gottfried Keller als Feuerbachianer zeigt in den Sieben Legenden in heiter spielerischer Weise, was geschieht, wenn aus „Kandidaten des Jenseits Studenten des Diesseits“ werden, wenn statt Aufopferung des natürlichen Lebens die Hingabe an das Leben, wenn die Liebe dominiert. Sie ist selbst noch im Himmel mächtig, bei David als elegantem Tänzer und Frauenfreund und bei den seligen Frauen, selbst bei Unserer Lieben Frau Maria. Die wird geweckt durch den erdenschweren Choral-Gesang der Musen. Das ist kirchenmusikalisch eine interessante Beobachtung. Was als geistliche Musik im Barock tänzerisch im Sechsachtel-Takt sich von der Erde aufschwingt, man denke an die beschwingten, den Himmel stürmenden Chöre Händels und Bachs oder an die Himmelsseligkeit beschwörende Arien Johann Sebastian Bachs wie etwa „Die Seele ruht in Jesu Händen, wenn Erde diesen Leib bedeckt“ (BWV 127 ), das klingt im Himmel erdenschwer. Das ergebungsvolle „Schlummert ein, ihr matten Augen“ aus „Ich habe genung“ (BWV 82) mit seinem Wiegenrhythmus und Verzögerungen stimmt ein geradezu ein himmlisches Lullaby an. Aber man weiß als ergriffener Hörer doch auch die Tatsache zu schätzen, dass man dies hörend noch auf Erden weilt und ihre Schönheiten genießen kann, ganz im Sinne der berühmten Keller-Zeile „Trinkt o Augen, was die Wimper hält/Von dem goldnen Überfluß der Welt.“ Der Choral der Musen wirkt als Imitation irdisch-geistlicher Musik im Himmel kontraproduktiv, weckt bei den Himmelsbewohnern die Erinnerung - an die Erde. Die antiken Musen enthüllen so unbeabsichtigt das falsch Verklärende frommen Jenseitstrostes. „Der Himmel mag die vollkommene Erde als Sehnsuchtsbild sein; am Ziel der Sehnsucht wird das Heimweh zurück nach jenem Unvollkommenen geweckt, das der Ausgangspunkt der Sehnsucht war. Das Letzte wird zum Vorletzten.“[22] Der seltsame Lobgesang bringt den Himmel in Aufruhr, weil er an den Leidensgrund erinnert, der die Sehnsucht nach dem Himmlischen überhaupt erst weckt. Ganz im Sinne der letzten Gedichte Heinrich Heines: „Der Pelide sprach mit Recht: / Leben wie der ärmste Knecht / In der Oberwelt ist besser, / Als am stygischen Gewässer / Schattenführer sein, ein Heros, / Den besungen selbst Homeros.“[23] Die so reizend ausgemalte Himmelswelt als Entschädigung für entgangenes Erdenglück wird einer radikalen Kritik unterzogen. Von diesem Verdikt ausgenommen wäre aber Das himmlische Leben aus „Des Knaben Wunderhorn“, das Gustav Mahler vertont hat. Hier in dem Volkslied ist gewissermaßen die Kritik Kellers im Tanzlegendchen schon antizipiert, weil das Himmlische materiell-irdisch ausgemalt wird. In einer Mischung von spielerischer Feierlichkeit und kindlichem Übermut singt der Sopran in Mahlers Vertonung: „Wir führen ein englisches Leben, sind dennoch ganz lustig daneben. Wir tanzen und singen, wir hüpfen und springen. Sankt Peter im Himmel schaut zu.“ Dann unterbricht ein Orchesterzwischenspiel mit Gegacker und Schellengeläut die liebliche Stimmung des ersten Verses. Der himmlische Gemüsegarten wird beschrieben, der alles Gute hergibt. Der Himmel wandelt sich zu einer Art Schlaraffenland, Rehbock und Hasen eilen freiwillig herbei, Petrus bringt Fische, Martha kocht. Die biblischen Figuren werden ihrer Spiritualität entkleidet und wieder zu nützlichen Dienstleistern, zu Fischern und Köchinnen, die den Seligen ein köstliches Mahl bereiten, eben das, was auf Erden dem armen Volk oft verwehrt war. Sehr zart und geheimnisvoll ertönt dann nach einem erneuten Zwischenspiel in der Schlussstrophe die Musik der himmlischen Hofmusikanten, und zwar in der traumhaften Tonart E-Dur zu den Worten: „Kein Musik ist ja nicht auf Erden, die unsrer verglichen kann werden“. Das Stück endet mit dem geheimnisvollen Satz:„Die englischen Stimmen ermuntern die Sinnen, daß alles für Freuden erwacht.“ 4. Ein freiheitlicher Orgelsturm in der DDR
Es ist dies der inständige Wunsch nach einer durch die Macht der Orgelmusik bewegten Unterbrechung einer ideologisch gleichgeschalteten Gesellschaft, in der keine freie Meinungsäußerung und abweichendes Verhalten geduldet wird. Er wird mit Inbrunst vorgetragen und erinnert daran, dass das Orgelinstrument und die Musik, die auf ihm gespielt wird, ad maiorem Dei gloriam erklingt. Also Einspruch ist gegen einen Staat, der sich selber absolut setzt. Sachsen und Thüringen waren die Stammlande der Reformation und damit auch einer Musikkultur, die an den Höfen und in den Bürgerkirchen zu ihrer schönsten Entfaltung kam mit dem Höhepunkt Johann Sebastian Bach. Die daher auch in diesen lange absolutistisch geführten Staaten immer ein Anderssein und einen Freiraum bot. Auch wenn der die spezifisch sächsische Musikkultur tragende Glaube im 20. Jahrhundert durch zwei Diktaturen stark geschwächt war, die ganz und gar unpolitischen Orgelkonzerte wurden von dem totalitären Staat sehr schnell als etwas begriffen, das seinem Einfluss entzogen war. Deswegen die Abmahnungen, die versuchte Gängelung der Schüler.[25] Ein schöner Trost. Die Heilige Cäcilie als Patronin der Orgel übte in den Kirchen- und Orgelkonzerten der DDR trotz staatlicher Kontrolle immer noch ihre Macht aus. Sie bot einen Freiraum und stärkte die Widerstandskräfte. Sie ging mit den Teilnehmern der Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche im Oktober 1989 auf die Straße und sang dort mit ihnen „We shall overcome“, sodass wundersamerweise die Polizei in ihren Kasernen blieb und nicht einschritt. Denn „auf alles waren wir gefasst. Nur nicht auf Gebete und Kerzen“, sagte später Horst Sindermann, eine führender DDR-Politiker. Und nicht auf die transformierende Macht der Musik. Anmerkungen
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/106/hjb54.htm |
 Dass die Schönheit der Musik mit dem Schrecken verschwistert ist, hat Heinrich von Kleist in der Novelle Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. Eine Legende dargestellt. In dieser Novellenlegende, überarbeitet im 2. Novellenband erschienen, wird ein anderes Verständnis der Tonkunst vorgeführt, nämlich ihr „ganzer Schrecken“ im Gegensatz zu ihrem uns sympathischen besänftigenden Wesen. Die Legende erzählt, wie am Ende des 16. Jahrhunderts die Nonnen vom Kloster der heiligen Cäcilie in Aachen auf wundersame Weise dem Anschlag einer Gruppe von Bilderstürmern entgangen waren. Vier Brüder aus den Niederlanden waren wegen einer Erbgeschichte in der Stadt zusammengekommen und hatten beschlossen, angesteckt von der Schwärmerei in ihrer Heimat und im Übermut ihrer Jugend der Stadt Aachen das Schauspiel einer Bilderstürmerei zu geben. Sie versammeln sich, nachdem sie noch andere zum Mitmachen angestiftet haben, versehen mit Äxten am Fronleichnamstag in der Kirche, um ihr Zerstörungswerk zu beginnen. Nun sollte an diesem Festtag auf Anordnung der Äbtissin „eine uralte italienische Messe von einem unbekannten Meister“ aufgeführt werden, „mit welcher die Kapelle mehrmals schon, einer besonderen Heiligkeit und Herrlichkeit wegen, mit welcher sie gedichtet war, die größten Wirkungen hervorgebracht hatte.“
Dass die Schönheit der Musik mit dem Schrecken verschwistert ist, hat Heinrich von Kleist in der Novelle Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. Eine Legende dargestellt. In dieser Novellenlegende, überarbeitet im 2. Novellenband erschienen, wird ein anderes Verständnis der Tonkunst vorgeführt, nämlich ihr „ganzer Schrecken“ im Gegensatz zu ihrem uns sympathischen besänftigenden Wesen. Die Legende erzählt, wie am Ende des 16. Jahrhunderts die Nonnen vom Kloster der heiligen Cäcilie in Aachen auf wundersame Weise dem Anschlag einer Gruppe von Bilderstürmern entgangen waren. Vier Brüder aus den Niederlanden waren wegen einer Erbgeschichte in der Stadt zusammengekommen und hatten beschlossen, angesteckt von der Schwärmerei in ihrer Heimat und im Übermut ihrer Jugend der Stadt Aachen das Schauspiel einer Bilderstürmerei zu geben. Sie versammeln sich, nachdem sie noch andere zum Mitmachen angestiftet haben, versehen mit Äxten am Fronleichnamstag in der Kirche, um ihr Zerstörungswerk zu beginnen. Nun sollte an diesem Festtag auf Anordnung der Äbtissin „eine uralte italienische Messe von einem unbekannten Meister“ aufgeführt werden, „mit welcher die Kapelle mehrmals schon, einer besonderen Heiligkeit und Herrlichkeit wegen, mit welcher sie gedichtet war, die größten Wirkungen hervorgebracht hatte.“ Eine Quelle für Kleists Novelle könnte Matthias Claudius Besuch im St. Hiob zu *** (1783) gewesen sein, wo er von vier geisteskranken Brüdern berichtet, die jedes Mal, wenn ein Insasse des Hospitals verstorben war, einen geistlichen Gesang anstimmten. „Die merkwürdigsten von allen aber waren vier Brüder, die in einem Zimmer beisammen sassen gegeneinander über – Söhne eines Musikanten, und Vater und Mutter waren in St. Hiob gestorben. Herr Bernard sagte, sie säßen die meiste Zeit so und ließen den ganzen Tag wenig oder gar nichts von sich hören: nur sooft ein Kranker im Stift gestorben, werde mit drei Schlägen vom Turm signiert, und sooft die Glock gerührt werde, sängen sie einen Vers aus einem Totenliede. Man nenne sie auch deswegen im Stift die Totenhähne.“
Eine Quelle für Kleists Novelle könnte Matthias Claudius Besuch im St. Hiob zu *** (1783) gewesen sein, wo er von vier geisteskranken Brüdern berichtet, die jedes Mal, wenn ein Insasse des Hospitals verstorben war, einen geistlichen Gesang anstimmten. „Die merkwürdigsten von allen aber waren vier Brüder, die in einem Zimmer beisammen sassen gegeneinander über – Söhne eines Musikanten, und Vater und Mutter waren in St. Hiob gestorben. Herr Bernard sagte, sie säßen die meiste Zeit so und ließen den ganzen Tag wenig oder gar nichts von sich hören: nur sooft ein Kranker im Stift gestorben, werde mit drei Schlägen vom Turm signiert, und sooft die Glock gerührt werde, sängen sie einen Vers aus einem Totenliede. Man nenne sie auch deswegen im Stift die Totenhähne.“
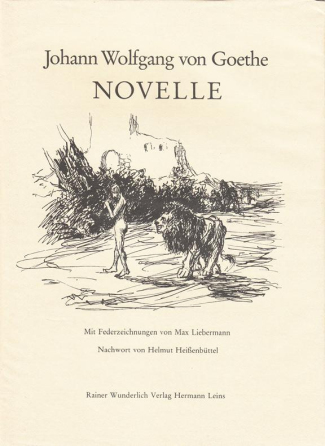 In einem scheinbaren Gegensatz zur Kleistschen Novelle über die Gewalt der Musik steht Goethes schlicht Novelle genannte Erzählung, die die Überwindung der naturhaften Gewalt durch Musik, Liebe und Frömmigkeit schildert. Die Handlung dieser 1828 erschienenen Erzählung spielt in einer mit den Errungenschaften der Aufklärung sympathisierenden Adelsgesellschaft. Während der Fürst zu einer Jagd aufbricht, machen seine junge Gattin, der Oheim und der die Fürstin verehrende Junker Honorio einen Spazierritt zur alten Stammburg, der zunächst über den belebten Markt führt. Dort fällt ihnen eine größere, mit bunten Tier-Bildern bemalte Bretterbude ins Auge, in der gerade die Fütterungsstunde wilder Tiere bevorsteht. „Der Löwe liess seine Wald-und Wüstenstimme hören, die Pferde schauderten.“ Sie schauen sich die dramatischen Tierbilder an: „Es ist wunderbar“, sagt der Oheim, „dass der Mensch durch Schreckliches aufgeregt sein will .Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Käfig, und hier muß er grimmig auf einen Mohren losfahren.“
In einem scheinbaren Gegensatz zur Kleistschen Novelle über die Gewalt der Musik steht Goethes schlicht Novelle genannte Erzählung, die die Überwindung der naturhaften Gewalt durch Musik, Liebe und Frömmigkeit schildert. Die Handlung dieser 1828 erschienenen Erzählung spielt in einer mit den Errungenschaften der Aufklärung sympathisierenden Adelsgesellschaft. Während der Fürst zu einer Jagd aufbricht, machen seine junge Gattin, der Oheim und der die Fürstin verehrende Junker Honorio einen Spazierritt zur alten Stammburg, der zunächst über den belebten Markt führt. Dort fällt ihnen eine größere, mit bunten Tier-Bildern bemalte Bretterbude ins Auge, in der gerade die Fütterungsstunde wilder Tiere bevorsteht. „Der Löwe liess seine Wald-und Wüstenstimme hören, die Pferde schauderten.“ Sie schauen sich die dramatischen Tierbilder an: „Es ist wunderbar“, sagt der Oheim, „dass der Mensch durch Schreckliches aufgeregt sein will .Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Käfig, und hier muß er grimmig auf einen Mohren losfahren.“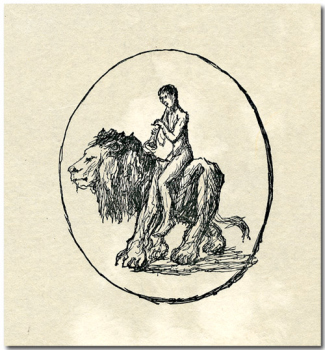 Doch nun bittet die Schaustellerfamilie, inzwischen ist auch der Mann aufgetaucht, das zahme Tier nicht zu töten. Das Kind beginnt auf seiner Flöte zu spielen, „eine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Gesetz und vielleicht eben deswegen so herzergreifend“ (507).
Doch nun bittet die Schaustellerfamilie, inzwischen ist auch der Mann aufgetaucht, das zahme Tier nicht zu töten. Das Kind beginnt auf seiner Flöte zu spielen, „eine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Gesetz und vielleicht eben deswegen so herzergreifend“ (507).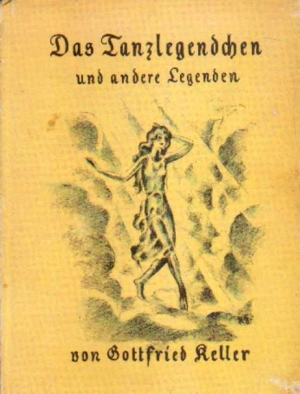 Eine Antwort gibt darauf das Tanzlegendchen Gottfried Kellers. Es ist die letzte der „Sieben Legenden“, in denen er 1871 einer Legendensammlung des protestantischen Theologen Kosegarten von 1804 eine heitere, sinnlich-irdische Deutung der katholischen Mythologie angedeihen ließ. Die Geschichte, die sich ursprünglich beim Heiligen Gregorius findet, handelt zunächst von Musa, einem ebenso frommen wie vom Tanz besessenen Mädchen. Sie dient der Jungfrau Maria, aber sie ist auch von einer unbezwingbaren Tanzlust bewegt, „dermaßen dass, wenn das Kind nicht betete, es unfehlbar tanzte. Selbst wenn sie zum Altare ging, war es mehr ein liebliches Tanzen als ein Gehen.“
Eine Antwort gibt darauf das Tanzlegendchen Gottfried Kellers. Es ist die letzte der „Sieben Legenden“, in denen er 1871 einer Legendensammlung des protestantischen Theologen Kosegarten von 1804 eine heitere, sinnlich-irdische Deutung der katholischen Mythologie angedeihen ließ. Die Geschichte, die sich ursprünglich beim Heiligen Gregorius findet, handelt zunächst von Musa, einem ebenso frommen wie vom Tanz besessenen Mädchen. Sie dient der Jungfrau Maria, aber sie ist auch von einer unbezwingbaren Tanzlust bewegt, „dermaßen dass, wenn das Kind nicht betete, es unfehlbar tanzte. Selbst wenn sie zum Altare ging, war es mehr ein liebliches Tanzen als ein Gehen.“  In dem 1976 veröffentlichten Prosaband von Rainer Kunze Die wunderbaren Jahre steht ein Stück, das schlicht Orgelkonzert heißt. Ausgangspunkt ist eine restriktive Erfahrung im SED-Staat: „Die Schulbehörde in N. wies die Direktoren an zu verhindern, daß die Fach-und Oberschüler die Mittwochabend-Orgelkonzerte besuchen. Lehrer fingen Schüler vor dem Orgelportal ab und sagten den Eltern: Entwederoder. Bald reichten die Sitzplätze im Schiff und auf den Emporen nicht mehr aus. (Meldung, die in keiner Zeitung stand).“ Der Autor kommentiert diese Meldung mit den Sätzen: „Hier müssen sie nicht sagen, was sie denken. Hier umfängt sie das Nichtalltägliche, und sie müssen mit keinem Kompromiß dafür zahlen (…)Hier ist der Ruhepunkt der Woche. Sie sind sich einig im Hiersein. Hier herrscht die Orgel.“ Und dann beginnt eine mit Zitaten von Altnicol, Robert Schumann, Herder und Abraham a Santa Clara illustrierte Rühmung besonders bekannter Orgeln, die Silbermannsche im Dom zu Freiberg, die Orgel in der Wehrkirche zu Pomßen, die Mühlhausener Orgel Johann Sebastian Bachs, die Güstrower Domorgel über Barlachs Schwebendem, die Orgel zu Weimar, unter deren Empore der Sarg Johann Gottfried Herders steht, die Orgel zu St. Peter und St. Paul in Görlitz, die über und über mit Sonnen bedeckte. Kunze zählt sie alle auf und schließt dann: „Alle Orgeln, unter wessen Dach auch immer - müßten mit einem mal zu spielen beginnen, einsetzen mit vollem Werk, mit ihren tiefsten Pfeifen, den zehnmeterhohen und mit ihren höchsten, den millimetergroßen (…) alle Orgeln (und Kunze zählt weitere auf),sie alle müßten plötzlich zu tönen beginnen und die Lügen, von den die Luft schon so gesättigt ist, daß der um Ehrlichkeit bemühte kaum noch atmen kann, hinwegfegen – unter wessen Dach auch immer, hinwegdröhnen all den Terror im Geiste … Wenigstens ein einziges mal, wenigstens für einen Mittwochabend.“
In dem 1976 veröffentlichten Prosaband von Rainer Kunze Die wunderbaren Jahre steht ein Stück, das schlicht Orgelkonzert heißt. Ausgangspunkt ist eine restriktive Erfahrung im SED-Staat: „Die Schulbehörde in N. wies die Direktoren an zu verhindern, daß die Fach-und Oberschüler die Mittwochabend-Orgelkonzerte besuchen. Lehrer fingen Schüler vor dem Orgelportal ab und sagten den Eltern: Entwederoder. Bald reichten die Sitzplätze im Schiff und auf den Emporen nicht mehr aus. (Meldung, die in keiner Zeitung stand).“ Der Autor kommentiert diese Meldung mit den Sätzen: „Hier müssen sie nicht sagen, was sie denken. Hier umfängt sie das Nichtalltägliche, und sie müssen mit keinem Kompromiß dafür zahlen (…)Hier ist der Ruhepunkt der Woche. Sie sind sich einig im Hiersein. Hier herrscht die Orgel.“ Und dann beginnt eine mit Zitaten von Altnicol, Robert Schumann, Herder und Abraham a Santa Clara illustrierte Rühmung besonders bekannter Orgeln, die Silbermannsche im Dom zu Freiberg, die Orgel in der Wehrkirche zu Pomßen, die Mühlhausener Orgel Johann Sebastian Bachs, die Güstrower Domorgel über Barlachs Schwebendem, die Orgel zu Weimar, unter deren Empore der Sarg Johann Gottfried Herders steht, die Orgel zu St. Peter und St. Paul in Görlitz, die über und über mit Sonnen bedeckte. Kunze zählt sie alle auf und schließt dann: „Alle Orgeln, unter wessen Dach auch immer - müßten mit einem mal zu spielen beginnen, einsetzen mit vollem Werk, mit ihren tiefsten Pfeifen, den zehnmeterhohen und mit ihren höchsten, den millimetergroßen (…) alle Orgeln (und Kunze zählt weitere auf),sie alle müßten plötzlich zu tönen beginnen und die Lügen, von den die Luft schon so gesättigt ist, daß der um Ehrlichkeit bemühte kaum noch atmen kann, hinwegfegen – unter wessen Dach auch immer, hinwegdröhnen all den Terror im Geiste … Wenigstens ein einziges mal, wenigstens für einen Mittwochabend.“