
Großes Kino |
||||||||||
|
01. August 2018 Liebe Leserinnen und Leser,
In diesem Aufbruch der Theologie zu neuen kulturellen Entdeckungsfeldern hat sich Jörg Herrmann auf die Film- und Kinokultur konzentriert: Er untersuchte Gemeinsamkeiten und Unterschiede, erläuterte, wie sich Religion im populären Film darstellt und macht deutlich, was populäres Kino und traditionell-religiöse Sinnvermittlung voneinander lernen können. Das ging von Anfang an weit über den Wunsch hinaus, dass auch der Theologe gefälligst ins Kino zu gehen habe. Vielmehr bestimmt er das Kino und den Film als gegenwartsrelevante Erkenntnisform, die man religionstheoretisch und theo-ästhetisch nur unter Strafe der Ignoranz vernachlässigen darf. Dabei "profilierte er den neuen Typ einer Theologie, die sich als Religionskulturhermeneutik begreift und am Material, vor allem des populären Films, zur Durchführung bringt", wie Wilhelm Gräb in seinem Beitrag zu diesem Heft schreibt. Seit vierzig Jahren beschäftigt sich Jörg Herrmann mit der "Sinnmaschine Kino" und damit mit dem Verhältnis von Film, Theologie und Religion. Seit knapp 20 Jahren schreibt er dazu auch im Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik, seit knapp 10 Jahren ist er dessen Mitherausgeber. Das Entdeckungsfeld Kino und Film schreibt sich fast schon naturwüchsig weiter. In diesem Jahr sind – nach einer kurzen Flaute – wieder mehr Menschen ins Kino gegangen. Zugleich erweitern Formate wie Netflix das Spektrum, in dem Filme für die Menschen (und ihre religionsproduktive Sozialisation) bedeutsam werden. Das Werk der Erschließung des Mediums Film für das Verstehen von Religion ist also noch nicht abgeschlossen, sondern geht weiter. Wir wünschen Jörg Herrmann für diese weitere Arbeit alles Gute, viele bereichernde Kino-Stunden und viel Muße, über sie nachzudenken (und natürlich: zu schreiben). Und nun zur aktuellen Ausgabe. Das Heft gliedert sich in drei "Abteilungen": In der ersten Abteilung finden Sie Beiträge der Herausgeber: Andreas Mertin und Karin Wendt denken über die "Büchse der Pandora" als Metapher für das Kino und seine Wirkungsmacht nach, Wolfgang Vögele setzt sich mit exemplarischen Christusdarstellungen in Malerei und Film auseinander. Der zweite Abschnitt des Heftes versammelt verschiedene Fest-Beiträge. Wilhelm Gräb schreibt grundlegend über "Theologie als Religionshermeneutik" und Hans Martin Gutmann geht der Verheißung und dem Elend der medialen Kultur nach. Hans J. Wulff untersucht "Feste, Feiern, Partys" im Film und Inge Kirsner stellt den Film „Arrival“ vor. Roland Wicher setzt sich mit „American Gods“ auseinander und Hans-Gerd Schwandt erinnert an Pasolinis "Teorema". Jens Eder untersucht den humanitären Gebrauch Virtueller Realitäten und Jörg Metelmann schreibt über das Selbstporträt in den Social Media. Hans-Jürgen Benedict geht Musik- und Filmerfahrungen mit Hilfe von Jörg Herrmanns Medienanalyse nach und Karsten Visarius kontrastiert Bibeltext und Film mit Hilfe von „Hope“. Im dritten Abschnitt findet sich eine neue Kolumne von Andreas Mertin, die die alte Kolumne „Was ich noch zu sagen hätte“ nach 27 Folgen ablöst. Wir wünschen eine angenehme und erkenntnisreiche Lektüre! Andreas Mertin, Horst Schwebel und Wolfgang Vögele
|
||||||||||
|
||||||||||
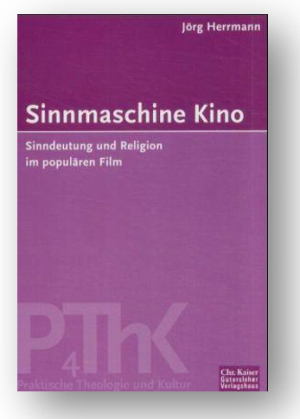 "Populäre Kinofilme" so heißt es zu Jörg Herrmanns Klassiker Sinnmaschine Kino, "inszenieren leidenschaftliche Gefühle und beleben immer wieder den Mythos der großen Liebe. Daneben fragen sie aber auch nach dem Sinn des Lebens und liefern ihre Deutungen.“ Lange Zeit war das Verhältnis der Kirche(n) zum Kino und zum Film, zum populären zumal, eher kritisch und gebrochen. Die Kirche(n) verstanden sich als Kritiker des Populären und Bewahrer der Kultur. Und sie organisierten Proteste gegen ihrer Meinung nach allzu obszöne, moralisch und gesellschaftlich anstößige Filme. In dieser Atmosphäre ist die Generation aufgewachsen, die noch in den 50er-Jahren geboren wurde. Kino hatte den Hauch des Besonderen, des Verbotenen, des Anrüchigen. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf sang Wolf Biermann 1965 (Zu Gast bei Wolfgang Neuss) und so machte sich eine ganze Generation von Theologinnen und Theologen auf, die Felder der populären Kultur zunächst einmal zu verstehen und dann religionshermeneutisch fruchtbar zu machen. Das war die Zeit der ästhetischen Kehren nicht nur in der Praktischen Theologie (Henning Luther, Albrecht Grözinger, Wilhelm Gräb), sondern auch der Gründung verschiedener Arbeitskreise wie dem Arbeitskreis „Theologie und Ästhetik“, dem Arbeitskreis „Pop und Religion“, aber auch der großen ästhetischen Debatten in der Philosophie und Architektur.
"Populäre Kinofilme" so heißt es zu Jörg Herrmanns Klassiker Sinnmaschine Kino, "inszenieren leidenschaftliche Gefühle und beleben immer wieder den Mythos der großen Liebe. Daneben fragen sie aber auch nach dem Sinn des Lebens und liefern ihre Deutungen.“ Lange Zeit war das Verhältnis der Kirche(n) zum Kino und zum Film, zum populären zumal, eher kritisch und gebrochen. Die Kirche(n) verstanden sich als Kritiker des Populären und Bewahrer der Kultur. Und sie organisierten Proteste gegen ihrer Meinung nach allzu obszöne, moralisch und gesellschaftlich anstößige Filme. In dieser Atmosphäre ist die Generation aufgewachsen, die noch in den 50er-Jahren geboren wurde. Kino hatte den Hauch des Besonderen, des Verbotenen, des Anrüchigen. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf sang Wolf Biermann 1965 (Zu Gast bei Wolfgang Neuss) und so machte sich eine ganze Generation von Theologinnen und Theologen auf, die Felder der populären Kultur zunächst einmal zu verstehen und dann religionshermeneutisch fruchtbar zu machen. Das war die Zeit der ästhetischen Kehren nicht nur in der Praktischen Theologie (Henning Luther, Albrecht Grözinger, Wilhelm Gräb), sondern auch der Gründung verschiedener Arbeitskreise wie dem Arbeitskreis „Theologie und Ästhetik“, dem Arbeitskreis „Pop und Religion“, aber auch der großen ästhetischen Debatten in der Philosophie und Architektur.