
Großes Kino |
|
Alle tun es, mehr oder weniger häufig, mehr oder weniger cool, mehr oder weniger gefährlich, mehr oder weniger aufreizend. Und fast alle machen es öffentlich, posten ihre Selbstbildnisse in Netzwerken milliardenfach für ein potenzielles Milliardenpublikum. Selfies, die vor allem mit internetfähigen Smartphones hergestellten Schnappschüsse der eigenen Person, stellen so „eine beispiellose Selbstermächtigung über das eigene Konterfei und […] eine Rebellion gegen die Despotie des ‚Bitte recht freundlich‘“ dar, wie ein Feuilleton-Kommentar in der SZ festhält.[1] Das Wort selbst suggeriert dabei seinerseits Freundlichkeit, Vertrautheit, ja Kuscheligkeit, ist es doch grammatikalisch besehen eine Diminutivform, ein ‚kleines Selbst‘, ein ‚Selbstchen‘. Das mag die Kulturkritikerin darin bestärken, „den Vater des Selfie im Smiley“ zu sehen, wie in einer NZZ-Glosse von Barbara Höfler vorgetragen.[2] But the Selfie’s smile is killing, seine Kuscheligkeit ist radikal. Das Smartphone hat nicht nur die Produktionsmittel weiter demokratisiert, indem es Foto- mit Internetfunktion verbindet, sondern es hat mit dem iPhone 4 auch den Narzissmus normalisiert: Die integrierte Doppelkamera schaute nach vorne und nach hinten und stellte so 2010 neben das Fenster zur Welt den Spiegel des Ich. Das Selbstbildnis, die Königsdisziplin neuzeitlicher Identitätsformung, war plötzlich Alltag wie Zähneputzen und öffentlich wie Trinkwasser. Das Selfie erlaubt es seither, technisch ganz unaufwändig visuell man selbst zu sein – das Ich im Dialog mit dem kleinen Bild-Selbst, im Gespräch mit der Welt im Buch der Gesichter. Der Slogan „Ich auf Facebook“ klingt nach der Erfüllung des alten Wunsches nach „intimer monologischer Offenbarung der Persönlichkeit“, wie es der Kunsthistoriker Wilhelm Waetzold 1908 im Hinblick auf das künstlerische Selbstporträt formulierte.[3] Und es klingt nach der technischen Implementierung der Erkenntnis Montaignes, die Spielarten seines Selbst seien wie Seiten eines Buches. Es scheint also, als sei das Signum der westlichen Moderne in Kunst und Gesellschaft, nämlich der Weg von der Kollektiv-Persona zum das Selbst fortwährend erkundenden Individuum, im Selfie über Nacht zu einer globalen Selbstverständlichkeit und massenmedialen Wirklichkeit geworden. Ich möchte diesen Anschein im Folgenden in drei Hinsichten betrachten und prüfen: Erstens soll der Kunst-Fährte, eigentlich schon mehr ein Trampelpfad, nachgegangen und eine Matrix des Selbstporträts skizziert werden. Zweitens möchte ich mit dieser Heuristik die Selfie-Bildpraktiken auf Facebook analysieren und dabei die Aspekte Kontingenzmodulation und Impressionsmanagement konturieren. An den Schluss stelle ich die These, dass das Selfie eine neoliberale Selbsttechnologie in der Spannung zwischen Individualisierung und Totalisierung ist. 1. SelbstporträtWie selbstverständlich das Selfie in die Tradition des Selbstporträts eingereiht wird, belegte eine Ausstellung im New Yorker Museum of Modern Art im Frühjahr 2015. Dort wurde erstmals eine US-Werkschau der im Mai 2015 im Alter von 94 Jahren verstorbenen österreichischen Künstlerin Maria Lassnig gezeigt, deren „Körperbewusstsein“-Bilder mittlerweile als Klassiker der Nachkriegskunst gehandelt werden. Was haben nun diese Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder mit den uns bekannten Schnappschüssen zu tun? Kurator Peter Eleey gibt eine Antwort: Für ihn sei Lassnig die „perfekte Künstlerin für das Zeitalter des Selfie“, denn ihre Selbstbildnisse arbeiteten an der Grenze zwischen Körperwahrnehmung und Repräsentation auf ähnliche Weise wie eine Selfie-Kultur, die nach einer authentischen Darstellung der Individualität strebe. Die malerischen Selbst-Ausweidungen – „self-eviscerations” (auch: Verstümmelung) – der Österreicherin seien strukturell als Vorläufer der Bekenntniskultur der Social Media zu sehen. Hier wie dort würden die eigenen Wahrnehmungen und Gefühle öffentlich über bildhaften Ausdruck ergründet und dargestellt.[4] Auch wenn dieser Vergleich von vielen Kommentatoren für abwegig erklärt wurde, da sich Lassnig ausdrücklich nicht auf fotografische Vorlagen beziehe, gestand doch ein Rezensent zu, dass zwar der Selfie-Expressionismus „im Moment noch die Tendenz [habe], innere Zustände in konfektionierten Posen nach außen zu stülpen“, das dahinter liegende „[offensichtliche] Ausdrucksbedürfnis“ in Lassnigs Bildern aber eine „historische Verbündete“ finde.[5] In dieser New Yorker Diskurs-Miniatur finden sich drei zentrale Topoi der Kulturgeschichte von Selbst und Bild, die ich nun kurz zu einer Interpretationsmatrix für das Selfie verbinden möchte. Erstens deutet der Kuratorenkommentar auf die Logik der Repräsentation, nach der sich das punktuell Wahrgenommene, hier der Körperzustand bei Lassnig, in der Abbildung notwendig entzieht. Dies gilt nicht nur für Körperzustände, sondern auch für die Beziehung von lebendigem Gesicht und Selbstbildnis: Nicht nur tragen wir oftmals Mimenmasken, die sich – aufgesetzt lächelnd, den Ärger verbergend – von Sekunde zu Sekunde ändern, auch steht jedes Porträt als materialisierte Bild-Maske unter dem Vorbehalt der Verfehlung, wie Hans Belting in seiner „Geschichte des Gesichts“ festhält: „Das Porträt machte stets das Versprechen, eines Selbst habhaft zu werden, und hinterließ zugleich die Enttäuschung, wenn hier das Selbst auf einer Oberfläche entglitt. Der Maske konnte selbst die Fotografie nicht entgehen.“[6] Gesicht und Maske stehen in dem Verhältnis von Natur und Kultur, in dem sich physische Bewegung und kulturelle Sistierung wechselseitig bedingen und ergänzen. Beide sind Bilder, die den Zwängen der Repräsentation unterliegen – insofern ist die Bildmaske auch kein ‚falscheres‘ Ich als das Gesicht mit seinen wechselnden Zügen, obwohl das natürlich ein langlebiges Vorurteil ist. Beide bilden hier die erste Achse.
Das genannte „individuelle Ausdrucksbedürfnis“ ruft schließlich drittens die Semantik der einzigartigen Persönlichkeit auf, des Individuums im emphatischen Sinne. In dieser Argumentationslinie, die von Jacob Burckhardt ausgeht, ist das Kunstwerk die bildgewordene Suche nach dem ureigenen Selbst. Maßgeblich durch den Burckhardt-Erben Wilhelm Waetzold wurde die These von der neuzeitlichen Individualität/Porträt-Doublette ausgeweitet und dabei zugleich vereinfacht. In Waetzolds Schrift „Die Kunst des Porträts“ von 1908 wurde das Bildnis, wie die Kunsthistoriker Ulrich Pfisterer und Valeska von Rosen festhalten, „sichtbarer Beweis für die Individualität des Menschen – mit der Annahme, dass sich der innerste Charakter des künstlerischen Individuums in seiner äußeren Erscheinung, genauer in den individuellen Gesichtszügen manifestierte.“[7] Waetzold verband Individualität, Innerlichkeit, Charaktereigenart, Gesichtsausdruck und Einfühlungsästhetik und deutete so, wie schon eingangs zitiert, das Kunstwerk als „intime monologische Offenbarung der Persönlichkeit“.[8] Eine solche pointierte Burckhardt-Lesart bot auch die Möglichkeit einer klaren, kontinuierlichen Entwicklungsperspektive: Das Mittelalter als ein „Davor“, die Renaissance als ein Anfang und die Aufklärung, Romantik und das 19. Jahrhundert als die Klimax. Das Kriterium lautete stets: Emphatische Individualität ist der Gradmesser von Modernität und schlägt sich im Selbstporträt nieder, das Erstere ergründend ausdrückt. Um nun zu Facebook zu kommen, bedarf es in unserer Skizze natürlich noch der Fotografie, die in technikgeschichtlicher Perspektive für Porträt wie Selbstporträt eine Wendemarke darstellt. Sie beschleunigte und präzisierte auf zuvor unbekannte Art und Weise die Möglichkeit, Lebensmomente einfach zu dokumentieren und garantierte so, dass, wie Ulrich Raulff schreibt, „niemand mehr bilderlos und niemand mehr gesichtslos leben“ werde.[9] Eine der berühmtesten Foto-Dokumentationen ist in diesem Sinne das Porträtprojekt „Antlitz der Zeit“ von August Sander. Die kontroverse Rezeption des Projekts dient dabei als Blaupause für das Anliegen, das Selfie im Hinblick auf das Selbst/Bild zu verorten. Matadoren dieses Streits vor bald 100 Jahren: Alfred Döblin und Walter Benjamin. Döblin perhorreszierte in Sanders Projekt das Ende der individuellen Physiognomie und des bürgerlichen Charakterkopfes zugunsten der „Abflachung der Gesichter“ und einem Zeitalter der „zweiten Anonymität“. Benjamin hingegen begrüßte Sanders neuen dokumentarischen Blick, denn er richte sich gerade nicht mehr nach der Maßgabe des traditionellen Porträts, sondern allein nach der realen Gesellschaftsordnung. Sanders Buch sei daher, so Benjamin in der „Kleinen Geschichte der Fotografie“ auch ein „Übungsatlas“ für die Menschen der demokratischen Moderne.[10] Diese zwei Positionen finden sich so genau auch heute und bestätigen so Beltings Einschätzung, dass der große Streit um Porträt und Selbstporträt in den 1920er Jahren stattgefunden habe, alles danach sei Abklatsch. Er selbst nimmt nun in der aktuellen Selfie-Diskussion die Döblin-Pose ein und konstatiert aktuell den totalen Geschichts- als Gesichtsverlust:
Ich möchte im Folgenden in den Selfies nicht allein unbedeutende Schnappschüsse im Leben der Spektakelgesellschaft unserer Tage sehen, sondern gegen Beltings Döblin-Verdikt mit Benjamin etwas mehr demokratischen Sportsgeist beweisen und Facebook als „Übungsatlas“ der Bild-Seinsweisen globaler Medienmassen empfehlen. 2. Facebook
Dieses Corpus an Bildern kann natürlich niemals repräsentativ sein angesichts von mehreren hundert Millionen Selfies im Netz – zum Vergleich: Das Corpus des New Yorker „Selfiecity“-Projekts von New Media-Vordenker Lev Manovich umfasst auch nur 3200 Selfies. Doch lassen sich trotz des Ausschnittscharakters im Hinblick auf die entworfene Heuristik prägnante Vergleichspunkte festmachen: 1. Der hier betrachtete Facebook-Bild-Diskurs oder -Viskurs ist erstens gekennzeichnet von Alltäglichkeit im Gegensatz zur Außergewöhnlichkeit und Singularität im bürgerlichen Selbstporträt. Der darstellerische Grundmodus ist der einer Illustrierung der einfachen, banalen Existenz, was gar nicht pejorativ gemeint ist. Es geht zentral um Kontingenzmodulation durch Indexikalisierung: „It’s me am Küchentisch“, „It’s me an der Hotelbar“, stets mit der Betonung auf „It’s me…NO FAKE“. In einiger theoretischer Nähe zur Totenmaske wird die Beliebigkeit, Beschleunigung und Flüchtigkeit der postmodernen Existenz unter Verweis auf Referenzpunkte zu domestizieren versucht. Einfach ein Click und schon wieder war ich da, eine Bildmaske, ein Ort, eine Zeit. An diesem Alltagsbefund ändert meines Erachtens auch die Einschätzung „Dauerparty“ von Belting oder das Lamento über die „ShinyHappy-People“ von Höfler im NZZ-Artikel nichts – die Party ist eben eine andere Facette des Alltags in der Aufmerksamkeitsökonomie, man könnte sagen: ein anderes Bildprogramm. Dieses tangiert aber die subjekttechnologische Voraussetzung, auf die ich gleich abschließend komme, überhaupt nicht. Und auch die abweichende Selbst-Modellierung z.B. in exzessiven Gewalt- oder Sex-Szenen ändert nichts am Befund. Denn zumindest in den Social Networks à la Facebook werden diese Bildanomalien qua Meldung durch die Gruppe selbst und Löschung seitens der Plattform normalisiert und in die besagte Alltäglichkeit zurückgeholt. 2. Der Facebook-Viskurs ist zweitens geprägt von einer Dokumentation des Blicks im Gegensatz zur Produktion des Blicks beim traditionellen Selbstporträt. Das hat natürlich zentral mit dem fotografischen Abbildungsmodus zu tun, dessen Zuhandenheit qua Smartphone den eigenen Blick auf das Ich massenhaft routinisiert hat: Das kleine Bild-Selbst, fast schon eine Leibextension, wird zur Dauer-Moment-Maske. Im Sinne von Benjamins Bemerkung aus dem „Kunstwerk“-Aufsatz, dass die „sehr viel größeren Massen der Anteilnehmenden […] eine veränderte Art des Anteils hervorgebracht [haben]“,[12] muss man auch das Verdikt des Narzissmus neu denken, das den basso continuo der konservativen Kritik bildet. So spricht z.B. der National Enquirer vom Selfie als der „Masturbation des Selbstporträts“ am Peak des gesellschaftlichen Narzissmus. Selfies, würde ich dagegenhalten, zeigen keine Narzissten, also ausgeprägte Charaktere oder wahlweise pathologische Subjekte. Sie zeigen viel weniger stabil ein mit Indexikalität aufgeladenes Ich in Einzelsituationen, die auf die soziale Akklamation im Netzwerk hin entworfen sind. Der Blick des Narziss in den Spiegel fällt nicht in erster Linie auf sich zurück, sondern ist eigentlich auf die Social-Web-Arena hin geworfen. In ihr wird von den Akteuren eine spontan-viszerale Reaktion einfordert. Nicht umsonst verweist der „thumb up“-button auf die römisch-antike Panem & Circenses-Praxis des Performance Measurement, wenn auch eben politisch korrekt demokratisiert um den „thumb down“-Knopf verkürzt.[13] 3. Die hier diskutierten Exponate des Facebook-Viskurses lassen sich drittens als additiv-sequenziell beschreiben im Gegensatz zur Einmaligkeit und imaginierten Summe des Charakters beim Selbstporträt, was mit den Punkten Alltäglichkeit und Dokumentation zusammenhängt: Das Selfie ist die visuelle Geschichte einer Individualitäts-Persona im Netz, die sich in verschiedenen Situationen fortschreibt. Zu diesem Sequenzcharakter, dieser Narrativierung als kollektiv codierter Verzeitlichung, passt die Entwicklung, dass man immer mehr Selfie-Filmchen postet. Nimmt man diese Beobachtungen zusammen, so scheint wenig dafür zu sprechen, dass man das Selfie sinnvoll in die Geschichte des Selbstporträts einreihen könnte, wenn man darunter die ästhetische Repräsentationsanordnung verstehen mag, ein überzeitlich-besonderes Selbst in der Spannung zwischen Porträtmaske und Individualitätsmaske entstehen zu lassen. Was das Selfie allerdings seit der nach vorne wie nach hinten aufnehmenden Doppelkamera des iPhone 4 ganz offensichtlich in den kulturgeschichtlichen Kontext stellt, ist die Prominenz des Spiegels – also der Bezug zu einer Untergruppe von künstlerischen Selbstporträts, deren bekanntestes sicherlich Johannes Gumpps „Selbstporträt“ von 1646 ist, der locus classicus zum Verhältnis von Spiegelbild und Selbstbild. Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy hat diesem Selbstporträt eine Studie gewidmet und mit Bezug auf Gumpp zwei Ähnlichkeiten benannt: Die mechanisch-optische Ähnlichkeit des Spiegelbildes und die imaginär-reflexive Ähnlichkeit des Porträts.
Dieser Wertung folgt auch Nancy, denn für ihn ist dieses Spiegelbild – le reflet – vom Narzissmus imprägniert. Das Porträt hingegen eröffnet in der Abwesenheit des Spiegel-Gesichts die Möglichkeit, sich selbst im Formungsakt ähnlich zu werden. Denn nur diese Absenz schafft den Raum, um „den Bezug zu einem anderen in sich selbst oder zu sich selbst als einem anderen“ herzustellen.[14] Im Porträt wird man sich auf andere Weise ähnlich als im Spiegel und die Produktion von Nicht-Spiegel-Ähnlichkeit ist für Nancy die conditio sine qua non, jenseits der bloßen Abbildung ein Selbst zu formen, das auf anderes als das schon Sichtbare zielt. Im Übertrag auf den oben analysierten Facebook-Viskurs wäre dann zu konstatieren, dass sich hier überhaupt kein Selbst zeigt, ja zeigen kann, denn die Person ist immer im narzisstischen Spiegel präsent. D.h. obwohl die Person uns anblickt bzw. sich uns mit ihrem Gesicht zeigt, bleiben wir immer in der Ähnlichkeit der Spiegelung, in der Präsenz des Gesichts als Moment-Maske hängen. Es wird ergo nicht der Rahmen geschaffen, in dem sich uns diese Person als andere offenbaren kann. Selfies zeigen also, will man Nancys These folgen, gar kein Selbst. Was aber zeigt sich dann? 3. SubjekttechnologieEs zeigen sich Profile, die in der Spannung zwischen Individualisierung und Totalisierung stehen – einerseits sind es die je einzelnen Personen, andererseits bewegen sie sich im visuellen Rahmen von Kategorien wie den genannten, die die Gestaltungsmöglichkeiten nicht per se, sondern technisch präfiguriert unter sozialem Normierungs- und Normalisierungsdruck beschränken. Das Motto: Jeder kann einen solchen Account, kann ein solches face haben, das ihr oder ihm singuläre Allgemeingültigkeit gibt – du bist akzeptierter Teil der großen Community, indem du dich auf diese Darstellungsplattform stellst bzw. in diesen Bildrahmen einlässt! „Singuläre Allgemeingültigkeit“ ist der Begriff, den Michel Foucault in seinen Überlegungen zum Werden der neoliberalen Gesellschaftsformation als Umschreibung für die „Gouvernementalität“ gebraucht, womit er die Art und Weise bezeichnet, „mit der man das Verhalten der Menschen steuert“.[15] „Gouvernementalität“ als strategisches Feld von Machtverhältnissen übersetzt sich dann konkret in „Techniken und Verfahren“, die in Foucaults Deutung „dazu bestimmt sind, das Verhalten der Menschen zu leiten“.[16] Das ist die berühmte „Conduite de conduite“, ins Deutsche mit „Führung der Selbstführung“ übersetzt, aber es schwingt eben auch die Haltung und damit Habitus bzw. Hexis und Ethos mit. Die Bildpraktiken auf Facebook scheinen mir in diesem Kontext am schlüssigsten beschrieben. Ich sehe den skizzierten Viskurs als Ausdruck eines Arrangements, das Verhalten der Menschen dabei anzuleiten, wie man visuell man selbst sein kann. Anders formuliert: Das Selfie führt bei der visuellen Selbstführung. Das „Self“ in „Selfie“ ist daher nicht so zu verstehen, dass sich ein originäres Selbst zum Ausdruck bringt. Es geht nicht, wie in meinem Titelspender-Zitat der HipHop-Formation De la Soul, um eine Sprache der Seele, für die allein man selbst die Worte finden müsste – der Refrain hieß damals, 1989: „When it comes to being De La, it’s just me, myself and I“. Darum geht es nicht.
Anmerkungen[1] SZ, 4.4.2014: http://www.sueddeutsche.de/kultur/kunst-und-selfies-eine-historische-verbuendete-1.1928903 [11.07.2018]. [2] Barbara Höfler: Das Selfie und Ich. In: Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 3.4.2014. [3] Zitiert in: Ulrich Pfisterer/Valeska von Rosen (2005): Vorwort: Der Künstler als Kunstwerk. In Dies. (Hrsg.) Der Künstler als Kunstwerk. Selbstporträts vom Mittelalter bis zur Gegenwart (11–23). Stuttgart: Reclam, 13. [4] Zitiert nach Financial Times, 2.4.2014: https://www.ft.com/content/c44e242a-b8ec-11e3-98c5-00144feabdc0 [11.07.2018] [5] Süddeutsche Zeitung, 4.4.2014, a.a.O. [6] Hans Belting (2013): Faces. Eine Geschichte des Gesichts. München: C.H. Beck, 213. [7] Vgl. Pfisterer/von Rosen, a.a.O, 13. [8] Ebd. [9] Ulrich Raulff (1984): Image oder Das öffentliche Gesicht. In: Dietmar Kamper/Christoph Wulff (Hg.), Das Schwinden der Sinne. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 46–58, hier: 53. [10] Walter Benjamin (1963): Kleine Geschichte der Fotografie. In: Ders., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit. Drei Stufen zur Kunstsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 84f. [11] Belting, Faces, a.a.O., 214/215. [12] Benjamin, Kunstwerk, a.a.O., Abschnitt XV. [13] Vgl. hierzu auch: Ramón Reichert (2015): Selfie Culture. Kollektives Bildhandeln 2.0. POP. Kultur und Kritik, Heft 7, 86–96. [14] Jean-Luc Nancy (2015): Das andere Porträt. Zürich: diaphanes, 41/47. [15] Michel Foucault (2006): Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität II. Vorlesungen am Collège de France 1978/1979. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 261. [16] Ebd., 483. [17] Daniel Rubinstein (2015): The Gift of the Selfie. In: Alain Bieber (Hrsg.). Ego Update – Zukunft der digitalen Identität (162–176). Düsseldorf: Walther König. [18] Weitere «Übungen» finden sich in: Jörg Metelmann (2017): Selfies. In: Timon Beyes/Jörg Metelmann/Claus Pias (Hg.): Nach der Revolution. Ein Brevier digitaler Kulturen. Hamburg: Edition Speersort, 25–35; und: Jörg Metelmann/Thomas Telios (2018): Putting Oneself Out There. The “Selfie” and the Alter-Rithmic Transformations of Subjectivity. In: Emmanuel Alloa/Dieter Thomä (Hg.): Transparency, Subjectivity, Society: Critical Perspectives. London: Palgrave MacMillan, pp. 323-341. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/114/jmet01.htm |

 Zweitens deuten die „konfektionierten Posen“, von denen der Rezensent spricht, auf die Tradition des Porträts als Sittenbild, also die soziokulturellen Codierungen der Fragen ‚Wer darf dargestellt werden?‘, ‚Wer darf in welcher Situation dargestellt werden?‘ und schließlich ‚Wer darf sich selbst darstellen?‘. Das Porträt steht seit der Renaissance bekanntlich für die Emanzipation des Subjekts von höfischer Herrschaft und kirchlicher Bevormundung. Es demonstriert im wahrsten Sinne des Wortes anschaulich die frühneuzeitliche Entdeckung des Individuums. Produktionsästhetisch bedeutet dies für das Selbstporträt die Erfindung des Blicks auf das Ich, und das anfangs schon aus dem einfachen Grund, dass zunächst nur das Konvexspiegel-Konterfei zur Verfügung stand. Dieses galt es, wie in Jan van Eycks „Selbstbildnis“ von 1433, in ein Flachspiegelporträt zu übersetzen, also: Das Sehen war zuallererst eine Imagination. Erfindung des Blicks aber auch aus dem weiteren Grund, dass das gemalte Porträt im Gegensatz zur Lebend- oder Totenmaske nicht indexikalisch durch Körperkontakt legitimiert war, sondern durch symbolische Darstellung gesellschaftlicher Interessen und Positionen. Die Entwicklung der Porträts lässt sich dann beschreiben als eine Inszenierung des Ich, das nicht mehr durch seinen Stand oder ein Amt, sondern durch Individualität und Privatheit, allerdings stets im sozialen Kontext des Self-Fashioning gekennzeichnet war: Das Selbst ist eine Vielzahl von Posen und Masken, es ist eine Persona, eine Porträt-Maske.
Zweitens deuten die „konfektionierten Posen“, von denen der Rezensent spricht, auf die Tradition des Porträts als Sittenbild, also die soziokulturellen Codierungen der Fragen ‚Wer darf dargestellt werden?‘, ‚Wer darf in welcher Situation dargestellt werden?‘ und schließlich ‚Wer darf sich selbst darstellen?‘. Das Porträt steht seit der Renaissance bekanntlich für die Emanzipation des Subjekts von höfischer Herrschaft und kirchlicher Bevormundung. Es demonstriert im wahrsten Sinne des Wortes anschaulich die frühneuzeitliche Entdeckung des Individuums. Produktionsästhetisch bedeutet dies für das Selbstporträt die Erfindung des Blicks auf das Ich, und das anfangs schon aus dem einfachen Grund, dass zunächst nur das Konvexspiegel-Konterfei zur Verfügung stand. Dieses galt es, wie in Jan van Eycks „Selbstbildnis“ von 1433, in ein Flachspiegelporträt zu übersetzen, also: Das Sehen war zuallererst eine Imagination. Erfindung des Blicks aber auch aus dem weiteren Grund, dass das gemalte Porträt im Gegensatz zur Lebend- oder Totenmaske nicht indexikalisch durch Körperkontakt legitimiert war, sondern durch symbolische Darstellung gesellschaftlicher Interessen und Positionen. Die Entwicklung der Porträts lässt sich dann beschreiben als eine Inszenierung des Ich, das nicht mehr durch seinen Stand oder ein Amt, sondern durch Individualität und Privatheit, allerdings stets im sozialen Kontext des Self-Fashioning gekennzeichnet war: Das Selbst ist eine Vielzahl von Posen und Masken, es ist eine Persona, eine Porträt-Maske.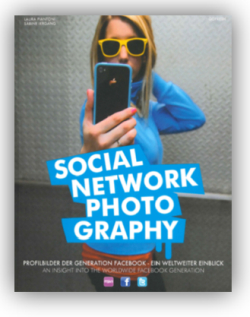 Beginnen wir mit dem Versuch einer Sortierung, ich entnehme sie dem Buch „Social Network Photography – Profilbilder der Generation Facebook“ von 2011. Interessant ist, dass hier nicht ein Theoriekonstrukt am Anfang der Ordnung steht, sondern im Sinne einer Praxis der Gebrauch der Arme. Man kann laut Autorinnen demnach unterscheiden zwischen:
Beginnen wir mit dem Versuch einer Sortierung, ich entnehme sie dem Buch „Social Network Photography – Profilbilder der Generation Facebook“ von 2011. Interessant ist, dass hier nicht ein Theoriekonstrukt am Anfang der Ordnung steht, sondern im Sinne einer Praxis der Gebrauch der Arme. Man kann laut Autorinnen demnach unterscheiden zwischen: Auf der linken Bildhälfte tauscht Gumpp seinen für uns unsichtbaren Blick mit dem für uns sichtbaren Spiegelbild, auf der rechten Bildhälfte lässt er das Gesicht im Porträt als gemalte Maske aus dem Bild heraus auf uns blicken. Dabei gibt er auch eine allegorische Wertung ab, denn links positioniert er die Katze als Bild für die listige Täuschung, rechts den Hund als Symbol für die Treue.
Auf der linken Bildhälfte tauscht Gumpp seinen für uns unsichtbaren Blick mit dem für uns sichtbaren Spiegelbild, auf der rechten Bildhälfte lässt er das Gesicht im Porträt als gemalte Maske aus dem Bild heraus auf uns blicken. Dabei gibt er auch eine allegorische Wertung ab, denn links positioniert er die Katze als Bild für die listige Täuschung, rechts den Hund als Symbol für die Treue. Vielmehr ist das „Selfie“ als Sigle für eine Technik zu verstehen, an der Schnittstelle von technischer Möglichkeit und sozialer Inklusion – Smartphone und Social Media – die eigene Person als Profilbild so zu dokumentieren, dass es möglichst viel Eindruck macht, sprich: Likes erhält. Der Selfmade-Expressionismus ist genau besehen ein Impressionismus. Das Selfie in der Social-Web-Ära, also im Sharing-Modus,
Vielmehr ist das „Selfie“ als Sigle für eine Technik zu verstehen, an der Schnittstelle von technischer Möglichkeit und sozialer Inklusion – Smartphone und Social Media – die eigene Person als Profilbild so zu dokumentieren, dass es möglichst viel Eindruck macht, sprich: Likes erhält. Der Selfmade-Expressionismus ist genau besehen ein Impressionismus. Das Selfie in der Social-Web-Ära, also im Sharing-Modus,