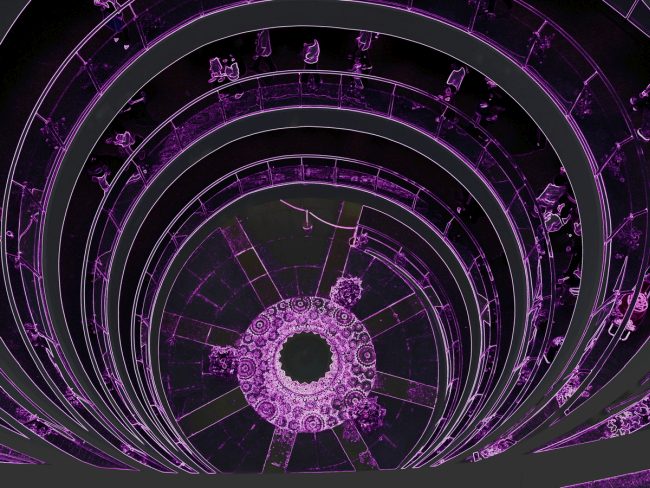Kirchenkritik |
Kritik der aufblasbaren KircheÜber Klerikalismus, Banalität und GleichheitWolfgang Vögele 1. Eingefahrene Gleise
Wer sich umschaut, bemerkt sehr schnell, dass sich andere Institutionen ebenfalls in Krisen befinden, Verfallserscheinungen zeigen und dass darüber geredet wird. Wie die Kirchen verlieren Gewerkschaften und Parteien Mitglieder, ohne dass sie sich solchen Schrumpfungsprozessen wirksam entgegenstellen können. Solche Krisensymptome setzen sich in den politischen Raum hinein fort: Das Aufkommen eines europäischen Rechtspopulismus, nationalistische Bewegungen, die Unfähigkeit, den Flüchtlingsströmen mit einem wirksamen politischen Konzept zu begegnen, haben dazu geführt, dass Wissenschaftler und Journalisten von Krisen der Europäischen Union, von Krisen der Demokratie, von Krisen des westlichen Politikmodells reden. Im politischen Raum fehlt es nicht an Lösungsvorschlägen, aber man hat den Eindruck, dass über der Kurzatmigkeit aktueller medialer Aufmerksamkeit Strategie, langfristiges Planen und eine nachhaltig geduldige Reformpolitik auf der Strecke bleiben. Letzteres wäre notwendig, um im Politischen und Kirchlichen Probleme, die man angehen muss, und Krisenempfindungen zu unterscheiden. Eine andere Krise, die theologisch und kirchlich relevant erscheint, zielt auf die veränderte Rolle der Intellektuellen in öffentlichen Debatten. Immer wieder haben in letzter Zeit Intellektuelle beklagt, dass ihre philosophischen und politischen Interventionen nicht mehr in der Weise gehört werden, wie das noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Wer sich wie in der nostalgisch verklärten Vergangenheit in Essays und Büchern zu Wort meldet, wird kaum noch gehört, weil beides nicht mehr gelesen wird. Auf Twitter und Facebook, in Kommentaren von weniger als tausend Zeichen, kann niemand Meinungen, Kritik, Projekte und Initiativen ausreichend begründen. Dasselbe gilt für politische und kulturelle Talkshows, die zwar noch Reichweite und Zuschauerquoten versprechen, aber eben nicht mehr der Ort sind, ausführlich, begründet und auf hohem Niveau Argumente auszutauschen und Vorschläge zu machen. Auch dieser Prozess der De-Intellektualisierung der Gesellschaft schlägt in die Kirchen hinein, und er zeigt sich am schwindenden Einfluss der Theologie auf das kirchliche und gemeindliche Leben.[1] Beispiele dafür sollen in den folgenden Überlegungen dargestellt werden. Es ist der Prozess der Banalisierung zu beschreiben, dem kirchliches Leben im Moment unterworfen ist (2.-9.). Danach sollen Ursachen für solche Banalisierungsprozesse beschrieben werden (10.-13.), die im Moment zu neuen theologischen Deutungsmodellen verdichtet werden, weswegen solchen Modellen ebenfalls ein kritischer Blick gebührt (14.-17.). Am Ende steht ein unzureichender, erster Vorschlag, die gegenseitige Lähmung zwischen Kräften der Kritik und der Beharrung zu überwinden (18.). 2. Klerikale Banalisierung und Marketing
Alle Landeskirchen haben in den letzten beiden Jahrzehnten ihre Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, heute gern „Zentrum für Kommunikation“ genannt, erheblich verstärkt. In der Regel geschieht dies zu Lasten der theologischen Expertise. Verkauf tritt an die Stelle von theologischer Überlegung. Bilder, Schrifttypen und Layout werden wichtiger als Begründungen und Argumente. Das Argument gegen die angeblich überkommene Theologie lautet, dass aus dieser Ecke nur „Bleiwüsten von Texten“ geliefert würden, mit denen kein Journalist etwas anfangen könne. Langfristig setzt sich so eine Schicht banaler Glaubensaussagen, angefüllt mit viel heißer Luft und vor keiner Vereinfachung und Banalisierung zurückschreckend, an die Stelle von theologischen Argumenten und Verkündigung. Anbiederung und Anpassung treten an die Stelle von Bibellektüre und theologischen Überlegungen. Ich bin nicht gegen Öffentlichkeitsabteilungen, sie sind sinnvoll und notwendig. Aber dort wo die Preisgabe der Theologie sich mit einem banalen Glaubensmarketing verbindet, ist nach meiner Überzeugung Widerspruch angezeigt – bei den Inhalten, bei den Methoden und nicht zuletzt bei den Personalplänen. Wenn die Öffentlichkeitsabteilung alle theologischen Erklärungen und Dokumente auf ein schlichtes, banales Niveau herunterbricht und das damit begründet, dass Theologie und Kirchenleitung nur so nicht kirchlich sozialisierten Journalisten zu vermitteln sind, dann arbeiten plötzlich die eigenen Unterstützer an der Bankrotterklärung kirchlicher Botschaften. Wenn die Werbeagentur plötzlich bestimmt, welche theologischen Inhalte in einer Broschüre oder in einem Prospekt weitervermittelt werden können, dann müssten die theologischen Mitarbeiter der kirchlichen Verwaltung, wenn es sie denn überhaupt noch gibt, eigentlich Einspruch erheben. Aber sie tun es häufig nicht. Stattdessen lassen sie sich auf lange Diskussionen über Bilder und Layout ein. Der Prozess der zunehmenden Überformung kirchlicher Botschaften durch Marketing und Layout geht von einer Reihe von falschen Voraussetzungen aus. Glaube ist kein Produkt, dem man einfach mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Er ist keine Ware, für die man Werbung machen kann. Er geht auch nicht in einer Haltung schaumiger, oberflächlicher Positivität, als die ihn die Marketingexperten manchmal hinstellen. Das Buhlen um Aufmerksamkeit durch Vereinfachung hat zu einer Dichotomisierung der evangelischen Botschaft geführt, in einen einfachen, harmlosen, banalen und für alle verständlichen Teil, eine süßliche Schaumschicht des angeblich „Einladenden“ und auf der anderen Seite in einen angeblich strengen, unverständlichen, komplizierten, altvorderen Teil, der gerne das „Schwarzbrot“ des Glaubens genannt wird. Mit dieser Zweiteilung ist aber niemandem gedient. Irgendwann wird diese Strategie dazu führen, dass die Verharmlosung siegt. Aber ein harmloser, banaler Glaube entspricht nicht dem Evangelium – um das wenigste zu sagen. 3. Liturgisches Bröckeln
Man kann diese Dezentralisierung des Gottesdienstes auch an verräterischen Sprachgepflogenheiten feststellen: Der eigentlich von der Agende vorgesehene, normale Hauptgottesdienst wird plötzlich zum „traditionellen“ Gottesdienst, während die banalisierten Formen „Familiengottesdienst“ genannt werden. Es soll hier nicht die Angemessenheit von Familiengottesdiensten bestritten werden, diese sind notwendig und sinnvoll. Aber es ist zu bestreiten, dass die Banalisierungen, die sich Pfarrer und Gottesdienstteams im Namen der Angemessenheit und Verständlichkeit für Kinder gestatten, zunehmend die gewachsene, praktisch-theologisch legitimierte Theologie ersetzen. Einfachheit und Verständlichkeit müssen nicht intellektuell anspruchslos sein, ganz im Gegenteil. Aber dieses Argument darf nicht ausgenutzt werden, um sich Banalisierungen, Schludrigkeiten und Vereinfachungen zu gestatten, wie es weithin geschieht. Eine ähnliche Entwicklung zu Banalisierung und Dezentrierung ist in der Kirchenmusik[2] festzustellen. Es macht einen großen Unterschied, ob man Kirchenmusik als Musik für die Kirche oder als Musik in der Kirche versteht. Im ersten Fall ist die Musik eingebunden in Kirchenjahr, Liturgie und gottesdienstliches Geschehen. Im zweiten Fall wird die Musik zur unabhängigen Form, die neben der gemeindlichen Tätigkeit Selbständigkeit beansprucht. 4. Predigtschmonzetten
Auch in diesem Fall laufen gesellschaftliche und kirchliche Krisen parallel. Die Bereitschaft sich einen Vortrag anzuhören, sei es eine Wahlkampfrede oder einen wissenschaftlichen Vortrag, hat in den letzten Jahren abgenommen. Menschen sind es nicht mehr gewöhnt, über den Zeitraum von zwanzig, dreißig, vierzig Minuten ausschließlich den Worten eines Redners, sei er Pfarrer, Politiker oder Wissenschaftler, zuzuhören. Redner sind deshalb dazu übergegangen, ihre Vorträge mit Bildern zu garnieren, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erhalten. Ist das nicht der Fall, kann jeder Vortragende davon berichten, wie Zuhörer sich mit zunehmender Dauer mehr mit ihrem Smartphone als mit den Thesen des Redners beschäftigen. Solche Prozesse der zunehmenden Fixierung auf das Visuelle lassen auch die rhetorische Tätigkeit des Predigens nicht unberührt. An die Stelle von Narration und Argumenten ist ein lyrisierender, angeblich authentischer Predigtstil getreten, der Stimmungen, Atmosphären und Bekenntnisse pointillistisch aneinanderreiht. Wenn man solche Predigten liest, sieht man immer häufiger, dass sie nicht wie dieser Essay als Fließtext geschrieben sind, sondern im Stil freier Gedichte ohne Versmaß. Predigten werden zu schlechter Lyrik; sie verlieren sich in konventionellen Bildern, die in ihrer Aneinanderreihung oft schief wirken. Dem Zuhörer bleibt keine Zeit, über ein Bild oder eine Metapher nachzudenken, weil er an der schlichten Masse der Bilder ersticken muss. Solche Predigten sind darum keine Gedichte, dagegen wäre gar nichts einzuwenden, sondern kunsthandwerklich gemachte, kitschige Poesie im Stil von Kristiane Allert-Wybranietz. Damit geht einher ein völlig übersteigerter Subjektivismus, der jedes theologische Thema und jede biblische Erzählung mit einem Speckrand aus persönlicher Betroffenheit versieht, so als ob den Predigthörern allein das angeblich Authentische zuzumuten wäre. Aber beim Authentischen handelt es sich nur sehr selten um die Summe dessen, was die Prediger auch theologisch durchdacht haben. Das Authentische, das, was der Prediger meint selbst verantworten zu können, wird als Kriterium des Glaubens oder der Wahrheit missverstanden. Um es sehr deutlich zu formulieren: Das Evangelium wird mit einer Zollschranke des Subjektiven versehen. Die Möglichkeit, dass die Wahrheit des Glaubens das Subjektive erweitern, vergrößern, ja sogar sprengen könnte, wird gar nicht mehr in Betracht gezogen. Wahr kann nurmehr sein, was die Sicherheitskontrolle des subjektiven Ich passiert hat. Insbesondere in Predigten, die in Familiengottesdiensten gehalten werden, ist zunehmend nur noch ganz einseitig von einem lieben Gott die Rede, der gutheißt, segnet, barmherzig ist. Damit aber wird die Weite und der Reichtum biblischen Redens von Gott auf eine einzige Form des harmlosen und banalen Positiven verkürzt. Dieses wird auf die These heruntergebrochen: Gott unterstützt den einzelnen in seiner Authentizität, in seiner Selbstverwirklichung. Das Scheitern von letzterer, der Widerspruch Gottes gegen das sündige Leben des Menschen, kommt nicht mehr vor. Ich will nicht zurückkehren zur schwarzen Homiletik der Rede vom zornigen, strengen Gott. Aber in den biblischen Erzählungen wird ein Gott vorgestellt, der sich mit harmlosen psychologischen Unterstützungsmaßnahmen bei weitem nicht zufriedengibt. Biblische Erzählungen, Gleichnisse, Psalmen, Gebete stellen Gottes Handeln an den Menschen sehr viel komplexer dar. Der – vorsichtig formuliert – vieldeutige Gott ist kein harmloser Gott mehr. Diese theologische Ambivalenz müssen Prediger wie Zuhörer aushalten können. Wenn Prediger sie nicht aushalten, fliehen sie oft in die Eindeutigkeit des gut Gemeinten. Prozesse der Banalisierung treffen die Predigt im inhaltlich-theologischen wie auch im formal-rhetorischen Sinn. Zugespitzt hat sich die homiletische Diskussion in einer Debatte um so genannte leichte Sprache. Diese findet ihren guten Sinn darin, Menschen mit Behinderung in einfach formulierten, nach bestimmten Stilregeln formulierten Aussagen Informationen zu vermitteln. In diesem Sinne bieten viele Webseiten, vom Bundestag über den Bundespräsidenten bis zu den Kirchen, mittlerweile ihre Informationen auch in leichter Sprache an. Aber es verkennt die Leistungskraft dieses Instruments, wenn man es zu einer Missionsstrategie stilisiert, die in richtiger Absetzung von formelhafter kirchlicher Binnensprache die gesamte Predigttätigkeit auf Prinzipien leichter Sprache zu verpflichten sucht. Wo das geschieht, nimmt die Diskussion um leichte Sprache ideologische Züge an[3], welche die beobachtete Tendenz zur Banalisierung noch verstärken. 5. Leitsätze statt Bekenntnis
Schaut man sich einige der Leitsätze an, ist das Gemeinte mit Leichtigkeit erkennen. Am Anfang heißt es: „Gott liebt die Menschen, ob sie es glauben oder nicht.“ Das ist in seiner schlichten Positivität selbstverständlich theologisch richtig. Aber es wäre auch zu fragen, ob diese schlichte Positivität die Vielgestaltigkeit und den Facettenreichtum der biblisch bezeugten Zuwendung Gottes zu seiner Schöpfung auch mit beinhaltet. In dieser Hinsicht sind Zweifel anzumelden. Die Vereinfachung des Leitsatzes unterschlägt den Spannungsreichtum und die Ambivalenz, welche in dieser Zuwendung Gottes zu den Menschen stecken. Über die Kirche heißt es in einem späteren Leitsatz: „Wir wollen eine Kirche, in der man lachen und weinen kann.“ Auch das kann man schwerlich anders als eine Banalisierung lesen. In den notae ecclesiae des Nicaenums, in CA VII oder in These 3 und 4 der Barmer Theologischen Erklärung wird ein sehr viel komplexeres Verständnis der Kirche sichtbar. Und nebenbei: Jene Komplexität wird in einfachen und wenigen Worten ausgedrückt. Gerade das Beispiel von CA VII zeigt auch, wie Melanchthon die Komplexität und Schwierigkeit einer Institution wie der Kirche in einfachen, aber prägnanten und nicht banalen Worten ausdrücken konnte. Kirche ist immer mehr gewesen als eine emotionale Wohlfühl- oder Trauergemeinschaft. Um Missverständnisse auszuräumen: Lachen und Weinen haben selbstverständlich ihr gutes Recht und ihre Notwendigkeit, auch in der Gemeinde. Aber es verwirrt doch, wenn sie so vereinfacht in den Vordergrund gerückt werden. Einige Leitsätze später folgt diese Aussage: „Wir wollen offen, ehrlich und glaubwürdig miteinander umgehen.“ Abgesehen davon, dass diese kirchliche Praxis erschreckend häufig nicht entspricht[5], steht der Leser hier, nach der Beteuerung der vorgängigen Liebe Gottes am Anfang, vor einem vereinnahmenden moralischen Appell. Der Satz spricht eine unklare Gemeinschaft an („wir“), er ist als reine, unverbindliche Gesinnungsethik formuliert. Gerade sein Appellcharakter macht ihn verdächtig, dass er kaschieren soll, wie klerikale Interessen durchgesetzt werden. Man könnte die Reihe der Beispiele noch fortsetzen. Der Vergleich zwischen Bekenntnisschriften und Leitsätzen ergibt durchgängig eine massive Tendenz zur Simplifizierung, die theologische und weltliche Komplexität nicht mehr wahrnehmen will. Durchgängig ist die Unterstellung zu spüren, in den Bekenntnisschriften hätten die theologischen Väter und Mütter zu kompliziert und unverständlich formuliert. Das Gegenteil ist der Fall: Nicaenum und Apostolicum sollten prägnante Zusammenfassungen von Glaubensinhalten für Taufkandidaten sein. Den kleinen Katechismus schrieb Martin Luther deshalb, weil er Christen zu mündigen, theologisch urteilsfähigen Gemeindegliedern machen wollte. Bei den Leitsätzen ist diese Tendenz zur Anerkennung von Komplexität und zur Ausbildung von mündigem Christentum nicht mehr richtig zu erkennen. Im Gegenteil: Man wollte es sich so einfach wie möglich machen. Es zeigt sich eine Tendenz, die Kirche selbst an die Stelle des Evangeliums zu rücken[6], und man bemerkt dabei gar nicht, wie sich dadurch die theologischen Weichenstellungen verändern. 6. Harmlose Dialoge
Zu Recht haben die Dialoge des Christentums mit anderen Religionen in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erfahren. Aus der Theologie schwappt die These in den kirchlichen Raum, man habe die Theologie umzustellen von Bekenntnis und Glaubensinformation auf Kommunikation[8]. Leider wird bei diesem theologischen Konzept das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn auch Kommunikation wird ja über bestimmte Inhalte geführt, über Bekenntnis, Wahrheiten, Gewissheiten, wie immer man das nennen will. Wer allein auf den Dialog mit anderen abstellt, mit anderen Kirchen, anderen Religionen, anderen weltanschaulichen Entwürfen, der macht sich zwar außerordentlich dialogfähig, der gibt aber mittelbar und ohne dringende Notwendigkeit eigene Überzeugungen preis. Aus den Überzeugungen, die im stärksten Fall als gemeinsame theologische Bekenntnisse artikuliert werden, wird eine verflüssigte Verfügungsmasse, die um des Dialoges willen beschnitten, preisgegeben, verdünnt oder verharmlost werden kann. Amerikanische theologische Fakultäten sind bereits dabei, ihre Lehrpläne von der Vermittlung religiöser Inhalte vollständig auf Dialog umzustellen.[9] Der professionelle Theologe verwandelt sich damit von einem Experten für religiöses Wissen zu einem Experten in Moderation, Diskussion und Mediation. Er verschiebt Gewissheiten und Überzeugungen wie Holzklötzchen, nicht mehr an einem bestimmten konfessionellen Bekenntnis orientiert, sondern orientiert an den Notwendigkeiten des Dialogs. Alle Beteiligten sollen sich wohl fühlen können. Selbstverständlich ist überhaupt nichts gegen interreligiöse und interkonfessionelle Dialoge einzuwenden, aber wenn es zu den impliziten Axiomen einer solchen Orientierung gehört, Dialogoffenheit gegen religiöse Überzeugungen auszuspielen, scheint Ein- und Widerspruch geboten. Ein Beispiel für solch eine merkwürdig übertriebene Dialogorientierung bietet ein Papier der Evangelischen Landeskirche in Baden zum Dialog zwischen evangelischer Kirche und den Muslimen.[10] An diesem Papier fällt zunächst die merkwürdig verschwurbelte Sprache auf, welche offensichtlich den gedämpft bürokratischen Ton von EKD-Verlautbarungen auf unbeholfene Weise zu imitieren sucht. Es sei ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel genannt: „Der christliche Glaube darf und soll die Hochschätzung Jesu im Koran wahrnehmen und darüber freudig staunen; (…).“[11] Zuerst stolpert der Leser über die Häufung von Modalverben wie „dürfen“ und „sollen“. Hier schlägt der alte protestantische Hang zum Moralisieren und Besserwissen durch. Er zeigt sich nicht nur als Unterton, sondern als durchgängiges Argumentationsmuster. Als zweites verwundert die Verknüpfung der moralisierenden Modalverben mit dem Verb „Staunen“. Dem Staunen worüber auch immer wohnt phänomenologisch etwas Intuitives und Spontanes inne, das sich zuerst und vor allem aus dem Objekt, worüber man staunt, speist. Es benötigt keinesfalls eine Erlaubnis und muss schon gar nicht mit einer Verpflichtung verknüpft werden. Und weiter: Der Leser soll nicht nur staunen, sondern „freudig“ staunen. Überflüssige, übertriebene Adjektive ziehen sich durch den ganzen Text. Es ist, als ob die Gemüsesuppe wie früher durch eine übertriebene Dosis Maggi zur Geschmackskatastrophe konzentriert worden sei. Die schrillen stilistischen Defizite bringen die inhaltlichen und theologischen Defizite nur umso stärker zum Ausdruck. Das gesamte Papier ist geprägt von einer doppelten Haltung, die in Hinsicht auf das Christentum wichtige Inhalte stets relativiert, in ihrer Bedeutung beschneidet oder verharmlost. In Hinsicht auf den Islam bemühen sich die Autoren stets um Offenheit und Verständnis. Das zeigt sich exemplarisch an den Überlegungen zur Trinitätslehre[12]. Das Dialogpapier rettet sich hier in die Unterscheidung zwischen theologischer Deutung (durch die christliche Trinitätslehre) und der geheimnisvoll unerkennbaren Einzigkeit Gottes. Damit aber werden die Autoren der Trinitätslehre nicht gerecht, handelte es sich bei ihr doch um den lange etablierten Versuch, auf der Seite des Christentums die Zuwendung Gottes zur Welt in ihrer Dynamik und Komplexität theologisch zu begreifen[13]. Wenn man überhaupt sinnvoll von Christologie reden will, so ist auf christlicher Seite an dieser Dynamik festzuhalten, die dann allerdings mit dem strikten islamischen Monotheismus nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. In dieser Hinsicht verharmlost das Dialogpapier entscheidende Differenzen und rettet sich stattdessen mehrfach in die luftige und nichtssagende Formel von „erstaunliche[n] Konvergenzen“[14]. Der Leichtigkeit, mit der zentrale theologische Gehalte des Christlichen relativiert werden, entspricht umgekehrt die Bereitschaft, gegenüber dem Islam Zugeständnisse zu machen. Das zeigt sich besonders am Kapitel über Religionsfreiheit. Hierzu heißt es im Dialogpapier: „Die Vermittlung zu (sic!) den je eigenen christlichen bzw. islamischen religiösen Konzepten von Freiheit und Toleranz ist eine notwendige theologische und ethische Aufgabe, die für Christen und Muslimen (sic!) aufgrund ihrer Verantwortung für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben unverzichtbar.“[15] Zunächst ist problematisch, dass das Dialogpapier dem Konzept der Menschenrechte und des weltanschaulich neutralen Staates sehr schnell eine christliche Begründung unterschiebt und die entsprechenden historischen Konflikte unterschlägt. Weiter konzediert das Papier dem Islam, dass sich seine theologischen Grundlegungen innerhalb einer bestimmten „Sozialordnung“[16] entfaltet haben, welche nicht die Demokratie war. Es genügt dann aber nicht zu fordern, die Muslime müssten ein eigenes theologisches Konzept entwickeln, das eine positive Einstellung zur Religionsfreiheit beinhaltet. Die Geltung von Religionsfreiheit ist im Übrigen nicht gebunden an ein christliches, islamisches oder sonstiges „Konzept“, was der intrareligiösen Legitimation dient. Für die islamische Haltung zur Religionsfreiheit gilt doch, dass solche Konzepte, die seit langem existieren, entweder daran kranken daran, dass die Scharia den Menschenrechten übergeordnet wird oder, sofern sie das nicht tun, daran kranken, dass sie innerhalb der muslimischen Gemeinschaften keine Bedeutung haben. Es ist auch die Frage, ob es hier nur darum geht, die entsprechenden theologischen Konzepte zu entwickeln. Religionsfreiheit (wie Menschenrechte überhaupt) ist ein Rechtsinstitut, dass bürgerlich und gesellschaftlich unbedingt anerkannt werden muss. Im Grunde braucht es dafür keine eigene theologische Deutung, die rechtliche Geltung genügt. Im Schlusswort heißt es über die Studie, sie gehe aus „von der biblisch gewonnen (sic!) Überzeugung, dass wir motiviert von unserer christlichen Glaubensüberzeugung uns an dem Glaubensweg der Muslime und Musliminnen freuen und ihnen freimütig Gottesnähe zugestehen dürfen.“[17] Einmal abgesehen von dem salbungsvollen Ton dieser Passage, ist doch zu fragen, ob es wirklich stimmt, dass die biblischen Schriften in der Absicht ihrer Verfasser von einem Modell aufgeklärter religiöser Toleranz bestimmt waren. Für diese Exegese und für die Behauptung einer theologischen Nähe zwischen Christentum und Islam ist ein hoher Preis zu zahlen: Widersprüche werden negiert, theologische Behauptungen, die sich gegenseitig ausschließen, werden verharmlost und vor allem wird die eigene theologische Überzeugung aus einer im Bekenntnis festgelegten Gewissheit und Überzeugung zu einer bloßen Verhandlungsmasse degradiert. Daran können auch die wenigen Einsprengsel evangelikaler Positionen nichts ändern, die in diesem Papier wie Fremdkörper wirken, die darin eigentlich nichts zu suchen haben. Auch das ist eine Verhunzung des Theologischen, dass kirchenparteiliche Positionen mit ihren Signalwörter und Parteiformeln einfach nebeneinander gestellt werden, ohne sich damit theologisch argumentativ auseinanderzusetzen. Man fragt sich konsterniert, ob diese Art des Dialogs theologisch überhaupt notwendig ist. Dieses ist eindeutig zu verneinen. Es ist erstaunlich, dass dieses unzureichende, verquere Papier wider besseres theologisches Wissen publiziert wurde. Dem in diesem Papier präsentierten Modell des vorauslaufenden, devoten Dialoggehorsams wäre ein Modell gegenüberzustellen, das nüchtern und pragmatisch Differenzen markiert und vor allem anerkennt. Mit solcher Nüchternheit wäre auch den Muslimen mehr geholfen als mit diesem Papier, das Dialog und Anbiederung verwechselt. Und im Übrigen: Modelle der öffentlichen Theologie oder des Miteinanders in Kulturen der Anerkennung[18] erscheinen als sehr viel besser geeignet, mit solchen interreligiösen Differenzen umzugehen. 7. Öffentliche Theologie statt Moralismus
Aber dabei kann man es nicht belassen, soll der gegenwärtig aktuelle und immer noch viel zitierte Begriff der öffentlichen Theologie mehr sein als ein Bischofswahlprogramm oder ein Deckmäntelchen für klerikale Nebenzimmer-Kungelei. Solche Praxis der öffentlichen Theologie braucht einen wissenschaftlichen Widerpart an der Universität, und erste Ansätze dazu sind gegenwärtig auch zu beobachten[19], mit dem Ergebnis, dass die alten Modelle kirchlicher Einflussnahme zu überführen sind in komplexere Sichtweisen, die die komplizierter gewordene Welt der Politik in allen Differenzierungen ernst nehmen. Dies ist eine Tendenz zur Entbanalisierung politischer Ethik der Kirche, die nur zu begrüßen ist. Auf der Ebene der kirchlichen Verlautbarungen und Predigten ist jedoch weiter anderes zu erleben. Statt sich darauf zu konzentrieren, was Kirche und Theologie an Besonderem und Spezifischem über politische Themen zu sagen hätte und was keine andere Assoziation der Bürgergesellschaft in den Dialog einzubringen hätte, werden einfach aus der Politik bekannte Themen wiederholt und ohne theologische oder ethische Reflexion affirmiert. Öffentliche Theologie wird wieder einmal zu einer politisierenden Theologie, darin zu einer Wiederholung, nicht zu einer Bereicherung der Politik, die außer der Moralisierung und Emotionalisierung von Themen wenig beizutragen hat. Letzteres ist besonders bei Fragen der Migrationspolitik und des demokratischen Umgangs mit dem Rechtspopulismus. Zu groß ist die Versuchung, durch die Anwendung schlichter Freund-Feind-Schemata billige Positionierungsgewinne zu erzielen. 8. Fromme Nivellierungen
Aber das bedeutet nicht, dass aus durchsichtigen Gründen sämtliche Unterschiede in Kompetenz und Ausbildung verwischt werden müssen. Die plötzlich entdeckte Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit rührt ja daher, dass teure Pfarrstellen aus Gründen abnehmender Kirchenmitgliedschaft bald nicht mehr finanziert werden könnten. Ehrenamtlich, Prädikanten und Diakone sollen ersetzen, wofür sich Kirchenleitungen teure Pfarrstellen und gut ausgebildete Spezialisten der Theologie, der Liturgie und der Ethik nicht mehr leisten wollen. Solche bewusst herbeigeführten ekklesiologischen Nivellierungen führen zu großen Verlusten an Wertschätzung. Einerseits wird das Pfarramt mit immer mehr Bürokratie und Verwaltungsaufgaben überlastet, so dass Pfarrern schlichtweg die Zeit genommen wird, theologisch tätig zu werden. Auf der anderen Seite wird insinuiert, dass die theologische Arbeit von Prädikanten, Diakonen, Ehrenamtlichen mit Sicherheit genauso gut erledigt werden könnte. Diese Unterstellung aber verwechselt das Billige und das Qualitätvolle. Ehrenamtliche erledigen Arbeit kostengünstiger, aber keineswegs zwingend qualitätvoller. Theologie erscheint in diesem Kontext nicht mehr als ein Bündel anspruchsvoller Kompetenzen, um sich selbständig und ohne klerikal-obrigkeitliche Bevormundung mit allen möglichen Themen der Bibel, des Glaubens, der Ethik auseinanderzusetzen und dazu ein begründetes Urteil abzugeben. Stattdessen erscheint sie als ein bestimmter Jargon, ein Sprachspiel, in dem mit frommen Worthülsen jongliert wird, um die eigenen Gemeinschaften zu stabilisieren und Unterscheidungen zwischen den guten Frommen drinnen und den bösen Anderen in der Welt da draußen jenseits des Gemeindezentrums zu bekräftigen. Und bei dieser verhängnisvollen Entwicklung handelt es sich um die unguten personalpolitischen Facetten eines langfristig angelegten Prozesses der Banalisierung, der Ent-Theologisierung und der Ent-Intellektualisierung. Zugrunde liegt dem eine Fehlinterpretation der theologischen Lehre vom Priestertum aller Gläubigen, die sich mit einer missverstandenen linksliberalen Gleichheitsideologie verbindet. Darauf will ich gleich noch eingehen. Die Unterstellung, alle Gemeindeglieder seien theologisch „irgendwie“ gleich kompetent, zeitigt Folgen für das Niveau der Argumentation. Es kann gar nicht anders als sinken. Und – zweite Folge – es führt zu endlosen Debatten auf Synoden, in Kommissionen und Gesprächsgruppen, weil gute und schlechte Theologie gar nicht mehr voneinander unterschieden werden können. 9. Kleinmut klerikaler Bürokratie
Im einfacheren Fall werden Zugehörigkeiten über „Moderation“ gesteuert. Der Moderationstätigkeit entsprechen sehr lange Sitzungen auf allen Ebenen, die am Ende zwei strukturelle Probleme offenbaren: 1. Harmlose Unterschiede werden zu stark betont, und auf diese Weise werden Schwierigkeiten der Einigung erzeugt, die im Grunde so gar nicht bestehen. Im klerikalen Jargon heißt das dann: „Alle müssen mitgenommen werden.“ 2. Es besteht in der Regel eine Scheu, inhaltliche Verantwortung zu übernehmen und in einer bestimmten Richtung voranzuschreiten. Die verbreitete klerikale Diskussionskultur beinhaltet die Gefahr, jede Entscheidung und jedes Projekt bis zur Unkenntlichkeit zu verwässern. Im Grunde kann jedes theologische und kirchliche Projekt durch „wertschätzende Kritik“ klein und harmlos geredet werden. Es ist anzunehmen, dass sich solche vergeblichen Prozesse der Steuerung kirchlicher Arbeit nicht nur auf der Ebene der Kirchenleitung, sondern auch auf der Ebene der Bezirke finden, zumal die seit Jahren beförderte Debatten-, Sitzungs- und Ausschuss-Kultur ehren- und hauptamtliche Multifunktionäre hervorbringt. Mauschler, Netzwerker und klerikale Lobbyisten können vor dem Hintergrund dieser Entscheidungskultur erfolgreicher agieren als argumentierende Theologen. Die beschriebene Grundstruktur wirkt sich verhängnisvoll aus auf die Reformfähigkeit der Kirche, die zwar immer wieder reformatorisch beschworen wird (ecclesia semper reformanda), aber in der Regel nur die bestehenden Verhältnisse perpetuiert.[21] Erschwerend kommt hinzu, dass die beschriebenen theologischen Defizite sich in unguter Weise auf kirchliche Personalpolitik auswirken: „Eine Kirche, die Gemeindepfarrer aus ihren Stellen herausmobbt, weil private oder klerikale ‚Freundschaften‘ wichtiger sind als Theologie, in der Bischöfe und Prälaten Gesprächsbitten und Briefe nicht beantworten und in der Älteste mit Billigung von Bischöfen die Predigt- und Gottesdienstfreiheit von Pfarrern zu beschneiden versuchen, hat mit der ‚Gemeinde von Brüdern‘ (These 3 und 4 [der Barmer Theologischen Erklärung wv]), in der Ämter keine klerikale Herrschaft im Sinne der Verfolgung privater Freundschaftsdienste begründen, schlichtweg nichts zu tun.“[22] Kurzum: In der klerikalen Bürokratie findet im Moment das Gegenteil von dem statt, was der Apostel Paulus einmal verlangt hat. Es fehlt an Mut, an Freiheit, an Mündigkeit. Es fehlt an parrhesia (Phil 1,20 u.ö.). Wer sich die paulinischen Briefe genauer anschaut, der findet dort ekklesiologisch eine Balance von Einheit und Mündigkeit vertreten, wie sie in der kameralistischen Bevormundungstheologie der Oberkirchenräte gar nicht vorgesehen ist. Im Neuen Testament ist von den bösen Hintergedanken eines kirchlichen team building überhaupt nichts zu spüren. Die Gemeinden, die sich Paulus vorstellt, sind nicht durch Klientelwirtschaft, Funktionärsinteressen oder den berüchtigten kirchlichen Strukturkonservatismus gefesselt. Die hier entwickelte Diagnose der Banalisierung kirchlicher Arbeit hat eine Reihe von Gründen, von denen vier hier in den nächsten Abschnitten exemplarisch entfaltet werden sollen: 1. Kirchlich besteht eine verbreitete Unsicherheit, sich auf die pluralistischen Verhältnisse der Gesellschaft einzustellen. 2. An die Stelle einer Theologie, welche die dialektischen Bewegungen des Glaubens analysiert, tritt eine klerikale Gleichheitsideologie, die Unterschiede verwischt und Funktionen austauschbar macht. 3. Dies kann nur gelingen, indem Theologie als kirchliche Steuerungswissenschaft abgewertet wird. 4. An ihre Stelle treten andere Wissenschaften, insbesondere die Religionssoziologie, von der sich Kirchenleitungen neue Rezepte erhoffen, dem Mitgliederschwund zu begegnen. Aber Religionssoziologie vermag nur empirische Situationsbeschreibungen zu liefern, die Umsetzung dieser Ergebnisse in normativer und perspektivischer Hinsicht schlägt regelmäßig fehl. Und sie tut das deshalb, weil Kirchenleitungen ihre Aufgaben nicht wahrnehmen. 10. Scheu vor der Unübersichtlichkeit
Das evangelikale Modell des Einigelns führt letzten Endes zu einer Abschottung. Die historischen Modelle der Amish, der Hutterer und Mennoniten, stoßen zwar verbreitet auf Bewunderung, aber es handelt sich um eine Bewunderung aus der Distanz. Eine Landeskirche, die bis vor wenigen Jahren noch Volkskirche sein wollte, kann sich nicht vollständig aus der Gesellschaft verabschieden. Allerdings kann auch der kontinuierliche Aufenthalt in kirchlichen Gremien zu Formen von kultureller Isolation führen, die den Kontakt zu Menschen außerhalb der Ausschüsse erschwert. Wer dauerhaft seine Zeit in Ältestenkreisen, Bezirkssynoden, kirchlichen Ausschüssen und Steuerungsgruppen verbringt, der neigt zu einem bestimmten (klerikalen) Jargon und zur Übernahme bestimmter Wahrnehmungsmuster, deren idiosynkratische Nutzung zwar in der Binnenlogik kirchlicher Gremien zu Aufmerksamkeit und Akzeptanz führt, aber nach außen nicht mehr verständlich zu machen ist. Was das Beispiel der Predigten angeht, so ist die Kritik an der Sprache Kanaans mittlerweile auch Pfarrern und Prädikanten angekommen, aber an deren Stelle ist ein neuer Jargon getreten, klerikal, moralisierend, psychologisierend, mit Anleihen beim Jargon des Authentischen und bei der Religionssoziologie[23]. Was für Predigten gilt, gilt in analoger Weise für kirchliche Stellungnahmen, den Jargon der theologischen Memoranden, Arbeitsberichte und Thesenpapiere und so genannter Konzeptionsprozesse. So entsteht sprachlich und symbolisch ein isolierter Mikrokosmos klerikalen Kapitals, der außer der Selbstbestätigung und Abgrenzung vom Pluralismus keine soziale Funktion mehr erfüllt. Dabei entwickelt dieser Kosmos eine zunehmende Eigendynamik, denn jegliche theologische und ethische Stellungnahme, jegliches Projekt, das auf den Weg gebracht werden soll, wird stets durch eine größere Anzahl von Gremien geschleust und dem ätzenden Scheidebad von Wertschätzung und Kritik unterworfen. Auf diese Weise wird jede prägnante theologische Position verdünnt, verwässert, verharmlost und bis zur Unkenntlichkeit klerikalisiert. 11. Gleichheitsträume
Dieser Funktionsmisere liegt eine theologische Theorie der Gleichheit zugrunde, die neben dem viel beschworenen Priestertum aller Gläubigen stets Gal 3,26-28 anführt, wo Paulus argumentiert, dass die Taufe funktionale und identitäre Merkmale des Individuums aufhebt. Dabei wird aber stets übersehen, dass Paulus dieses nie als Zustandsbeschreibung gemeint hat, sondern stets an eine eschatologische, noch zu realisierende Wirklichkeit dachte, die zwar in der Gegenwart beginnt, aber eben erst mit dem Kommen des Reiches Gottes ihre vollständige Verwirklichung findet. Kirchliche Funktionäre nutzen diese Gleichheitsideologie, um unter der Hand gegenwärtige Machtverhältnisse zu fixieren, von der sie selbstverständlich profitieren. Selbst das Macht stabilisierende Kirchenrecht wird so umgedeutet, dass es angeblich die Herrschaft Christi in der Kirche zum Ausdruck bringen soll, während es in Wahrheit nur die klerikalen Verhältnisse zementiert. Es muss nicht eigens erwähnt werden, dass solch eine Differenzen verwischende Gleichheitsideologie sich häufig mit einer moralisierenden Rhetorik verbindet, die religiöse Geltung plötzlich nicht mehr an theologischen und spirituellen Kompetenzen, sondern an einem wie auch immer gearteten Opferstatus festmacht. 12. Theologie in Spurenelementen
Um solche Verständigungsprozesse zwischen Theologie und Philosophie, zwischen Alltag und Glauben, auf den Weg zu bringen, braucht es theologische Expertise. Ein theologisch grundierter klerikaler Jargon, der nachträgliche Begründungen für kirchenpolitische Interessen liefert, bringt nur das zustande, was der Münchener Theologie Friedrich Wilhelm Graf als die Spoilerfunktion der Theologie gebrandmarkt hat[25]. Wenn Theologie im Prozess der Kirchenleitung nicht mehr in den Motor, sondern zum Beiwerk und schmückenden Ornat gehört, dann läuft etwas grundsätzlich schief. Es erscheint doch sehr merkwürdig, dass zum Beispiel die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden Ausschüsse für alle möglichen Fragen, von Bildung bis Finanzen besitzt, aber ein theologischer Ausschuss fehlt, der sich mit den entsprechenden Grundsatzfragen beschäftigen würde. Dem entspricht leider, dass dann, im theologischen Ernstfall, ein Papier über die Confessio Augustana veröffentlicht wird[26], das ein katastrophal unhistorisches Verständnis des Artikels XVI mit Blick auf den Gebrauch von Massenvernichtungswaffen artikuliert. 13. Missbrauch der Religionssoziologie
Beliebt ist die Forderung geworden, die eigene kirchliche Arbeit noch ‚milieusensibler‘ zu machen. Das Stichwort reagiert auf aktuell beliebte Untersuchungen, die Gemeinden und Kirchenmitglieder bestimmten sozialen Milieus[27] zuordnen und bestimmte kirchliche Milieuprofile herausarbeiten. Die Umfragen werden der Demoskopie und den Meinungsforschungsinstituten überlassen, während man dann aus den Ergebnissen bestimmte „Rezepte“ destilliert, die in einfachen Handlungsanweisungen und Gebrauchsanleitungen Haupt- und Ehrenamtlichen vermittelt werden sollen. Solchen simplifizierten „Rezepten“ liegt regelmäßig der Trugschluss zugrunde, kirchliche Mitarbeiter stünden jenseits der Milieus und sie könnten sich jeweils neu auf andere Milieus einstellen, indem man die entsprechenden milieuspezifischen Symbole, Sprachen und Rituale gebraucht. Auch das muss schiefgehen. Der genaue Blick in die Milieutheorien Pierre Bourdieus und seiner deutschen Schüler hätte gezeigt, dass soziale Wirklichkeit komplexer ist, als dass sie einfach mit Sozialtechnologien gestaltet und verändert werden könnte. Die Beharrungs- und Gravitationskraft sozialer Verhältnisse und ihr Einfluss auf den Habitus von Individuen wird so auf gefährliche Weise unterschätzt. Damit ist ein schwieriger und heikler Punkt erreicht: Soziale Wirklichkeit, auch von Kirchengemeinden, ist gar nicht so leicht zu verändern, wie sich das Strategen der klerikalen Bürokratie und die Verführer der Marketingmethoden vorstellen. Werbung, welche ausschließlich Emotionen anspricht, milieusensible, gruppenspezifische Gemeindearbeit und Banalisierungsstrategien greifen zu kurz und laufen ins Leere. Zum einen Teil erleiden die Kirchen damit denselben Schiffbruch wie andere größere, etablierte soziale Organisationen auch. Zum anderen Teil sind die kirchlichen Probleme hausgemacht, besser: selbstgestrickt. Es ist deshalb zu fragen, welche Lösungsoptionen andere Forscher vorschlagen. Aus der Vielzahl der Modelle habe ich solche herausgegriffen, die im Moment besonders aktuell erscheinen und möglicherweise die festgefahrene Situation weiterführen könnten. Ich diskutiere die Modelle der Ambiguitätstoleranz, des Zwischenraums, des Pluralismus der Gruppen und der kontingenten Gewissheiten. 14. Größere Ambiguitätstoleranz
Der Kritik an theologischen „Wahrheitsobsessionen“ entspricht aber umgekehrt auch eine Kritik an der Harmlosigkeit fundamentalistischen Einigelns oder anspruchslosen ekklesialen Marketings, das die Ambivalenzen des Pluralismus einfach freundlich weglächelt. Es soll nicht verschwiegen werden, dass mir Bauers Werben für Ambiguitätstoleranz in der Wolle katholisch gefärbt zu sein scheint. Man platziert sie nur dann richtig, wenn man sie als die maßvolle Mitte zwischen dem Bestehen auf einer bestimmten Wahrheit des Glaubens und einer geduldigen Toleranz versteht, die sich nicht vorschnell in Beliebigkeit auflösen darf. Dann aber, als ein solcher Balance- und Mittenbegriff bietet Ambiguitätstoleranz auch für die evangelischen Kirchen mit ihrer Banalisierungstendenz eine spannende Perspektive. 15. Zwischenräume
In dieser Charakterisierung des „Zwischenräumlichen“ kommt die Kirche nur mittelbar in den Blick. Es ist die Stärke dieser Passage, dass so das Kirchliche vom Alltäglichen und Lebensweltlichen her verstanden wird. Das für die alltägliche Gegenwart Relevante wird zum Maßstab des Theologischen. Insofern zielt Theologie auf Weisheit und Lebenspraxis, die jedoch nach meiner Einschätzung nicht mit den Prozessen der Banalisierung verwechselt werden darf, die in den vorigen Abschnitten beschrieben wurde. Man könnte sogar sagen, dass das Absinken ins Banale und Billige die beständige Gefahr solch einer alltagsethischen Wendung der Theologie ist. Deutlich ist, dass Wagner-Rau in der Metapher des Zwischenraums etwas Ähnliches anspricht wie das, was Bauer mit Ambivalenz und Ambiguität meinte. Und – ein zweiter wichtiger Punkt – sie nimmt die verbreiteten Krisendiagnosen über die evangelischen Kirchen ernst. Nach Wagner-Rau ist die Kirche in doppelter Weise auf einen Zwischenraum bezogen. Zum einen ist sie selbst in einen Verwandlungs- und Übergangsprozess eingebunden, der als ‚Zwischenraum‘ zu einer neuen Gestalt von Kirche verstanden werden kann. Zum anderen thematisieren die Kirchen für die Glaubenden die ‚Zwischenräumlichkeit‘ der Welt. Übergang, Veränderung, Verwandlung erscheint bei Wagner-Rau als der Normalfall. Das scheint ja durchaus richtig, aber in all den Veränderungsprozessen kommen weder Beobachter von außen noch Gestalter von innen ohne normative Elemente aus. Wagner-Rau vermeidet es bewusst, solche normativen Elemente einzuführen. Das erscheint als ein Manko. Auch wenn Veränderung und Übergang institutionell und individuell Dauerzustände sein sollten, braucht es normative Orientierungen. Auch wer erkannt hat, dass er in einem unübersichtlichen Labyrinth der Wirklichkeit lebt, muss kirchlich und alltagsethisch in eine bestimmte Richtung gehen. Mir persönlich scheint die Alternative zwischen Banalisierung und Intellektualisierung im Moment für Kirche und Theologie von besonderer Bedeutung. 16. Pluralismus der Gruppen
Dieses Stichwort ist deshalb interessant, weil es sowohl den Vertretern einer subjektivitätsorientierten Theologie, die sich für gemeinsam, sozial geteilte religiöse Gewissheiten nicht mehr groß interessieren, als auch den Kirchentheoretikern, die an einer Theologie jenseits von Subjektivismus und Individualismus arbeiten, Anknüpfungspunkte bietet. Hermelink redet von einer Kirche unterschiedlicher, divergenter Gruppen, die sich jeweils um ein bestimmtes Thema (Migration, Gospel, Bibellektüre etc.) kristallisieren. Die Gruppen-Theorie der Kirche ist für unterschiedliche Perspektiven offen, solche des Milieus, solche des religiösen Subjektivismus, solche der Kirchentheorie und solche der empirischen Religionssoziologie. 17. Kontingente Gewissheiten
Damit liefert das Stichwort von den kontingenten Gewissheiten eine Möglichkeit, mit interreligiösen Differenzen, aber auch mit innerkirchlichen Unterschieden umzugehen. Gewissheiten sind wandelbar und ausdeutbar, und gerade darin einer Diskussion unterworfen, die, jedenfalls aus einer Perspektive der evangelischen Theologie, dringend der Expertise, und zwar der historischen, der systematischen und der praktischen, bedarf. Nur so kann es theologisch gelingen, die billigen Auswege der Banalisierung und Verharmlosung zu vermeiden. 18. Notwendige KonzentrationsprozesseDie bisherigen Überlegungen haben gezeigt, dass gegenwärtiges kirchliches Leben sowohl in seinen Binnenbeziehungen wie auch in seinen Beziehungen zur Gesellschaft und zur Zivilgesellschaft wie auch zu anderen Religionen von der Frage des Umgangs mit dem Pluralismus geprägt ist. Evangelischer Glaube muss damit umgehen, dass seine eigenen Gewissheiten von anderen Glaubenden, von anderen religiösen Personen, von Menschen ohne Religion nicht unbedingt geteilt werden. Um diese Fragen und Probleme zu behandeln, können unterschiedliche Wege eingeschlagen werden. In diesem Essay wurde herausgearbeitet, dass sich dabei ein Weg der Banalisierung und ein Weg der Intellektualisierung und Theologisierung unterscheiden lassen. Wer mit Harmlosigkeit und Anbiederung und Nivellierung von Differenzen punkten will, der verschenkt die Botschaft des Evangeliums. Der Weg des Fundamentalismus, der Abgrenzung von bestimmten Bereichen der Erfahrung, steht theologisch nicht offen. Offen dagegen steht ein Weg der Besinnung auf theologische Argumentation und Interpretation, eine Konzentration auf Theologie, Gottesdienst und Predigt. Daran wäre weiter zu arbeiten.
Anmerkungen[1] Erste Überlegungen dazu in dieser Zeitschrift: Wolfgang Vögele, Das Abendmahl der Aktenordner. Bemerkungen zum Verhältnis von Theologie und Kirchenleitung, tà katoptrizómena, H.90, 2014, http://www.theomag.de/90/wv12.htm. Daneben ders. (Herausgeber), Die Krise wahrnehmen - Veränderungen anstiften. Wege zu einer zukunftsfähigeren Gestalt von Kirche, Loccumer Protokolle 59/00, Rehburg-Loccum 2001; ders., Welche Kirche ist gemeint? Vorstellungen über die Kirche in gesellschaftlichen Milieus und die Erwartungen des Rechts und der Theologie, in: H.G. Kippenberg, G.F.Schuppert (Hg.), Die verrechtlichte Religion. Der Öffentlichkeitsstatus von Religionsgemeinschaften, Tübingen 2005, 141-156; ders., Das Handwerk der Theologie – ein Versuch, in: Konvent des Klosters Loccum (Hg.), Kirche in reformatorischer Verantwortung: Wahrnehmen – Leiten – Gestalten, FS Horst Hirschler, Göttingen 2008, 341-354. [2] Dazu ausführlicher Wolfgang Vögele, In aller Stille ausklingen lassen… Zur Interpretation von Passionsmusik zwischen Theologie, musikalischem Kommerz und bürgerlicher Religion, tà katoptrizómena, H.89, 2014, https://www.theomag.de/89/wv10.htm; ders., Con moto agitato. Ein kirchenmusikalisches Thema in zwölf Variationen und einer Coda, tà katoptrizómena, H.103, 2016, https://www.theomag.de/103/wv26.htm. [3] Dazu Wolfgang Vögele, Leichte Sprache - Schwerarbeit. Warum 'leichte Sprache' kein religiöses Therapeutikum in post-christlicher Zeit sein kann, DtPfBl 114, 2014, H.2, 81-84. [5] S.u. Abschnitt 9. [6] Es wäre interessant, unter diesem Gesichtspunkt die Broschüre „Berührt. Bewegt. Begleitet“ der Badischen Landeskirche anzuschauen. Vgl. Evangelische Landeskirche in Baden (Hg.), Berührt. Bewegt. Begleitet, Karlsruhe 2016, https://www.kirche-beruehrt.de/html/media/dl.html?i=86530. [7] Dazu ausführlicher Wolfgang Vögele, Brot und Wein. Gegenwärtige Abendmahlspraxis und ihre theologische Deutung, tà katoptrizómena, Heft 109, 2017, https://theomag.de/109/wv036.htm. [8] Z.B. Christian Grethlein, Kommunikation des Evangeliums in der digitalisierten Gesellschaft, Dresden 11.11.2014, https://www.ekd.de/synode2014/schwerpunktthema/s14_iv_4_impulsreferat_grethlein.html Diese Grundentscheidung Grethleins von der theologischen Umstellung auf Kommunikation lässt sich auch in anderen seiner Publikationen finden. [9] Mark Oppenheimer, Theology Schools, Facing Lean Times, Look to one Another and the Web, New York Times 18.3.2016, https://www.nytimes.com/2016/03/19/us/theology-schools-facing-lean-times-look-to-one-another-and-the-web.html. [10] Kollegium des Evangelischen Oberkirchenrats Karlsruhe (Hg.), Christen und Muslime. Gesprächspapier zu einer theologischen Wegbestimmung der Evangelischen Landeskirche in Baden, Karlsruhe 2018, https://www.ekiba.de/html/media/dl.html?i=137888. [11] A.a.O., 27. [12] A.a.O., 22ff. [13] Es ist erstaunlich, dass die Trinitätslehre im Jubiläumsjahr der Reformation 2017 offenbar nur noch von einem Philosophen wahrgenommen wird, der der Nähe zur evangelischen Kirche gänzlich unverdächtig ist, nämlich von Peter Sloterdijk. Vgl. dazu Peter Sloterdijk, Nach Gott, Berlin 2017. [14] Kollegium, Muslime, a.a.O., Anm.10, 26. [15] A.a.O., 38. [16] A.a.O., 40. [17] A.a.O., 61. [18] Vgl. dazu Gerhard Kruip, Wolfgang Vögele (Hg.), Schatten der Differenz. Das Paradigma der Anerkennung und die Realität gesellschaftlicher Konflikte, Philosophie aktuell. Veröffentlichungen aus der Arbeit des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover, Bd.4, Hamburg 2006. Zum Zusammenhang zwischen öffentlicher Theologie und Dialog der Religionen Wolfgang Vögele, Kirchen als freiwillige Assoziationen der Zivilgesellschaft. Theologische Überlegungen im Anschluss an Ronald Thiemanns Rezeption des Kommunitarismus, PTh 87, 1998, 175-183. [19] Dazu Torsten Meireis, Rolf Schieder (Hg.), Religion and Democracy. Studies in Public Theology, Ethik und Gesellschaft 3, Baden-Baden 2017. Der Beitrag von Meireis in diesem Band beschäftigt sich mit den Krisen der europäischen Demokratie, Phänomenen des Post-Demokratischen. In Umkehrung des Projektes öffentlicher Theologie wäre es von großem Interesse, nach Parallelen zwischen der Krise des Demokratischen und der hier beschriebenen Strukturkrise der Kirchen zu fragen. [20] Nach meinen Erfahrungen in kirchlichen Strukturen ist der Gebrauch des Begriffes „Wertschätzung“ ein sicheres Zeichen dafür, dass das klerikale Gegenüber nicht die Wahrheit sagt. [21] Dazu als Beispiele zwei Predigten: Wolfgang Vögele, Abschiedspredigt über Joh 12,44-50. Christuskirche Karlsruhe 30.12.2012, https://wolfgangvoegele.files.wordpress.com/2012/12/joh-1244-50.pdf; ders., Geistliche Ruckrede. Predigt über Eph 4,11-15, Pfingstmontag 21.5.2018, Göttinger Predigten im Internet 2018, http://www.theologie.uzh.ch/predigten/predigt.php?id=7794&kennung=20180521de. [22] Wolfgang Vögele, Barmen in der armen Hülle oder: Wie kann die Barmer Theologische Erklärung in der Grundordnung der Badischen Landeskirche besser verankert werden?, Karlsruhe 2012, https://wolfgangvoegele.files.wordpress.com/2016/02/gutachten-vorspruch-grundordnung-barmer-erklc3a4rung.pdf, 19. [23] S.o. Abschnitt 4. [24] Ein hervorragendes Beispiel dafür sind immer noch die Confessiones Augustins, der auf ganz eigene Weise Theologie, Glaubensgewissheit, Philosophie, Intellektualität und Autobiographie verbindet. Vgl. Robin Lane Fox, Augustinus. Bekenntnisse und Bekehrungen im Leben eines antiken Menschen, Stuttgart 2017 (engl. 2015). [25] Friedrich-Wilhelm Graf, Theologische Aufklärung. Abschiedsvorlesung am 28.1.2014, München 2014, http://www.st.evtheol.uni-muenchen.de/aktuelles/abvl/abschiedsvorlesung_fwg.pdf, 15. [26] Beschluss der Landessynode zu Art. XVI des Augsburger Bekenntnisses, in: Wolfgang Vögele (Hg.), Die Bekenntnisschriften der Evangelischen Landeskirche in Baden, Bd. I Textsammlung, Karlsruhe Bekenntnisschriften I, Karlsruhe 2014 (10. neu bearb. Auflage), 199-200. Kritisch dazu ders., Dogmatische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, Arbeitsbericht zur Neuherausgabe der Bekenntnisschriften der Evangelischen Landeskirche in Baden, tà katoptrizómena, H.92, 2015, http://theomag.de/94/wv17.htm. [27] Zum Milieubegriff aus theologischer Sicht Wolfgang Vögele, Kirche im Reformprozess: Theologische Prämissen und die Pluralität sozialer Milieus, in: H.Bremer, A.Lange-Vester (Hg.), Soziale Milieus und Wandel der Sozialstruktur. Die gesellschaftlichen Herausforderungen und die Strategien der sozialen Gruppen, FS Michael Vester, Wiesbaden 2006, 401-415. Daneben auch ders., Helmut Bremer, Michael Vester (Hg.), Soziale Milieus und Kirche, Religion in der Gesellschaft 11, Würzburg 2002. [28] Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt, Ditzingen 2018 (4.Aufl.). [29] Dazu s.o. Abschnitt 6. [30] Bauer, a.a.O., Anm.28, 29. [31] Ulrike Wagner-Rau, Religiosität im Zwischenraum, PTh 107, 2018, 215-229. [32] A.a.O., 216. [33] Jan Hermelink, Die evangelische Vergemeinschaftung religiöser Pluralität, PTh 107, 2018, 275-290. [34] Hans Joas, Glaube als Option Freiburg 2012, 126. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/115/wv046.htm |
 Selbst die Kirchenkritik folgt ihren Ritualen. Insider kennen die Namen der Journalisten, die in den überregionalen deutschen Tageszeitungen regelmäßig über die evangelische und die katholische Kirche schreiben. Kritische Artikel über die Kirche tauchen mit solider Regelmäßigkeit auf, und diese folgt den Feiertagen des Kirchenjahres. Genauso regelmäßig werden solche Artikel in den sozialen Netzwerken herumgereicht, stets schnell mit einer großen Menge von Kommentaren angereichert. Leser und User wissen genau, wer am besten formuliert, wer eher der konservativen oder der liberalen Kirchenkritik zuzurechnen ist, wo die Gewährsleute und Informanten in München, Hannover und Berlin zu suchen sind, welcher Journalist aus der Landeskirche ausgetreten und in eine kleine, vermeintlich konfliktfreie Freikirche gewechselt ist, welche Religionssoziologen und Meinungsforschungsinstitute im Hintergrund ihre Untersuchungen zur Verfügung gestellt haben. Aber genauso regelmäßig wie die evangelischen Kirchen als reformunfähig, mitgliederfreundlich und eingemauert in ihre alltägliche frömmelnde Geschäftigkeit dargestellt werden, genauso regelmäßig verläuft jede Kritik im Sande. Es ändert sich nichts: Die Mühlen von Frömmigkeit, Strukturdebatten und Leitbildprozessen mahlen weiter, als ob nichts geschehen wäre und als ob nichts geschehen müsste.
Selbst die Kirchenkritik folgt ihren Ritualen. Insider kennen die Namen der Journalisten, die in den überregionalen deutschen Tageszeitungen regelmäßig über die evangelische und die katholische Kirche schreiben. Kritische Artikel über die Kirche tauchen mit solider Regelmäßigkeit auf, und diese folgt den Feiertagen des Kirchenjahres. Genauso regelmäßig werden solche Artikel in den sozialen Netzwerken herumgereicht, stets schnell mit einer großen Menge von Kommentaren angereichert. Leser und User wissen genau, wer am besten formuliert, wer eher der konservativen oder der liberalen Kirchenkritik zuzurechnen ist, wo die Gewährsleute und Informanten in München, Hannover und Berlin zu suchen sind, welcher Journalist aus der Landeskirche ausgetreten und in eine kleine, vermeintlich konfliktfreie Freikirche gewechselt ist, welche Religionssoziologen und Meinungsforschungsinstitute im Hintergrund ihre Untersuchungen zur Verfügung gestellt haben. Aber genauso regelmäßig wie die evangelischen Kirchen als reformunfähig, mitgliederfreundlich und eingemauert in ihre alltägliche frömmelnde Geschäftigkeit dargestellt werden, genauso regelmäßig verläuft jede Kritik im Sande. Es ändert sich nichts: Die Mühlen von Frömmigkeit, Strukturdebatten und Leitbildprozessen mahlen weiter, als ob nichts geschehen wäre und als ob nichts geschehen müsste. Es gibt die wohlfeilen Beispiele, die jeder kennt: die Luther-Bonbons, die an Halloween verteilt werden, damit die Schulkinder den Reformationstag feiern; die Luthersocken, auf deren Unterseite geschrieben steht: Hier stehe ich und kann nicht anders; Luther-Kondome (bedruckt von der evangelischen Jugend, da griff allerdings der Oberkirchenrat ein); das berühmte Luthermännchen von Playmobil, das alle kirchlichen Marketingstrategen als großen Erfolg verkaufen. Irgendein Nuntius in einem mittelamerikanischen Land soll beim Hersteller eine größere Bestellung getätigt haben, um die regionale Bischofskonferenz zu versorgen. Das ist aber nicht alles. Zum Katalog der Werbemittel werden Kirchenfahnen, Aufsteller, Postkarten, Flyer, Tausende von Flyern, Kugelschreiber, Schreibblöcke, Apps und vieles mehr hinzugefügt, das meiste davon wohlfeil in E-Shops zum Verkauf angeboten. Wenn der Bäcker im Ältestenkreis sitzt, kann man sicher sein, dass zum Reformationstag irgendein angebliches Luthergebäck und zu Pfingsten luftige Blätterteigstückchen (pneuma heißt Hauch) verkauft werden. Kirchen und Gemeinden begeben sich auf ein Gebiet, wo der Kommerz herrscht, nämlich die Werbung. Auf diesem Feld herrscht Konkurrenz um Aufmerksamkeit, und dafür benötigt es Fachleute, denen es ohne weiteres gelingt, den Fachleuten für Glauben und Argumente, den Theologen, die Deutungs- und Gestaltungshoheit zu nehmen. Aufmerksamkeit ist die neue Wahrheit.
Es gibt die wohlfeilen Beispiele, die jeder kennt: die Luther-Bonbons, die an Halloween verteilt werden, damit die Schulkinder den Reformationstag feiern; die Luthersocken, auf deren Unterseite geschrieben steht: Hier stehe ich und kann nicht anders; Luther-Kondome (bedruckt von der evangelischen Jugend, da griff allerdings der Oberkirchenrat ein); das berühmte Luthermännchen von Playmobil, das alle kirchlichen Marketingstrategen als großen Erfolg verkaufen. Irgendein Nuntius in einem mittelamerikanischen Land soll beim Hersteller eine größere Bestellung getätigt haben, um die regionale Bischofskonferenz zu versorgen. Das ist aber nicht alles. Zum Katalog der Werbemittel werden Kirchenfahnen, Aufsteller, Postkarten, Flyer, Tausende von Flyern, Kugelschreiber, Schreibblöcke, Apps und vieles mehr hinzugefügt, das meiste davon wohlfeil in E-Shops zum Verkauf angeboten. Wenn der Bäcker im Ältestenkreis sitzt, kann man sicher sein, dass zum Reformationstag irgendein angebliches Luthergebäck und zu Pfingsten luftige Blätterteigstückchen (pneuma heißt Hauch) verkauft werden. Kirchen und Gemeinden begeben sich auf ein Gebiet, wo der Kommerz herrscht, nämlich die Werbung. Auf diesem Feld herrscht Konkurrenz um Aufmerksamkeit, und dafür benötigt es Fachleute, denen es ohne weiteres gelingt, den Fachleuten für Glauben und Argumente, den Theologen, die Deutungs- und Gestaltungshoheit zu nehmen. Aufmerksamkeit ist die neue Wahrheit.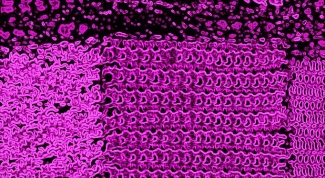 Als eine der schlimmsten Fehlentwicklungen erscheint die Tatsache, dass der Gottesdienst immer weiter aus dem Zentrum liturgischer, theologischer, gemeindlicher und kirchlicher Aufmerksamkeit rückt. Stand er früher im Zentrum der Gemeindearbeit und der Tätigkeit des Pfarrers, wird er nun zum Nebenschauplatz, eine Sonderveranstaltung für die wenigen Menschen, die sich noch für Singen, Gebet und Liturgie interessieren. Besonders in Arbeitsformen wie „Citykirchenarbeit“ rücken biblische Geschichten aus dem Zentrum weg und verwandeln sich zum bloßen Anlass für eine Vielzahl von Aktivitäten, vom gemeinsamem Brotbacken über Ausstellungen von Laienkünstlern, Versteigerungen bis zu Flohmärkten und anderem mehr. All das gab es auch schon früher. Aber früher diente alles dazu, zum Gottesdienst hinzuführen, während heute die Tendenz besteht, das Nebensächliche und Hinführende für die Sache selbst zu halten. Glauben und Bibel werden zum Stichwortgeber für Aktivitäten reduziert, die man auch woanders finden kann.
Als eine der schlimmsten Fehlentwicklungen erscheint die Tatsache, dass der Gottesdienst immer weiter aus dem Zentrum liturgischer, theologischer, gemeindlicher und kirchlicher Aufmerksamkeit rückt. Stand er früher im Zentrum der Gemeindearbeit und der Tätigkeit des Pfarrers, wird er nun zum Nebenschauplatz, eine Sonderveranstaltung für die wenigen Menschen, die sich noch für Singen, Gebet und Liturgie interessieren. Besonders in Arbeitsformen wie „Citykirchenarbeit“ rücken biblische Geschichten aus dem Zentrum weg und verwandeln sich zum bloßen Anlass für eine Vielzahl von Aktivitäten, vom gemeinsamem Brotbacken über Ausstellungen von Laienkünstlern, Versteigerungen bis zu Flohmärkten und anderem mehr. All das gab es auch schon früher. Aber früher diente alles dazu, zum Gottesdienst hinzuführen, während heute die Tendenz besteht, das Nebensächliche und Hinführende für die Sache selbst zu halten. Glauben und Bibel werden zum Stichwortgeber für Aktivitäten reduziert, die man auch woanders finden kann. Es wäre falsch, die Schurkenrolle in diesem Stück nur den Marketingfachleuten zuzuweisen. Prozesse der Banalisierung sind längst in die Theologie selbst eingedrungen. Das zeigt sich zum einen daran, dass im Bewusstsein vieler Pfarrer der Gottesdienst vom zentralen Ort des Glaubens und der Verkündigung zu einer Nebenveranstaltung für traditionsbewusste Senioren geworden ist, die sich nicht mehr auf die sozialen Medien einlassen wollen. Diese Abwendung und Dezentrierung theologischer Gehalte reicht leider bis in die Predigt hinein. Die theologische Krise ist auch eine homiletische und eine rhetorische.
Es wäre falsch, die Schurkenrolle in diesem Stück nur den Marketingfachleuten zuzuweisen. Prozesse der Banalisierung sind längst in die Theologie selbst eingedrungen. Das zeigt sich zum einen daran, dass im Bewusstsein vieler Pfarrer der Gottesdienst vom zentralen Ort des Glaubens und der Verkündigung zu einer Nebenveranstaltung für traditionsbewusste Senioren geworden ist, die sich nicht mehr auf die sozialen Medien einlassen wollen. Diese Abwendung und Dezentrierung theologischer Gehalte reicht leider bis in die Predigt hinein. Die theologische Krise ist auch eine homiletische und eine rhetorische.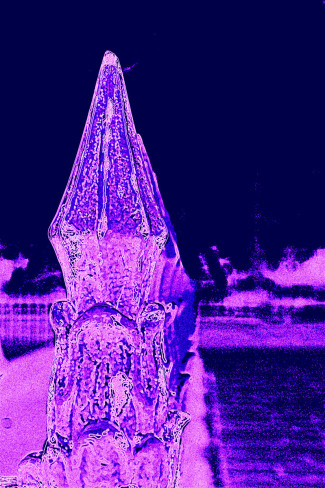 Die in den letzten Abschnitten beobachtete Tendenz zu Banalisierung und Dezentrierung lässt sich auch bei der Bekenntnisbildung beobachten. Die Synode der Badischen Landeskirche verabschiedete um die Jahrtausendwende eine Reihe von Leitsätzen
Die in den letzten Abschnitten beobachtete Tendenz zu Banalisierung und Dezentrierung lässt sich auch bei der Bekenntnisbildung beobachten. Die Synode der Badischen Landeskirche verabschiedete um die Jahrtausendwende eine Reihe von Leitsätzen Wie leichtfertig Kirchen mit dem eigenen semantischen und theologischen Kapital umgehen, zeigt sich auch an den diversen Dialogen, die innerchristlich-ökumenisch und interreligiös geführt werden. In der evangelisch-katholischen Abendmahlsdiskussion ist keine Bewegung zu spüren, jedenfalls keine solche, welche zur gegenseitigen Zulassung zur Eucharistie führen würde, trotz der gegenteiligen Beteuerungen der Protagonisten auf beiden Seiten.
Wie leichtfertig Kirchen mit dem eigenen semantischen und theologischen Kapital umgehen, zeigt sich auch an den diversen Dialogen, die innerchristlich-ökumenisch und interreligiös geführt werden. In der evangelisch-katholischen Abendmahlsdiskussion ist keine Bewegung zu spüren, jedenfalls keine solche, welche zur gegenseitigen Zulassung zur Eucharistie führen würde, trotz der gegenteiligen Beteuerungen der Protagonisten auf beiden Seiten. Schaut man sich die gegenwärtige Landschaft der evangelischen Kirche unter dem Gesichtspunkt der Beziehung zur politischen Kultur an, so sind die früher trennscharfen Aufteilungen verschwunden. Man stellt fest, dass die Gruppen sich mehr vermischen als früher, wenn auch die grundsätzlichen Positionen dieselben geblieben sind. Nach meiner Beobachtung sinkt die Bedeutung des konservativen kirchlichen Luthertums. Weiterhin öffentlich wirksam ist eine große Fraktion pietistischer und evangelikaler Gruppen, einige von ihnen mit einem Hang zum Fundamentalismus, andere mit einer Neigung zum Rechtspopulismus. Erhalten haben sich Reste einer einstmals starken Theologie der ökumenischen Bewegung, deren dualistisches Ausweichen ins Apokalyptische und Manichäische in den nicht-europäischen Kirchen immer noch gut anzukommen scheint. Eine Gruppe liberaler, an Schleiermacher orientierter Theologen ist eher an der Universität als in Gemeinden und Kirchen verortet. Das klerikale Establishment sammelt sich in der Verwaltung der EKD und pflegt die lieb gewordene Achse zwischen Berlin und Hannover samt wechselseitiger Seilschaften zwischen Kirche und Politik. Alle diese erwähnten Gruppierungen verstehen sich als theologisch-politische pressure groups, die irgendwo zwischen Kirchentagspodien und -debatten, Johannisempfang, den Kommentarseiten der großen Tages- und Wochenzeitungen, Synoden, Tagungen, Kongressen darauf warten, in Gängen, Fluren das gemeinsame unverbindliche Gespräch zum Zwecke der Einflussnahme auf die politische Kultur im weitesten Sinne zu pflegen. Die eigene theologische Identität pflegte man in den Sechzigern als Befreiungstheologie, in den Achtzigern und Neunzigern als politische und danach als öffentliche Theologie zu artikulieren. Man kann all diese Begriffe als bequeme Versuche verstehen, sich theologisch in der jeweiligen politischen Wirklichkeit einzurichten.
Schaut man sich die gegenwärtige Landschaft der evangelischen Kirche unter dem Gesichtspunkt der Beziehung zur politischen Kultur an, so sind die früher trennscharfen Aufteilungen verschwunden. Man stellt fest, dass die Gruppen sich mehr vermischen als früher, wenn auch die grundsätzlichen Positionen dieselben geblieben sind. Nach meiner Beobachtung sinkt die Bedeutung des konservativen kirchlichen Luthertums. Weiterhin öffentlich wirksam ist eine große Fraktion pietistischer und evangelikaler Gruppen, einige von ihnen mit einem Hang zum Fundamentalismus, andere mit einer Neigung zum Rechtspopulismus. Erhalten haben sich Reste einer einstmals starken Theologie der ökumenischen Bewegung, deren dualistisches Ausweichen ins Apokalyptische und Manichäische in den nicht-europäischen Kirchen immer noch gut anzukommen scheint. Eine Gruppe liberaler, an Schleiermacher orientierter Theologen ist eher an der Universität als in Gemeinden und Kirchen verortet. Das klerikale Establishment sammelt sich in der Verwaltung der EKD und pflegt die lieb gewordene Achse zwischen Berlin und Hannover samt wechselseitiger Seilschaften zwischen Kirche und Politik. Alle diese erwähnten Gruppierungen verstehen sich als theologisch-politische pressure groups, die irgendwo zwischen Kirchentagspodien und -debatten, Johannisempfang, den Kommentarseiten der großen Tages- und Wochenzeitungen, Synoden, Tagungen, Kongressen darauf warten, in Gängen, Fluren das gemeinsame unverbindliche Gespräch zum Zwecke der Einflussnahme auf die politische Kultur im weitesten Sinne zu pflegen. Die eigene theologische Identität pflegte man in den Sechzigern als Befreiungstheologie, in den Achtzigern und Neunzigern als politische und danach als öffentliche Theologie zu artikulieren. Man kann all diese Begriffe als bequeme Versuche verstehen, sich theologisch in der jeweiligen politischen Wirklichkeit einzurichten. Theologische Argumente kommen inhaltlich zu kurz. Aber der Stellenwert der Theologie wird auch in der Personalpolitik systematisch verkürzt und damit banalisiert. An gleich mehreren Stellen werden Differenzen in der theologischen und ethischen Kompetenz systematisch nivelliert. Das betrifft den Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, Pfarrern und Diakonen, zwischen Pfarrern und Prädikanten. Selbstverständlich sind Gemeinden und Kirchen auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Selbstverständlich ist es zu begrüßen, wenn die evangelischen Kirchen so etwas wie eine katholische Priesterweihe nicht kennen und sich mit guten Gründen auf eine Ordination beschränken.
Theologische Argumente kommen inhaltlich zu kurz. Aber der Stellenwert der Theologie wird auch in der Personalpolitik systematisch verkürzt und damit banalisiert. An gleich mehreren Stellen werden Differenzen in der theologischen und ethischen Kompetenz systematisch nivelliert. Das betrifft den Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, Pfarrern und Diakonen, zwischen Pfarrern und Prädikanten. Selbstverständlich sind Gemeinden und Kirchen auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Selbstverständlich ist es zu begrüßen, wenn die evangelischen Kirchen so etwas wie eine katholische Priesterweihe nicht kennen und sich mit guten Gründen auf eine Ordination beschränken. Der beschriebene kirchliche Nivellierungszwang, die verhängnisvolle Tendenz zur Deprofessionalisierung der Theologie schlägt durch bis auf die klerikalen Bürokratien. Die hehren Prinzipien der Kirchenleitung, von der mutua consolatio fratrum über die Kirche als Gemeinde von Brüdern (Barmen III), die angebliche „Dienstgemeinschaft“ oder das Verständnis des Kirchenrechts als juristische Artikulation des helfenden und heilenden Handelns Jesu Christi, sie alle halten dem Stresstest der klerikalen Wirklichkeit nicht stand. An die Stelle des in den Bekenntnissen artikulierten Ideals tritt ein Habitus, der bestimmt ist von Kleinmut, uneingestandener Angst, fehlendem theologischen Wissen und der Sehnsucht nach „Wertschätzung“
Der beschriebene kirchliche Nivellierungszwang, die verhängnisvolle Tendenz zur Deprofessionalisierung der Theologie schlägt durch bis auf die klerikalen Bürokratien. Die hehren Prinzipien der Kirchenleitung, von der mutua consolatio fratrum über die Kirche als Gemeinde von Brüdern (Barmen III), die angebliche „Dienstgemeinschaft“ oder das Verständnis des Kirchenrechts als juristische Artikulation des helfenden und heilenden Handelns Jesu Christi, sie alle halten dem Stresstest der klerikalen Wirklichkeit nicht stand. An die Stelle des in den Bekenntnissen artikulierten Ideals tritt ein Habitus, der bestimmt ist von Kleinmut, uneingestandener Angst, fehlendem theologischen Wissen und der Sehnsucht nach „Wertschätzung“ In individualisierten, pluralistischen und vor allem unübersichtlichen Gesellschaften werden die Funktionen von intermediären Institutionen, die zwischen Individuum und gesellschaftlichen Gesamtinteressen vermitteln, prekär. Entsprechend sind nicht nur Kirchen, sondern auch Gewerkschaften, Parteien, Sportverbände und -vereine in eine Krise geraten. Die Kirchen sind also in ihren sozialstrukturellen Schwierigkeiten nicht allein. Wie andere Assoziationen stehen sie vor der Frage, wie sie Bindungen schaffen, Engagement fördern und für Menschen attraktiv werden, die offensichtlich eine Scheu davor haben, sich langfristig an eine Institution zu binden.
In individualisierten, pluralistischen und vor allem unübersichtlichen Gesellschaften werden die Funktionen von intermediären Institutionen, die zwischen Individuum und gesellschaftlichen Gesamtinteressen vermitteln, prekär. Entsprechend sind nicht nur Kirchen, sondern auch Gewerkschaften, Parteien, Sportverbände und -vereine in eine Krise geraten. Die Kirchen sind also in ihren sozialstrukturellen Schwierigkeiten nicht allein. Wie andere Assoziationen stehen sie vor der Frage, wie sie Bindungen schaffen, Engagement fördern und für Menschen attraktiv werden, die offensichtlich eine Scheu davor haben, sich langfristig an eine Institution zu binden. Ein zweiter Grund für die verbreiteten Tendenzen zur Banalisierung liegt im zunehmenden Geländegewinn einer bestimmten Ideologie der Gleichheit. Alle können sich ‚einbringen‘. Alle können predigen. Alle können theologisch argumentieren. Alle können und sollen sich engagieren. In der klerikalen Amtssprache heißt das ‚Priestertum aller Gläubigen‘. Die Formel ist ein probates protestantisches Totschlagargument, um jegliche Form sozialer und personeller Differenzierung zu untergraben. Die anhaltende Nivellierung des Unterschiedes zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, zwischen Pfarrern und Prädikanten, zwischen Funktionären und Engagierten ist schon angesprochen worden. Im Grunde werden so Funktionen aufgehoben, Professionalisierung wird verhindert. Wenn jeder alles erledigen kann, sind Kompetenzen nicht mehr nötig. Für die einzelnen Berufs- und Funktionsbilder (Pfarrer, Diakone, Älteste, Prädikanten etc.) bilden sich massive Krisen des Selbstverständnisses aus, weil Aufgaben nicht mehr trennscharf verteilt werden. Jeder ist der Meinung, alles zu können. Weil er alles kann, wird er mit Arbeit überhäuft und klagt in der Folge massiv über Zeitdefizite und Arbeitsüberlastung. Wenn niemand weiß, was er tun muss, muss alles endlos besprochen werden, so lange, bis alle ‚mit-gehen‘ können.
Ein zweiter Grund für die verbreiteten Tendenzen zur Banalisierung liegt im zunehmenden Geländegewinn einer bestimmten Ideologie der Gleichheit. Alle können sich ‚einbringen‘. Alle können predigen. Alle können theologisch argumentieren. Alle können und sollen sich engagieren. In der klerikalen Amtssprache heißt das ‚Priestertum aller Gläubigen‘. Die Formel ist ein probates protestantisches Totschlagargument, um jegliche Form sozialer und personeller Differenzierung zu untergraben. Die anhaltende Nivellierung des Unterschiedes zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, zwischen Pfarrern und Prädikanten, zwischen Funktionären und Engagierten ist schon angesprochen worden. Im Grunde werden so Funktionen aufgehoben, Professionalisierung wird verhindert. Wenn jeder alles erledigen kann, sind Kompetenzen nicht mehr nötig. Für die einzelnen Berufs- und Funktionsbilder (Pfarrer, Diakone, Älteste, Prädikanten etc.) bilden sich massive Krisen des Selbstverständnisses aus, weil Aufgaben nicht mehr trennscharf verteilt werden. Jeder ist der Meinung, alles zu können. Weil er alles kann, wird er mit Arbeit überhäuft und klagt in der Folge massiv über Zeitdefizite und Arbeitsüberlastung. Wenn niemand weiß, was er tun muss, muss alles endlos besprochen werden, so lange, bis alle ‚mit-gehen‘ können.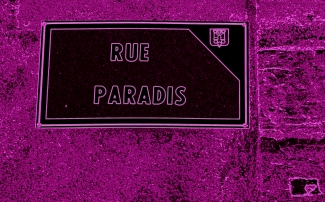 Prozesse der Banalisierung in der Kirche wurden schon öfter in diesem Papier auf einen verringerten Einfluss der Theologie und theologischer Argumente zurückgeführt. Dabei scheint mir das begründete Sprechen über den Glauben genau eine derjenigen Erwartungen zu sein, die Menschen gegenüber Gemeinden und Kirchen artikulieren. Genau an diesem Punkt liegt doch der unique selling point, den die kirchlichen Marketingexperten so gerne beschwören. Dabei muss Theologie nicht in wissenschaftlicher Fachsprache artikuliert werden. Sie umfasst ein weites Spektrum symbolischer und sprachlicher Artikulationsformen. Es stellen sich Fragen, welche Gestalt der Glaube annimmt, wenn die Grundtexte des Glaubens mit den Erfahrungen der Gegenwart ins Gespräch gebracht werden. Richtig ist, dass sich solche Fragen schon in der Alten Kirche stellten, aber damals in einer Weise gelöst wurden, dass sich theologische Intellektuelle der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Philosophie stellten und letztere auch voranbrachten. Wer eine aktuelle Biographie des Verfassers der Confessiones, Augustin liest, der stellt überrascht fest, dass diesem bis zu seiner Ernennung zum Bischof die Auseinandersetzung mit seinen philosophischen Freunden sehr viel wichtiger war als die klerikale Rechthaberei.
Prozesse der Banalisierung in der Kirche wurden schon öfter in diesem Papier auf einen verringerten Einfluss der Theologie und theologischer Argumente zurückgeführt. Dabei scheint mir das begründete Sprechen über den Glauben genau eine derjenigen Erwartungen zu sein, die Menschen gegenüber Gemeinden und Kirchen artikulieren. Genau an diesem Punkt liegt doch der unique selling point, den die kirchlichen Marketingexperten so gerne beschwören. Dabei muss Theologie nicht in wissenschaftlicher Fachsprache artikuliert werden. Sie umfasst ein weites Spektrum symbolischer und sprachlicher Artikulationsformen. Es stellen sich Fragen, welche Gestalt der Glaube annimmt, wenn die Grundtexte des Glaubens mit den Erfahrungen der Gegenwart ins Gespräch gebracht werden. Richtig ist, dass sich solche Fragen schon in der Alten Kirche stellten, aber damals in einer Weise gelöst wurden, dass sich theologische Intellektuelle der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Philosophie stellten und letztere auch voranbrachten. Wer eine aktuelle Biographie des Verfassers der Confessiones, Augustin liest, der stellt überrascht fest, dass diesem bis zu seiner Ernennung zum Bischof die Auseinandersetzung mit seinen philosophischen Freunden sehr viel wichtiger war als die klerikale Rechthaberei.  Wer der Theologie nicht mehr traut, um Kirchenleitung auszuüben, der greift gerne neben der Sympathie für die Geschenkpapierexperten des klerikalen Marketings gerne auf die Religionssoziologie zurück. Diese lebt von der Verheißung größerer Nähe zur Empirie und von der Erwartung, dass in dieser Wissenschaft normative und empirische Elemente besser auseinandergehalten werden als in der praktischen Theologie. Die Reihe von regelmäßigen Untersuchungen zur Kirchenmitgliedschaft in der EKD stellt das eindrucksvoll unter Beweis, was die empirischen Daten angeht. Trotzdem kommen Kirchenleitungen auch mit solchen Untersuchungen, nicht näher an die Menschen heran. Sie versuchen, das Legitimationskapital größerer empirischer Nähe dafür zu nutzen, bestimmte praktisch-theologische Rezepte auf den Weg zu bringen, die sich aber in der Regel praktisch nicht bewähren.
Wer der Theologie nicht mehr traut, um Kirchenleitung auszuüben, der greift gerne neben der Sympathie für die Geschenkpapierexperten des klerikalen Marketings gerne auf die Religionssoziologie zurück. Diese lebt von der Verheißung größerer Nähe zur Empirie und von der Erwartung, dass in dieser Wissenschaft normative und empirische Elemente besser auseinandergehalten werden als in der praktischen Theologie. Die Reihe von regelmäßigen Untersuchungen zur Kirchenmitgliedschaft in der EKD stellt das eindrucksvoll unter Beweis, was die empirischen Daten angeht. Trotzdem kommen Kirchenleitungen auch mit solchen Untersuchungen, nicht näher an die Menschen heran. Sie versuchen, das Legitimationskapital größerer empirischer Nähe dafür zu nutzen, bestimmte praktisch-theologische Rezepte auf den Weg zu bringen, die sich aber in der Regel praktisch nicht bewähren.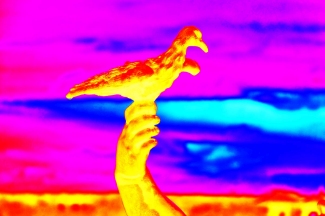 Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer
Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer Näher als Bauer an der (evangelischen) Theologie hat die Marburger Theologin Ulrike Wagner-Rau den gegenwärtigen Zustand der Kirche mit der Metapher vom Zwischenraum charakterisiert.
Näher als Bauer an der (evangelischen) Theologie hat die Marburger Theologin Ulrike Wagner-Rau den gegenwärtigen Zustand der Kirche mit der Metapher vom Zwischenraum charakterisiert. Bei dem Symposium, auf dem Wagner-Rau ihre These von der Zwischenräumlichkeit von Welt und Kirche vorstellte, entwickelt der praktische Theologe Jan Hermelink Gedanken
Bei dem Symposium, auf dem Wagner-Rau ihre These von der Zwischenräumlichkeit von Welt und Kirche vorstellte, entwickelt der praktische Theologe Jan Hermelink Gedanken Der Soziologe Hans Joas gehört zu denen, die die Präsenz von Religion in der Moderne stets verteidigt haben und dafür gute Gründe gegen deformierende Säkularisierungs- und Modernisierungstheorien anführten. Er fand für Religionen in der Moderne die Formel von der „kontingenten Gewissheit“
Der Soziologe Hans Joas gehört zu denen, die die Präsenz von Religion in der Moderne stets verteidigt haben und dafür gute Gründe gegen deformierende Säkularisierungs- und Modernisierungstheorien anführten. Er fand für Religionen in der Moderne die Formel von der „kontingenten Gewissheit“