
Kirchenkritik |
Die Zweideutigkeit der EindeutigkeitEine RezensionWolfgang Vögele
Ambiguitätstoleranz – so lautet nach dem Vorschlag des Münsteraner Islamwissenschaftlers Thomas Bauer das neue Zauberwort, um aktuelle Debatten über Integration, Rechtspopulismus, Leitkultur und Wertebewusstsein zu kommentieren und ihnen vor allem etwas entgegenzusetzen. Kultur und Natur laufen parallel: Zuerst einmal konstatiert Bauer einen Rückgang der Artenvielfalt in der Natur. Dem entspricht eine Reduktion kultureller Vielfalt im Zuge der Globalisierung. MacDonald’s breitet sich überall auf der Welt aus, während die Touristen an den Imbissbuden vor den Sehenswürdigkeiten regionales Essen verschmähen. Dem setzt Bauer die Praxis der Handelsstädte des Mittleren Ostens entgegen. Vor dem 20.Jahrhundert herrschte in ihnen stimulierende kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt, während sich solche Vielfalt in den globalisierten Großstädten des 21.Jahrhunderts immer mehr reduziert. Wer Handel treiben will, muss Vielfalt ertragen können, um auch mit denen Geschäfte zu machen, die einer anderen Religion oder Kultur angehören. Forderungen nach Einheits- oder Leitkultur oder nach einseitiger Integration behindern die Akzeptanz solcher Vielfalt, zerstören sie sogar. Dieser leitkulturellen Zerstörungswut gegenüber Differenzen, so Bauers zentrale These, liegt die Unfähigkeit zugrunde, Ambivalenzen und Ambiguitäten auszuhalten. Es muss ja nicht alles eindeutig geregelt sein. Es muss ja nicht alles entschieden sein. Es muss ja nicht alles einheitlich aussehen. Nicht jede (soziale) Frage muss eindeutig gelöst werden. Es kann hilfreich sein, solche Fragen einfach offenzuhalten – bis sie sich vielleicht von alleine lösen.
Nach seiner Auffassung haben westliche Gesellschaften der Sehnsucht nach dem Eindeutigen schon viel zu sehr nachgegeben, während kulturelle Vielfalt, Pluralismus und Diversität zu sehr ins Hintertreffen geraten sind. Verantwortlich dafür sind Rechtspopulisten, terribles simplificateurs, Scharfmacher, Einpeitscher, Demagogen. Dagegen stellt der Verfasser ein Idealbild ambiguitätstoleranter Bürgerlichkeit und Religiosität: Leben und leben lassen! Jedem Tierchen sein Pläsierchen! Mit Ambiguitätstoleranz lassen sich Streitgegenstände entschärfen. Das Erbitterte, Zornige und Überschäumende der Wutbürger kann durch Gelassenheit herunterreguliert und abgekühlt werden. Nicht jeder Konflikt muss zum Austrag kommen. In welchen Kulturen und sozialen Systemen findet sich Ambiguitätstoleranz besonders ausgeprägt? Bauer stellt die alten pluralistischen Deutungskulturen arabischer, islamischer und jüdischer Gelehrsamkeit gegen religiösen Rigorismus und Fundamentalismus. Der calvinistischer Tugendterror im Genf des 16.Jahrhunderts steht gegen die vorkonziliare katholische Kirche, die es vermochte, lokale und regionale Religionskulturen zu assimilieren. „Wahrheitsobsession, Geschichtsverneinung und Reinheitsstreben sind also drei Wesenszüge bzw. Grundbegriffe von Ambiguitätsintoleranz, die die Basis jedes Fundamentalismus bilden.“ (29) Leider hatte auch die katholische Ambiguitätstoleranz ihre Grenzen. Man kann fragen, ob hier nicht doch nur ein historisches Klischee bedient wird. Denn die Katholiken hätten ja wohl auch Martin Luther verbrannt, wenn sie seiner denn habhaft geworden wären. Und die gegenwärtigen innerkatholischen Querelen um die Zulassung nichtkatholischer Christen zum Abendmahl zeigen leider zu deutlich die Grenzen von Bauers Argument. Trotzdem sind seine drei Stichworte systematisch interessant, auch in religiöser Hinsicht.
Genauso wie Religion befördert Kunst Ambiguitätstoleranz. Symbolisch steht dafür Richard Wagners unentschiedener Tristanakkord, der sich nicht mehr in das alte Dur-Moll-System auflösen lässt. Kunsttheoretisch steht für die fundamentalistische Haltung die Musikphilosophie Adornos, die außer der eigenen Zwölftonmusik und -theorie keine anderen musikalischen Richtungen zulassen wollte. Aber ist der Wunsch nach eindeutigen Thesen so zu verachten, wie Bauer meint? Denn Adornos Philosophie wäre harmlos und schal, wenn sie nicht geprägt wäre von einer inneren Konsequenz, die nach einer bestimmten Unzweideutigkeit verlangt. Kann man dem Wunsch nach Eindeutigkeit in der zweideutigen Wirklichkeit so sehr verurteilen? Es wäre zu fragen, wieviel Eindeutigkeit – Adorno sagte identisches Denken – jemand braucht, um sich im Alltag zurechtzufinden. Denn eine Welt, die dauernd zweideutig schillert und oszilliert, bietet nicht die Orientierung, die Menschen zur Orientierung in ihrer Lebenswelt brauchen. Hier rächt sich nach meinem Eindruck, dass der Begriff des Ambigen philosophisch und anthropologisch unterbestimmt bleibt. Vermutlich kommt niemand ohne ein paar Bausteine der Eindeutigkeit – und seien es Hypothesen, Werte, Gewissheiten - aus, um sich in Lebenswelt, Politik und Gesellschaft zurechtzufinden. Dauerrelativismus zerstört auf die Dauer den intellektuellen Gleichgewichtssinn. Das heißt nicht, dass ich Bauers Grundanliegen nicht teile. Aber ganz ohne Gewissheiten, Grundwerte und Grundpositionen verlieren sich Bürger und Bürgergesellschaft in einem Taumel der Unsicherheiten.
Beide, Kunst und Religion, sind Medien der Wirklichkeitserfahrung, -verarbeitung und -deutung. Theologisch interessant erscheint mir Bauers Kritik des Authentizitätskults in Kunst und Religion. Wer authentisch und sich selbst verwirklichend seine Natur auslebt, mutet sich dem jeweils Anderen unvermittelt zu. Er bearbeitet nicht, was er an Erfahrungen gemacht hat. Kunst und Religion dagegen sind für Bauer soziale Medien von Gestaltung, Anstrengung und Überlegung. Wer authentisch und also allein Kunst fabriziert und Religion lebt, der schaut nur auf sich selbst und macht sich bzw. das Eigene zum Maßstab aller Dinge. Das Authentische gilt als unhinterfragter Selbstzweck und befördert so einen falschen Kult der Eindeutigkeit, des Unverstellten und Unvermittelten. Bauer entlarvt diesen Authentizitätskult als Strategie, Doppeldeutigkeiten zu ignorieren. Eine weitere Ausweichstrategie sieht Bauer auch im Kästchendenken (81). Damit meint er Schwarzweißstrategien, die Wirklichkeit auf polare oder duale Begriffspaare bringen.
Kann man an diese demokratietheoretisch und pluralismusoffenen Überlegungen theologisch anschließen? Es wäre an die Paradoxien der Kreuzestheologie zu denken, an den Unterschied zwischen securitas (das harte, fundamentalistische Wahrheitsbewusstsein) und certitudo (die weiche, vom Zweifel begleitete Glaubensgewissheit, die stets neu hergestellt werden muss). Es wäre zu denken an die Einkapselungen von Evangelikalen mit ihrem unterkomplexen Glaubensmodell, an Kirchenleitungen mit ihrer überkomplexen Bürokratie, die jeglichen Kontakt mit dem Glaubensleben des Alltags verhindern, und an klerikale Marketingstrategen mit ihrem Projekt einer Banalisierung der kirchlicher Vollzüge. Der Vieldeutigkeit der Welt darf nicht durch Strategien der Vereinfachung und Verharmlosung begegnet werden. Man richtet sich beim so unheimlich lieben Gott ein wie andere bei Ikea. Harmlosigkeit ist auch ein verlockender, aber eben doch falscher Weg, die Überkomplexität der Welt fromm wegzulächeln. Eine Rose, ein Seidentuch und zwei Thermoskannen Kamillentee, das ist die gestaltete Mitte der frömmelnden Spiritualisten, deren antiintellektueller Furor die Bücher mit den prophetischen Binsenweisheiten Margot Käßmanns zu Bestsellern gemacht hat. Dieser theologiefreie Protestantismus berauscht sich an Räucherkerzen, Taizégesängen und einer Überdosis von wie Orden verteilten „Wertschätzungen“. Aber Harmlosigkeit wirkt genauso als Verweigerung der Gegenwart wie Fundamentalismus. Bauers anregender Essay enthält nicht nur starke Thesen, um Globalisierung und Pluralisierung politisch und sozial zu begegnen. In der Mitte dieser Thesen verbergen sich Elemente einer Religionstheorie, die dazu dienen könnte, den Protestantismus modernitätstauglicher zu machen. Anmerkung[1] Alle Seitenangaben im Text beziehen sich auf das vorgestellte Werk. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/115/wv047.htm |
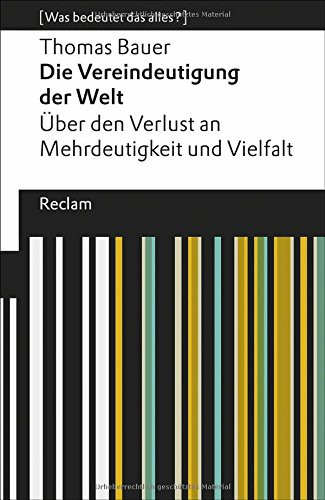 Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt, Ditzingen 2018 (4. Aufl.)
Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt, Ditzingen 2018 (4. Aufl.) Die Welt, die ein Beobachter als Wirklichkeit wahrnimmt, ist nicht eindeutig, sondern sie schillert vielgestaltig. Sie kann aus ganz verschiedenen Perspektiven interpretiert werden. Das nennt Bauer die Ambiguität der Welt. Die Vokabel beerbt und überbietet die alte Wendung von Jürgen Habermas, der die „Unübersichtlichkeit“ der Welt konstatiert hatte. Übersicht und Überblick kann man gewinnen, wenn man auf eine Anhöhe oder eine Leiter steigt. Wer herunterkommt, kann aus dem Überblick Konsequenzen für das eigene Handeln ziehen. Für Habermas war die Welt noch vernünftig zu bewältigen, seine Diskursteilnehmer konnten sich an der Unübersichtlichkeit abarbeiten. Bauers Weltbeobachter können Ambivalenzen stehen lassen und Unübersichtlichkeiten aushalten.
Die Welt, die ein Beobachter als Wirklichkeit wahrnimmt, ist nicht eindeutig, sondern sie schillert vielgestaltig. Sie kann aus ganz verschiedenen Perspektiven interpretiert werden. Das nennt Bauer die Ambiguität der Welt. Die Vokabel beerbt und überbietet die alte Wendung von Jürgen Habermas, der die „Unübersichtlichkeit“ der Welt konstatiert hatte. Übersicht und Überblick kann man gewinnen, wenn man auf eine Anhöhe oder eine Leiter steigt. Wer herunterkommt, kann aus dem Überblick Konsequenzen für das eigene Handeln ziehen. Für Habermas war die Welt noch vernünftig zu bewältigen, seine Diskursteilnehmer konnten sich an der Unübersichtlichkeit abarbeiten. Bauers Weltbeobachter können Ambivalenzen stehen lassen und Unübersichtlichkeiten aushalten. Ambiguität ist für ein nicht zu beseitigender Dauerzustand, sie umfasst „Phänomene der Mehrdeutigkeit, der Unentscheidbarkeit und Vagheit“ (13)
Ambiguität ist für ein nicht zu beseitigender Dauerzustand, sie umfasst „Phänomene der Mehrdeutigkeit, der Unentscheidbarkeit und Vagheit“ (13) Bauer vertieft seine Analysen von Religion: Wer nur auf seiner Wahrheit besteht, wird zum Fundamentalisten. Gottes Wille jedoch, lässt sich eben nicht so einfach ausrechnen wie eine Dreisatzgleichung. Religion ist für Bauer dialogischer Umgang mit unberechenbarer Transzendenz. Menschen deuten gemeinsam und im Gespräch, was sie an Erfahrungen der Transzendenz gemacht haben. Auch eine Offenbarung kann solche Zweideutigkeit des Transzendenten nicht restlos auflösen. Religion ist grundsätzlich eine Interpretationskultur, die je und je mit den Anhängern des eigenen Glaubens geteilt, stabilisiert und auf Dauer gestellt werden muss. Innerhalb einer Religion konkurrieren einzelne Gruppen, die sich nach dem Grad ihres Gewissheitsbewusstseins unterscheiden lassen. Fundamentalisten aller Richtungen beanspruchen souveräne Deutungshoheit für die eigenen frommen Lesarten. Auf der anderen Seite des Spektrums stehen Dialogiker, Liberale, die sagen: We agree to disagree. Bauer zitiert dafür den Propheten Mohammed, der gesagt haben soll: „Meinungsverschiedenheiten sind eine Gnade für die Gemeinde.“ (39)
Bauer vertieft seine Analysen von Religion: Wer nur auf seiner Wahrheit besteht, wird zum Fundamentalisten. Gottes Wille jedoch, lässt sich eben nicht so einfach ausrechnen wie eine Dreisatzgleichung. Religion ist für Bauer dialogischer Umgang mit unberechenbarer Transzendenz. Menschen deuten gemeinsam und im Gespräch, was sie an Erfahrungen der Transzendenz gemacht haben. Auch eine Offenbarung kann solche Zweideutigkeit des Transzendenten nicht restlos auflösen. Religion ist grundsätzlich eine Interpretationskultur, die je und je mit den Anhängern des eigenen Glaubens geteilt, stabilisiert und auf Dauer gestellt werden muss. Innerhalb einer Religion konkurrieren einzelne Gruppen, die sich nach dem Grad ihres Gewissheitsbewusstseins unterscheiden lassen. Fundamentalisten aller Richtungen beanspruchen souveräne Deutungshoheit für die eigenen frommen Lesarten. Auf der anderen Seite des Spektrums stehen Dialogiker, Liberale, die sagen: We agree to disagree. Bauer zitiert dafür den Propheten Mohammed, der gesagt haben soll: „Meinungsverschiedenheiten sind eine Gnade für die Gemeinde.“ (39) Das scheint auch Bauer zu ahnen: „Ambiguität, die bereichert, findet nur zwischen den Polen Eindeutigkeit und unendlich vielen Bedeutungen statt. Es kommt auf das rechte Maß an.“ (50) Irgendwann erweist sich der Kultur- und Islamwissenschaftler dann doch als katholischer Aristoteliker, der nach Maß und Mittelweg sucht. Ambiguität ist dann plötzlich nicht mehr ein Wert in sich selbst, sondern das entscheidende Incentive, um die Deutungsmaschine anzuwerfen. Ambiguität bedeutet gleichermaßen das Aushalten von Doppeldeutigkeit wie die Interpretationsarbeit daran. Intellektuelle Auflösungen solcher Ambiguität dürfen nicht zu kompliziert und unübersichtlich, aber eben auch nicht zu simpel sein. Das deutende Ich oder Interpretationsgemeinschaften wie Religionen, Parteien, andere soziale Gruppen müssen in der Lage sein, Ambiguität bewältigen zu können.
Das scheint auch Bauer zu ahnen: „Ambiguität, die bereichert, findet nur zwischen den Polen Eindeutigkeit und unendlich vielen Bedeutungen statt. Es kommt auf das rechte Maß an.“ (50) Irgendwann erweist sich der Kultur- und Islamwissenschaftler dann doch als katholischer Aristoteliker, der nach Maß und Mittelweg sucht. Ambiguität ist dann plötzlich nicht mehr ein Wert in sich selbst, sondern das entscheidende Incentive, um die Deutungsmaschine anzuwerfen. Ambiguität bedeutet gleichermaßen das Aushalten von Doppeldeutigkeit wie die Interpretationsarbeit daran. Intellektuelle Auflösungen solcher Ambiguität dürfen nicht zu kompliziert und unübersichtlich, aber eben auch nicht zu simpel sein. Das deutende Ich oder Interpretationsgemeinschaften wie Religionen, Parteien, andere soziale Gruppen müssen in der Lage sein, Ambiguität bewältigen zu können.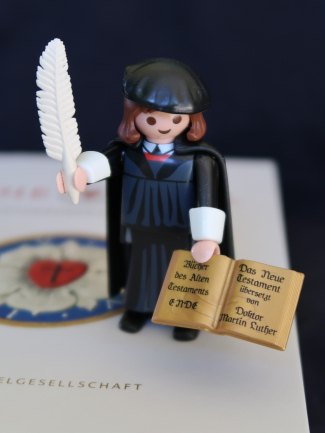 Religion und Kunst erweisen in diesem Sinn als nützlich für die Gesellschaft, um Ambiguität zu verarbeiten. Dieses scheitert jedoch spätestens dann, wenn – in der Religion wie in der Kunst – Ambiguität in Banalität umschlägt. „Ambiguitätsreduktion“ ersetzt die alte Kontingenzbewältigung als Begriff, mit dem Neokonservative und Systemtheoretiker die Rolle von Religion in der Gesellschaft profiliert hatten. Religion beschäftigt sich danach mit dem, was Menschen in ihrer Wirklichkeit nicht begreifen, Krankheit, Sterben, Tod, Katastrophen, sinnloses Leid, Krisen welcher Art auch immer. Sie hilft, Leiden und Böses zu ertragen und auszuhalten, wenn es nicht beseitigt werden kann. Es gilt einen Weg zu finden zwischen Engagement und Ertragen. Wer nur erträgt, wird zum Fatalisten. Wer sich nur engagiert, wird zum politischen Theologen, der den Glauben verfremdet.
Religion und Kunst erweisen in diesem Sinn als nützlich für die Gesellschaft, um Ambiguität zu verarbeiten. Dieses scheitert jedoch spätestens dann, wenn – in der Religion wie in der Kunst – Ambiguität in Banalität umschlägt. „Ambiguitätsreduktion“ ersetzt die alte Kontingenzbewältigung als Begriff, mit dem Neokonservative und Systemtheoretiker die Rolle von Religion in der Gesellschaft profiliert hatten. Religion beschäftigt sich danach mit dem, was Menschen in ihrer Wirklichkeit nicht begreifen, Krankheit, Sterben, Tod, Katastrophen, sinnloses Leid, Krisen welcher Art auch immer. Sie hilft, Leiden und Böses zu ertragen und auszuhalten, wenn es nicht beseitigt werden kann. Es gilt einen Weg zu finden zwischen Engagement und Ertragen. Wer nur erträgt, wird zum Fatalisten. Wer sich nur engagiert, wird zum politischen Theologen, der den Glauben verfremdet. Demokratie ist für Bauer gekennzeichnet durch die Vorläufigkeit und Revidierbarkeit von Entscheidungen: „Demokratisch getroffene Entscheidungen beanspruchen nicht, die alleinige Wahrheit, sondern lediglich die wahrscheinlich bessere Lösung zu sein, und dies auch nicht in alle Ewigkeit, sondern nur so lange, bis eine andere Entscheidung getroffen wird (…).“ (84) Das ist der Schlüsselsatz von Bauers langem Essay. Er propagiert ein Verständnis der revidierbaren Wahrheit, das geeignet ist, der Komplexität und Mehrdeutigkeit von Wirklichkeit zu begegnen. Dem Verstehen sind Grenzen gesetzt. Und damit trifft Bauer einen wunden Punkt von Aufklärung, Rationalismus und demokratischer Debattenkultur. Meinungen und Erklärungen, die oft nur auf Vermutungen aufruhen, sind schnell per Pressemeldung an die Öffentlichkeit gebracht. In der eindeutig gedeuteten Wirklichkeit lebt es sich vermeintlich einfacher als in der unübersichtlichen Welt der Mehrdeutigkeit. Der Wunsch nach einfachen Lösungen wird gespeist aus der Wut und Verzweiflung darüber, in der überkomplexen Welt nichts oder nur kaum etwas ausrichten zu können.
Demokratie ist für Bauer gekennzeichnet durch die Vorläufigkeit und Revidierbarkeit von Entscheidungen: „Demokratisch getroffene Entscheidungen beanspruchen nicht, die alleinige Wahrheit, sondern lediglich die wahrscheinlich bessere Lösung zu sein, und dies auch nicht in alle Ewigkeit, sondern nur so lange, bis eine andere Entscheidung getroffen wird (…).“ (84) Das ist der Schlüsselsatz von Bauers langem Essay. Er propagiert ein Verständnis der revidierbaren Wahrheit, das geeignet ist, der Komplexität und Mehrdeutigkeit von Wirklichkeit zu begegnen. Dem Verstehen sind Grenzen gesetzt. Und damit trifft Bauer einen wunden Punkt von Aufklärung, Rationalismus und demokratischer Debattenkultur. Meinungen und Erklärungen, die oft nur auf Vermutungen aufruhen, sind schnell per Pressemeldung an die Öffentlichkeit gebracht. In der eindeutig gedeuteten Wirklichkeit lebt es sich vermeintlich einfacher als in der unübersichtlichen Welt der Mehrdeutigkeit. Der Wunsch nach einfachen Lösungen wird gespeist aus der Wut und Verzweiflung darüber, in der überkomplexen Welt nichts oder nur kaum etwas ausrichten zu können.