Notizen anlässlich der neuen Reihe "Jalta"
Andreas Mertin
Freibeuter
 1979 erschien die erste Ausgabe des „Freibeuter. Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik“ im Berliner Wagenbach-Verlag. Ein Heft kostete 9 Deutsche Mark, was sich im Abonnement auf 7,50 DM ermäßigte. Es gab damals schon einige legendäre Zeitschriften für Linke und die sich dafür hielten auf dem Markt: natürlich das Kursbuch, 1965 von Hans Markus Enzensberger zusammen mit Karl Markus Michel gegründet. Das Kursbuch war das zentrale intellektuelle Organ der 68er, das nach 1970 auch vom Wagenbach-Verlag verlegt wurde. 1973 wurde es vom abgespalteten Rotbuch-Verlag weitergeführt. Aber das Kursbuch war tatsächlich etwas für die 68er. Als Jemand, der 1958 geboren wurde, war das Kursbuch – auch wenn es bis heute besteht – schon Geschichte. Man kaufte sich einzelne Ausgaben, aber abonnierte es nicht. Ähnlich ging es mir mit dem 1978 erstmalig erschienenen Konkursbuch, einige Ausgaben kaufte ich, aber es wurde nicht „meine Zeitschrift“. Das war mit dem „Freibeuter“ anders. Vielleicht weil sein Beginn etwa mit dem Beginn meines Studiums zusammenfiel, vielleicht weil viel von dem, was später auch in meiner Biografie eine Rolle spielen sollte, im Freibeuter thematisch wurde, ich weiß nicht mehr genau, warum ich ihn von der ersten Ausgabe an abonniert habe. Diese Ausgabe erschien ohne Vorwort, sondern eröffnete gleich mit dem „Interview mit einem Neandertaler“ aus der Feder von Italo Calvino. Das Heft hatte als Themenschwerpunkt „Auseinandervereinigung. Bitte weitergehen!“ mit Beiträgen von Stephan Hermlin, Alexander Kluge, Carl Amery, Lienhard Wawrzyn und Thomas Schmid. Daneben gab es einen Blick zurück nach vorn, Texte und Zeichen und einen Spielplatz. Es war, mit anderen Worten, ein intellektueller Genuss.
1979 erschien die erste Ausgabe des „Freibeuter. Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik“ im Berliner Wagenbach-Verlag. Ein Heft kostete 9 Deutsche Mark, was sich im Abonnement auf 7,50 DM ermäßigte. Es gab damals schon einige legendäre Zeitschriften für Linke und die sich dafür hielten auf dem Markt: natürlich das Kursbuch, 1965 von Hans Markus Enzensberger zusammen mit Karl Markus Michel gegründet. Das Kursbuch war das zentrale intellektuelle Organ der 68er, das nach 1970 auch vom Wagenbach-Verlag verlegt wurde. 1973 wurde es vom abgespalteten Rotbuch-Verlag weitergeführt. Aber das Kursbuch war tatsächlich etwas für die 68er. Als Jemand, der 1958 geboren wurde, war das Kursbuch – auch wenn es bis heute besteht – schon Geschichte. Man kaufte sich einzelne Ausgaben, aber abonnierte es nicht. Ähnlich ging es mir mit dem 1978 erstmalig erschienenen Konkursbuch, einige Ausgaben kaufte ich, aber es wurde nicht „meine Zeitschrift“. Das war mit dem „Freibeuter“ anders. Vielleicht weil sein Beginn etwa mit dem Beginn meines Studiums zusammenfiel, vielleicht weil viel von dem, was später auch in meiner Biografie eine Rolle spielen sollte, im Freibeuter thematisch wurde, ich weiß nicht mehr genau, warum ich ihn von der ersten Ausgabe an abonniert habe. Diese Ausgabe erschien ohne Vorwort, sondern eröffnete gleich mit dem „Interview mit einem Neandertaler“ aus der Feder von Italo Calvino. Das Heft hatte als Themenschwerpunkt „Auseinandervereinigung. Bitte weitergehen!“ mit Beiträgen von Stephan Hermlin, Alexander Kluge, Carl Amery, Lienhard Wawrzyn und Thomas Schmid. Daneben gab es einen Blick zurück nach vorn, Texte und Zeichen und einen Spielplatz. Es war, mit anderen Worten, ein intellektueller Genuss.
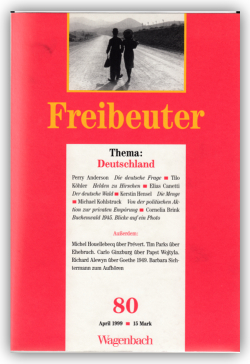 80 Ausgaben lang freute man sich auf das nächste Heft, eines interessanter als das andere. Dann, 1999 erreichte einen das Schreiben von Klaus Wagenbach, dass nun Schluss sei mit dem Freibeuter. „Bedenke, daß die Jahre vergehen, und achte darauf, nicht immerfort das gleiche zu tun“ zitierte er einleitend Francis Bacon. Den Schmerz linderte das nicht. Gut, es gab weiter den Verlag Klaus Wagenbach mit seinen wunderbaren Büchern, aber dieses Gefühl, das einen nach 2½ Monaten jeweils beschlich, nun komme demnächst die neueste Ausgabe des Freibeuters, dieses Gefühl war vorbei. Und es gab keinen wirklichen Ersatz für den Freibeuter. Lettre international, die Zeitschrift, die Wagenbach einem im Abschiedsschreiben ans Herz legte, war doch etwas ganz anderes und hatte das falsche Format. Die 22x15,5 cm des Freibeuters hatten so schön ins Regal gepasst und Rücken für Rücken eine Farbspur gebildet – anfangs noch dezent, am Ende kräftig und Aufmerksamkeit erheischend. Bis heute hole ich gelegentlich Hefte des Freibeuters aus dem Regal, habe viele seiner Texte im Kopf präsent und weiß, in welcher Nummer sie erschienen sind.
80 Ausgaben lang freute man sich auf das nächste Heft, eines interessanter als das andere. Dann, 1999 erreichte einen das Schreiben von Klaus Wagenbach, dass nun Schluss sei mit dem Freibeuter. „Bedenke, daß die Jahre vergehen, und achte darauf, nicht immerfort das gleiche zu tun“ zitierte er einleitend Francis Bacon. Den Schmerz linderte das nicht. Gut, es gab weiter den Verlag Klaus Wagenbach mit seinen wunderbaren Büchern, aber dieses Gefühl, das einen nach 2½ Monaten jeweils beschlich, nun komme demnächst die neueste Ausgabe des Freibeuters, dieses Gefühl war vorbei. Und es gab keinen wirklichen Ersatz für den Freibeuter. Lettre international, die Zeitschrift, die Wagenbach einem im Abschiedsschreiben ans Herz legte, war doch etwas ganz anderes und hatte das falsche Format. Die 22x15,5 cm des Freibeuters hatten so schön ins Regal gepasst und Rücken für Rücken eine Farbspur gebildet – anfangs noch dezent, am Ende kräftig und Aufmerksamkeit erheischend. Bis heute hole ich gelegentlich Hefte des Freibeuters aus dem Regal, habe viele seiner Texte im Kopf präsent und weiß, in welcher Nummer sie erschienen sind.
Einwürfe
Im Bereich der protestantischen Theologie gab es auch einmal einen Ansatz zu einem vergleichbar ambitionierten Projekt, freilich weniger hochkulturell angelegt und viel stärker binnentheologisch ausgerichtet, aber doch sehr erhellend und zeitbezogen: das war die Buch-Reihe Einwürfe, die zwischen 1983 und 1990 zumindest sechs Ausgaben (also gerade mal eine pro Jahr) hervorbrachte, dann aber eingestellt wurde.

Jalta
Fast 20 Jahre lang musste ich warten, bis wieder eine – nun ganz anders geartete – Zeitschrift erschien, die bei mir ähnliche Reaktionen auslöste wie seinerzeit der Freibeuter im Wagenbach-Verlag. Und dieses Mal dauerte es über ein Jahr, bis ich überhaupt auf die Zeitschrift aufmerksam wurde. Eine kritische Stellungnahme der Redaktion zur Gründung einer Vereinigung „Juden in der AfD“ lenkte mein Interesse auf das Projekt. Die Zeitschrift heißt „Jalta. Positionen zur jüdischen Gegenwart“ und erscheint seit 2017 im Berliner Neofelis-Verlag. Sie kommt zwei Mal im Jahr zum Preis von je 16€ als Print und kann im Abonnement zum Preis von 28€ bezogen werden [Mehr dazu hier]. Das Format ist mit 19x26 cm wieder sehr schön bücherschrankfreundlich. Vier thematische Ausgaben sind bisher erschienen.

Was mich an diesem Zeitschriften-Projekt fasziniert und begeistert, ist zunächst einmal die Erkenntnis, dass es überhaupt dieses junge, queere, links-intellektuelle, jüdische Milieu in Deutschland gibt. Da ich nicht in Berlin lebe (sondern in einer Großstadt mit gerade einmal 276 jüdischen Gemeindegliedern) hatte ich das so nicht wahrgenommen. Ich wünschte mir, auch im Bereich meiner eigenen Religion, dem Protestantismus, gäbe es ein analoges, kulturelles, intellektuelles, zeit-bezogenes Milieu (und wenn es in Berlin oder Hamburg lebte). Mit Autoren, die sich – ohne mit der Wimper zu zucken – für aktuelle Auseinandersetzungen auf alte religiöse Texte beziehen, die den Talmud diskutieren, um queere Fragen der Gegenwart zu erörtern oder auch Biographien vorstellen, die Geschichte erfahrbar werden lassen. Lange Zeit hatte ich gedacht, so etwas gäbe es in der post-modernen Gesellschaft der Gegenwart überhaupt nicht mehr. Nun muss ich feststellen, das es so etwas nur in meiner eigenen Religion und Konfession nicht mehr gibt.
Aber das ist nur ein kleiner Wermutstropfen, der verschmerzbar ist angesichts der vielfältigen Inspirationen, die einem ein Projekt wie JALTA bei der Lektüre vermittelt. Schon der erste Blick in ein Heft zeigt einem, dass hier – wie schon beim Freibeuter – nicht nur einfach Texte versammelt sind, sondern Bilder, Kunstwerke, Projektbeschreibungen und zeitgenössische Lyrik mit theoretischen Reflektionen verbunden werden. Es ist kein Projekt, das auf Einverständnis zielt, eher auf Auseinander-Setzung und Streitbares. Das macht es so erfrischend.
 Frühjahr 2017 erschien der erste Band der Zeitschrift unter dem thematischen Titel „Selbst-Ermächtigung“. Der Band teilt sich in folgende sechs Abschnitte:
Frühjahr 2017 erschien der erste Band der Zeitschrift unter dem thematischen Titel „Selbst-Ermächtigung“. Der Band teilt sich in folgende sechs Abschnitte:
1 – א (Nach) Jalta (S. 14-49)
erzählt uns zunächst, woher sich der Titel der Zeitschrift herleitet. Nein nicht von der politischen Konferenz nach 1945, sondern von einer zornigen Babylonierin aus dem Talmud, genauer: vom Ende des siebten Kapitels im Traktat Berachot des Babylonischen Talmuds. Ich kannte die Geschichte von Jalta nicht, werde sie auch hier nicht verraten, sondern empfehle jedem, selbst im Talmud oder in Jalta nachzuschlagen. Aber es ist eine starke Geschichte, die zu erfahren sich lohnt. Weitere Beiträge in diesem ersten Abschnitt stellen den lesbisch-feministischen Schabbeskreis vor, oder die liberale Rabbinerin Elisa Klapheck.
2 – ב Selbstermächtigung (S. 52-123)
geht als titelgebender Hauptteil des Heftes dem Empowerment nach: was ist das und wie äußert es sich zum Beispiel mit und zwischen schwarzen und jüdischen Menschen? Berührend der Text „Ach, was für ein schöner Zopf“ vom Evgenia Gostrer mit Fotos und Zeichnungen. Einen zwingenden Text – das habe ich an anderer Stelle in diesem Magazin schon geschrieben – zur Lektüre für alle Integrationisten in Deutschland ist „Desintegration – Ein Manifest“ von Max Czollek (S. 121-123).
3 - ג Juden* und … (S. 126-135)
behandelt, wie die Redaktion im Vorwort schreibt, „Themen, mit denen Juden* - gewollt oder ungewollt – wiederholt in Zusammenhang gebracht werden.“ Das ist überaus kritisch und grenzgängerisch: von Hunden bis zur AfD.
4 – ד Vergessen, übersehen, verdrängt (135-142)
erinnert u.a. an den jüdischen Fernseh-Quizmaster Fritz Benscher, an die Rainbow Chawurah und die Stolpersteinverlegung in der ostdeutschen Provinz.
5 – ה Streitbares (143-163)
fragt unter anderem nach der aktuellen Debatte um Heidegger und den Antisemitismus, und stellt die Bewegung Women of the wall vor.
6 – ו Über die Redaktion (165-169)
ist nicht nur über die Redaktion, sondern auch von der Redaktion und beinhaltet kurze Positionierungen, etwa Micha Brumliks Skizze der Entwicklung vom seinerzeitigen Projekt Babylon zum aktuellen Projekt Jalta.
 Im Herbst 2017 erschien der zweite Band der Zeitschrift und er trug den Titel „Des-Integration“, also ein Thema, das mit dem Manifest von Max Czollek schon in Heft 1 angeklungen war. Im Vorwort schreibt die Redaktion:
Im Herbst 2017 erschien der zweite Band der Zeitschrift und er trug den Titel „Des-Integration“, also ein Thema, das mit dem Manifest von Max Czollek schon in Heft 1 angeklungen war. Im Vorwort schreibt die Redaktion:
„Desintegration ist ein Begriff, der seit dem gleichnamigen Kongress am Maxim Gorki Theater … 2016 im Kontext post-migrantischer Interventionen diskutiert wird. In der Soziologie eine negativ konnotierte Bezeichnung, um Prozesse der Gruppenauflösung zu markieren, ist Desintegration in seiner gegenwärtigen künstlerischen wie politischen Aneignung eine Kritik am Status quo der Integration, an Konzepten ‚deutscher Leitkultur' und der Vorstellung, die ideologische und kulturelle Einheit wäre bedeutsamer als ihre innere Vielfalt. Dass eine solche Intervention nötig ist und bleibt, hat die in den vergangenen Monaten wieder aufgelebte Debatte um Leitkultur zu Genüge demonstriert. Unter Rückgriff auf essentialistische Vorstellungen vom ‚Deutschtum' produzieren diese Debatten Ausschlüsse, indem sie vor allem benennen, was ,Deutschsein' nicht beinhalten sollte. Dem steht die Vorstellung einer Gesellschaft der Vielen entgegen, die radikale Unterschiedlichkeit bzw. Radical Diversity der Menschen zur Grundlage des Zusammenlebens erklärt."
Das ist eine überaus wichtige und alle betreffende Debatte. Zumal angesichts der Eilfertigkeit, mit der auch Kirchen- und Kultur-Funktionäre besinnungslos „Kulturelle Integration“ fordern. Ich glaube aber, dass die Fronten etwas anders verlaufen, als es der Redaktion von Jalta vorschwebt. So eindeutig vermag ich die integrationswütige ‚Dominanzgesellschaft‘ von den Pluralität verkörpernden Minderheitsgruppen nicht zu trennen. Ich erinnere mich an einige Debatten im Rahmen der angeblichen Flüchtlingskrise, die ich mit den türkisch-stämmigen deutschen Bewohnern unseres Stadtviertels führte, in denen diese überaus energisch eine umstandslose Integration der Neuankömmlinge aus Syrien forderten und Vielfalt nicht zulassen wollten – jedenfalls nicht die der Flüchtlinge. Aber vielleicht gerade deshalb muss die Debatte geführt werden. Der überaus kritische Ton gegenüber der Dominanzgesellschaft hat mich eingestandenermaßen überrascht. Als so problematisch hätte ich die Diskussionen nicht eingeschätzt, aber ich gehöre ja zu dem, was die Autoren, die Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft nennen. Wie aber werden Minderheiten hier bestimmt? Wenn man etwa ein Reformierter (also ein ‚Calvinist‘) in Deutschland ist, gehört man dann zu einer Minderheit – weil es nur sehr wenige Reformierte in Deutschland gibt? Oder gehört man zu Mehrheit – weil auch die Reformierten zur EKD und damit zu einer der großen Institutionen in Deutschland gehören? Man sieht, was ein einzelnes Heft dieser Zeitschrift alles an Fragen und In-Fragestellungen auslösen kann. Das ist sicher ein großer Gewinn.
 Der dritte Band, Frühjahr 2018 erschienen, trägt den Titel „Allianzen“. Auch wenn es der Redaktion, wie sie schreibt, um jüdisch-muslimische, jüdisch-queere, jüdisch-feministische, jüdisch-x Allianzen geht, so beschleicht einen doch ein gewisses Unbehagen bei diesem konkreten Wort. Zunächst einmal ist es ein polit-strategischer Begriff für ein Bündnis zwischen Staaten, dann auch eine Gemeinschaft im allgemeineren Sinne. Im allgemeinen Sprachgebrauch triumphiert heute eher der kapitalistische Gebrauch: strategisch – weltumspannend – global. Ich frage mich, ob es nicht einen präziseren Begriff für das Intendierte gegeben hätte. Jedenfalls empfinde ich ihn nicht als „kühne Metapher“, zu sehr ist in seinem Gebrauch bereits der Kampf mit inkludiert. Die Fragestellung des Heftes lautet: Welche Rolle können Juden* für politische Solidarisierungen und Allianzen spielen?
Der dritte Band, Frühjahr 2018 erschienen, trägt den Titel „Allianzen“. Auch wenn es der Redaktion, wie sie schreibt, um jüdisch-muslimische, jüdisch-queere, jüdisch-feministische, jüdisch-x Allianzen geht, so beschleicht einen doch ein gewisses Unbehagen bei diesem konkreten Wort. Zunächst einmal ist es ein polit-strategischer Begriff für ein Bündnis zwischen Staaten, dann auch eine Gemeinschaft im allgemeineren Sinne. Im allgemeinen Sprachgebrauch triumphiert heute eher der kapitalistische Gebrauch: strategisch – weltumspannend – global. Ich frage mich, ob es nicht einen präziseren Begriff für das Intendierte gegeben hätte. Jedenfalls empfinde ich ihn nicht als „kühne Metapher“, zu sehr ist in seinem Gebrauch bereits der Kampf mit inkludiert. Die Fragestellung des Heftes lautet: Welche Rolle können Juden* für politische Solidarisierungen und Allianzen spielen?
Unabhängig davon gibt es im ersten Teil (Nach) Jalta wieder mehrere höchst interessante Beiträge, etwa ein Interview mit Mirjam Wenzel, der Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Und ein Text von Rebecca Blady über weibliche Geistliche im orthodoxen Judentum. Mir persönlich völlig unvertraut war die Frage der „Vaterjuden“, die Sarah Wohl in ihrem Beitrag erläutert.
Im Hauptteil geht es dann u.a. darum, wer im jüdisch-müslimischen Gespräch für wen und mit wem redet (so Yasemin Shomann, S. 42-49). Und wie sich in der Fremde zwischen Muslimen und Juden ein neues Gefühl des Nahen Ostens bildet (so Lianne Merkus über Nahostalgie, S. 59-66). Ungemein bereichernd fand ich die „Allianzen einer Berlinerin“ von Jalda Rebling mit dem Untertitel „Mein Bund mit Berlin – ein Abschied (S. 88-94).
Höchst spannend fand ich unter „Vergessen, Übersehen, Verdrängt“ einen fotodokumentarischen Beitrag des Künstlerkollektivs Tehnica Schweiz (S. 135-147) über den Auszug griechischer Skulpturen aus der ehemaligen Synagoge von Tata. Die Künstler fragen dazu:
Aus welcher Sicht kann die ehemalige Synagoge heute betrachtet werden? Im jüdischen Religionsgesetz bildet der Minjan die Gemeinschaft und nicht die Synagoge. Dem entsprechend ist die Synagoge Hülle - Raum für den Gottesdienst. Was ist eine Synagoge ohne Minjan? Eine ehemalige Synagoge? Ein Gebäude? Diese Frage drängt sich auf im ehemaligen europäischen Zentrum jüdischen Lebens, Osteuropa. Gerade in der post-sowjetischen Zeit zeigen diese Orte nicht nur ihre ursprüngliche Funktion, sondern gleichermaßen die überlagerten Schichten der auf sie folgenden politischen Systeme.
Das sind Fragen, die etwa auch im Kontext reformierter oder lutherischer Raumdiskussionen auftauchen und deshalb über die Religionsgrenzen hinweg spannend sind.
Und aktuell im Herbst 2018 erschien der vierte Band.  Auch in diesem Heft mit dem Titel Gegenwartsbewältigung gibt es einige höchst interessante Beiträge. Etwa der Verweis auf Susan Taubes, von der ich bis dahin nichts wusste. Lustig fand ich im ersten Teil des Heftes Ruby Kelevs sieben Begegnungen mit ‚Jalta‘ rund um eine Buchhandlung und die Reaktionen der Menschen, die einem beim Erwerb einer Zeitschrift wie ‚Jalta‘ begegnen. Sie erinnern etwas an Erzählungen von Isaac Bashevis Singer. Allerdings scheinen mir die Erlebnisse selbst fast schon zu sehr dem Klischee über die Klischees pflegenden Mitmenschen zu entsprechen, als dass ich sie für echt halten könnte. Ich habe JALTA bisher immer auf längeren Zugreisen im ICE gelesen und da sitzt man über Stunden neben wildfremden Leuten, die ja auch einen Blick auf die Reiselektüre werfen können. Aber angesprochen hat mich noch niemand auf Jalta – vielleicht ist das „Positionen zur jüdischen Gegenwart“ auf dem Umschlag schlicht zu klein gedruckt. Spätestens die hebräischen Buchstaben sollten dann jedoch einen Kontext herstellen. Aber wie gesagt – bisher keine Reaktion. Das mit den Buchhändlern konnte ich nicht überprüfen, weil ich mir das Heft durch den Verlag liefern lasse. Vielleicht ist das dann doch eher Berliner Lokalkolorit.
Auch in diesem Heft mit dem Titel Gegenwartsbewältigung gibt es einige höchst interessante Beiträge. Etwa der Verweis auf Susan Taubes, von der ich bis dahin nichts wusste. Lustig fand ich im ersten Teil des Heftes Ruby Kelevs sieben Begegnungen mit ‚Jalta‘ rund um eine Buchhandlung und die Reaktionen der Menschen, die einem beim Erwerb einer Zeitschrift wie ‚Jalta‘ begegnen. Sie erinnern etwas an Erzählungen von Isaac Bashevis Singer. Allerdings scheinen mir die Erlebnisse selbst fast schon zu sehr dem Klischee über die Klischees pflegenden Mitmenschen zu entsprechen, als dass ich sie für echt halten könnte. Ich habe JALTA bisher immer auf längeren Zugreisen im ICE gelesen und da sitzt man über Stunden neben wildfremden Leuten, die ja auch einen Blick auf die Reiselektüre werfen können. Aber angesprochen hat mich noch niemand auf Jalta – vielleicht ist das „Positionen zur jüdischen Gegenwart“ auf dem Umschlag schlicht zu klein gedruckt. Spätestens die hebräischen Buchstaben sollten dann jedoch einen Kontext herstellen. Aber wie gesagt – bisher keine Reaktion. Das mit den Buchhändlern konnte ich nicht überprüfen, weil ich mir das Heft durch den Verlag liefern lasse. Vielleicht ist das dann doch eher Berliner Lokalkolorit.
Gegenwarts-Bewältigung – das zielt natürlich auf die vorgebliche Vergangenheitsbewältigung der Mehrheitsgesellschaft. Und der Umgang mit dem Nationalsozialismus steht dabei im Vordergrund. Ich stimme dabei in Vielem nicht mit der Redaktion bzw. den Autoren überein. Manches entspricht nicht meiner Biographie bzw. Lebenserfahrung. Etwa, dass wir als Jugendliche nicht mit den Eltern oder Großeltern über ihre Rolle im Nationalsozialismus gesprochen hätten. Das gehörte in den 70er Jahren zum schmerzlichen Prozess des Erwachsenwerdens. Man las Berichte vom Auschwitzprozess, die Protokolle des Eichmann-Prozesses in Jerusalem, irgendjemand schenkte mir das Buch „Im Feuer vergangen. Tagebücher aus dem Ghetto. Mit einem Vorwort von Arnold Zweig.“ Es mag sein, dass es auch andere Erfahrungen gibt, aber ich kann nur über meine eigenen urteilen. Manche Urteile, die die Autoren fällen, würde ich gerne expliziert sehen. Ich würde etwa das Beckstein-Zitat („Was wichtig ist, ist die Achtung vor weltlichen Gerichten und die richtige Einordnung der deutschen Geschichte. Es geht nicht, daß Einbürgerungswillige zwar Stalin für einen Verbrecher halten, aber über Hitlers Taten hinwegsehen“) ganz anders bewerten, als es Astrid Messerschmidt in ihrem Beitrag (unter Rückgriff auf einen alten Text von 2008) tut. Man könnte es schlicht mit: „Ich möchte ungerne Graue Wölfe einbürgern“ übersetzen. Aber gerade diese Differenzen machen JALTA so interessant. Auch innerhalb der Redaktion und Herausgeberschaft werden sie kenntlich, wenn etwa Micha Brumlik über „Vom Zionismus zur großen Gereiztheit“ spricht.
Ich weiß nicht, ob Jalta auf die 80 Ausgaben des Freibeuters kommen wird, denn dann müsste das Projekt ja mindestens 40 Jahre halten. Aber eine wenigstens 20jährige Laufzeit wäre schon zu wünschen.

 1979 erschien die erste Ausgabe des „Freibeuter. Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik“ im Berliner Wagenbach-Verlag. Ein Heft kostete 9 Deutsche Mark, was sich im Abonnement auf 7,50 DM ermäßigte. Es gab damals schon einige legendäre Zeitschriften für Linke und die sich dafür hielten auf dem Markt: natürlich das Kursbuch, 1965 von Hans Markus Enzensberger zusammen mit Karl Markus Michel gegründet. Das Kursbuch war das zentrale intellektuelle Organ der 68er, das nach 1970 auch vom Wagenbach-Verlag verlegt wurde. 1973 wurde es vom abgespalteten Rotbuch-Verlag weitergeführt. Aber das Kursbuch war tatsächlich etwas für die 68er. Als Jemand, der 1958 geboren wurde, war das Kursbuch – auch wenn es bis heute besteht – schon Geschichte. Man kaufte sich einzelne Ausgaben, aber abonnierte es nicht. Ähnlich ging es mir mit dem 1978 erstmalig erschienenen Konkursbuch, einige Ausgaben kaufte ich, aber es wurde nicht „meine Zeitschrift“. Das war mit dem „Freibeuter“ anders. Vielleicht weil sein Beginn etwa mit dem Beginn meines Studiums zusammenfiel, vielleicht weil viel von dem, was später auch in meiner Biografie eine Rolle spielen sollte, im Freibeuter thematisch wurde, ich weiß nicht mehr genau, warum ich ihn von der ersten Ausgabe an abonniert habe. Diese Ausgabe erschien ohne Vorwort, sondern eröffnete gleich mit dem „Interview mit einem Neandertaler“ aus der Feder von Italo Calvino. Das Heft hatte als Themenschwerpunkt „Auseinandervereinigung. Bitte weitergehen!“ mit Beiträgen von Stephan Hermlin, Alexander Kluge, Carl Amery, Lienhard Wawrzyn und Thomas Schmid. Daneben gab es einen Blick zurück nach vorn, Texte und Zeichen und einen Spielplatz. Es war, mit anderen Worten, ein intellektueller Genuss.
1979 erschien die erste Ausgabe des „Freibeuter. Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Politik“ im Berliner Wagenbach-Verlag. Ein Heft kostete 9 Deutsche Mark, was sich im Abonnement auf 7,50 DM ermäßigte. Es gab damals schon einige legendäre Zeitschriften für Linke und die sich dafür hielten auf dem Markt: natürlich das Kursbuch, 1965 von Hans Markus Enzensberger zusammen mit Karl Markus Michel gegründet. Das Kursbuch war das zentrale intellektuelle Organ der 68er, das nach 1970 auch vom Wagenbach-Verlag verlegt wurde. 1973 wurde es vom abgespalteten Rotbuch-Verlag weitergeführt. Aber das Kursbuch war tatsächlich etwas für die 68er. Als Jemand, der 1958 geboren wurde, war das Kursbuch – auch wenn es bis heute besteht – schon Geschichte. Man kaufte sich einzelne Ausgaben, aber abonnierte es nicht. Ähnlich ging es mir mit dem 1978 erstmalig erschienenen Konkursbuch, einige Ausgaben kaufte ich, aber es wurde nicht „meine Zeitschrift“. Das war mit dem „Freibeuter“ anders. Vielleicht weil sein Beginn etwa mit dem Beginn meines Studiums zusammenfiel, vielleicht weil viel von dem, was später auch in meiner Biografie eine Rolle spielen sollte, im Freibeuter thematisch wurde, ich weiß nicht mehr genau, warum ich ihn von der ersten Ausgabe an abonniert habe. Diese Ausgabe erschien ohne Vorwort, sondern eröffnete gleich mit dem „Interview mit einem Neandertaler“ aus der Feder von Italo Calvino. Das Heft hatte als Themenschwerpunkt „Auseinandervereinigung. Bitte weitergehen!“ mit Beiträgen von Stephan Hermlin, Alexander Kluge, Carl Amery, Lienhard Wawrzyn und Thomas Schmid. Daneben gab es einen Blick zurück nach vorn, Texte und Zeichen und einen Spielplatz. Es war, mit anderen Worten, ein intellektueller Genuss.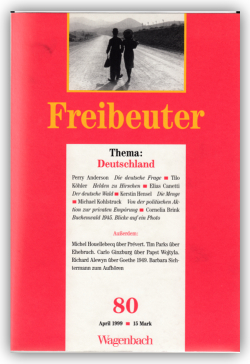 80 Ausgaben lang freute man sich auf das nächste Heft, eines interessanter als das andere. Dann, 1999 erreichte einen das Schreiben von Klaus Wagenbach, dass nun Schluss sei mit dem Freibeuter. „Bedenke, daß die Jahre vergehen, und achte darauf, nicht immerfort das gleiche zu tun“ zitierte er einleitend Francis Bacon. Den Schmerz linderte das nicht. Gut, es gab weiter den Verlag Klaus Wagenbach mit seinen wunderbaren Büchern, aber dieses Gefühl, das einen nach 2½ Monaten jeweils beschlich, nun komme demnächst die neueste Ausgabe des Freibeuters, dieses Gefühl war vorbei. Und es gab keinen wirklichen Ersatz für den Freibeuter. Lettre international, die Zeitschrift, die Wagenbach einem im Abschiedsschreiben ans Herz legte, war doch etwas ganz anderes und hatte das falsche Format. Die 22x15,5 cm des Freibeuters hatten so schön ins Regal gepasst und Rücken für Rücken eine Farbspur gebildet – anfangs noch dezent, am Ende kräftig und Aufmerksamkeit erheischend. Bis heute hole ich gelegentlich Hefte des Freibeuters aus dem Regal, habe viele seiner Texte im Kopf präsent und weiß, in welcher Nummer sie erschienen sind.
80 Ausgaben lang freute man sich auf das nächste Heft, eines interessanter als das andere. Dann, 1999 erreichte einen das Schreiben von Klaus Wagenbach, dass nun Schluss sei mit dem Freibeuter. „Bedenke, daß die Jahre vergehen, und achte darauf, nicht immerfort das gleiche zu tun“ zitierte er einleitend Francis Bacon. Den Schmerz linderte das nicht. Gut, es gab weiter den Verlag Klaus Wagenbach mit seinen wunderbaren Büchern, aber dieses Gefühl, das einen nach 2½ Monaten jeweils beschlich, nun komme demnächst die neueste Ausgabe des Freibeuters, dieses Gefühl war vorbei. Und es gab keinen wirklichen Ersatz für den Freibeuter. Lettre international, die Zeitschrift, die Wagenbach einem im Abschiedsschreiben ans Herz legte, war doch etwas ganz anderes und hatte das falsche Format. Die 22x15,5 cm des Freibeuters hatten so schön ins Regal gepasst und Rücken für Rücken eine Farbspur gebildet – anfangs noch dezent, am Ende kräftig und Aufmerksamkeit erheischend. Bis heute hole ich gelegentlich Hefte des Freibeuters aus dem Regal, habe viele seiner Texte im Kopf präsent und weiß, in welcher Nummer sie erschienen sind.

 Frühjahr 2017 erschien der erste Band der Zeitschrift unter dem thematischen Titel „Selbst-Ermächtigung“. Der Band teilt sich in folgende sechs Abschnitte:
Frühjahr 2017 erschien der erste Band der Zeitschrift unter dem thematischen Titel „Selbst-Ermächtigung“. Der Band teilt sich in folgende sechs Abschnitte: Im Herbst 2017 erschien der zweite Band der Zeitschrift und er trug den Titel „Des-Integration“, also ein Thema, das mit dem Manifest von Max Czollek schon in Heft 1 angeklungen war. Im Vorwort schreibt die Redaktion:
Im Herbst 2017 erschien der zweite Band der Zeitschrift und er trug den Titel „Des-Integration“, also ein Thema, das mit dem Manifest von Max Czollek schon in Heft 1 angeklungen war. Im Vorwort schreibt die Redaktion: Der dritte Band, Frühjahr 2018 erschienen, trägt den Titel „Allianzen“. Auch wenn es der Redaktion, wie sie schreibt, um jüdisch-muslimische, jüdisch-queere, jüdisch-feministische, jüdisch-x Allianzen geht, so beschleicht einen doch ein gewisses Unbehagen bei diesem konkreten Wort. Zunächst einmal ist es ein polit-strategischer Begriff für ein Bündnis zwischen Staaten, dann auch eine Gemeinschaft im allgemeineren Sinne. Im allgemeinen Sprachgebrauch triumphiert heute eher der kapitalistische Gebrauch: strategisch – weltumspannend – global. Ich frage mich, ob es nicht einen präziseren Begriff für das Intendierte gegeben hätte. Jedenfalls empfinde ich ihn nicht als „kühne Metapher“, zu sehr ist in seinem Gebrauch bereits der Kampf mit inkludiert. Die Fragestellung des Heftes lautet: Welche Rolle können Juden* für politische Solidarisierungen und Allianzen spielen?
Der dritte Band, Frühjahr 2018 erschienen, trägt den Titel „Allianzen“. Auch wenn es der Redaktion, wie sie schreibt, um jüdisch-muslimische, jüdisch-queere, jüdisch-feministische, jüdisch-x Allianzen geht, so beschleicht einen doch ein gewisses Unbehagen bei diesem konkreten Wort. Zunächst einmal ist es ein polit-strategischer Begriff für ein Bündnis zwischen Staaten, dann auch eine Gemeinschaft im allgemeineren Sinne. Im allgemeinen Sprachgebrauch triumphiert heute eher der kapitalistische Gebrauch: strategisch – weltumspannend – global. Ich frage mich, ob es nicht einen präziseren Begriff für das Intendierte gegeben hätte. Jedenfalls empfinde ich ihn nicht als „kühne Metapher“, zu sehr ist in seinem Gebrauch bereits der Kampf mit inkludiert. Die Fragestellung des Heftes lautet: Welche Rolle können Juden* für politische Solidarisierungen und Allianzen spielen? Auch in diesem Heft mit dem Titel Gegenwartsbewältigung gibt es einige höchst interessante Beiträge. Etwa der Verweis auf Susan Taubes, von der ich bis dahin nichts wusste. Lustig fand ich im ersten Teil des Heftes Ruby Kelevs sieben Begegnungen mit ‚Jalta‘ rund um eine Buchhandlung und die Reaktionen der Menschen, die einem beim Erwerb einer Zeitschrift wie ‚Jalta‘ begegnen. Sie erinnern etwas an Erzählungen von Isaac Bashevis Singer. Allerdings scheinen mir die Erlebnisse selbst fast schon zu sehr dem Klischee über die Klischees pflegenden Mitmenschen zu entsprechen, als dass ich sie für echt halten könnte. Ich habe JALTA bisher immer auf längeren Zugreisen im ICE gelesen und da sitzt man über Stunden neben wildfremden Leuten, die ja auch einen Blick auf die Reiselektüre werfen können. Aber angesprochen hat mich noch niemand auf Jalta – vielleicht ist das „Positionen zur jüdischen Gegenwart“ auf dem Umschlag schlicht zu klein gedruckt. Spätestens die hebräischen Buchstaben sollten dann jedoch einen Kontext herstellen. Aber wie gesagt – bisher keine Reaktion. Das mit den Buchhändlern konnte ich nicht überprüfen, weil ich mir das Heft durch den Verlag liefern lasse. Vielleicht ist das dann doch eher Berliner Lokalkolorit.
Auch in diesem Heft mit dem Titel Gegenwartsbewältigung gibt es einige höchst interessante Beiträge. Etwa der Verweis auf Susan Taubes, von der ich bis dahin nichts wusste. Lustig fand ich im ersten Teil des Heftes Ruby Kelevs sieben Begegnungen mit ‚Jalta‘ rund um eine Buchhandlung und die Reaktionen der Menschen, die einem beim Erwerb einer Zeitschrift wie ‚Jalta‘ begegnen. Sie erinnern etwas an Erzählungen von Isaac Bashevis Singer. Allerdings scheinen mir die Erlebnisse selbst fast schon zu sehr dem Klischee über die Klischees pflegenden Mitmenschen zu entsprechen, als dass ich sie für echt halten könnte. Ich habe JALTA bisher immer auf längeren Zugreisen im ICE gelesen und da sitzt man über Stunden neben wildfremden Leuten, die ja auch einen Blick auf die Reiselektüre werfen können. Aber angesprochen hat mich noch niemand auf Jalta – vielleicht ist das „Positionen zur jüdischen Gegenwart“ auf dem Umschlag schlicht zu klein gedruckt. Spätestens die hebräischen Buchstaben sollten dann jedoch einen Kontext herstellen. Aber wie gesagt – bisher keine Reaktion. Das mit den Buchhändlern konnte ich nicht überprüfen, weil ich mir das Heft durch den Verlag liefern lasse. Vielleicht ist das dann doch eher Berliner Lokalkolorit.