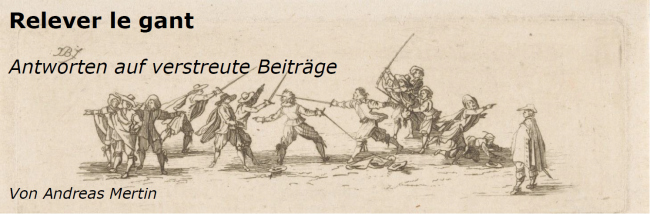
Jeter le gant à qn
... … hatte ich im letzten tà katoptrizómena an die Adresse verschiedener Social-Media-Enthusiasten geschrieben, von denen einige nicht nur Wolfgang Huber grob beleidigt hatten (alter ‚Troll‘), sondern auch meine Anfragen, was denn Digitalisierung für die Kirche überhaupt bedeuten könne und was nicht, vor allem mit Argumenten ad hominem beantworteten.
Zunächst aber für die Leserinnen und Leser, die die Auseinandersetzung nicht verfolgt haben, eine kleine Zusammenfassung. [Alle anderen können gleich zum zweiten Teil ‚Relever le gant‘ springen.] Vor 1½ Jahren kündete tà katoptrizómena an, dass sich das April-Heft 2018 mit dem Thema „Digitalisierung“ insbesondere im Blick auf die Kirche auseinandersetzen würde. Die Texte dazu wurden Ende 2017, Anfang 2018 geschrieben und April 2018 in der Ausgabe 112 publiziert.
Wolfgang Vögele, Pfarrer der badischen Landeskirche, schrieb einen 50 Seiten umfassenden Text, der sich en Detail mit Fragen der Digitalisierung und der Theologie beschäftigte: Auf dem Altar der Algorithmen. Das Heilige, das Schriftliche und das Digitale. Ein Gewebe von Notizen. Thomas Melzl, Pfarrer am Nürnberger Gottesdienstinstitut, hatte einen 20 Seiten umfassenden Text eingereicht, der unter der Überschrift „Das unentdeckte Land“ Anfragen der Digitalisierung an Theologie und Kirche am Beispiel liturgischer Handlungen formulierte. Zwei grundlegende Texte aus der Hand von Theologen. Ich selbst hatte als Kulturwissenschaftler zunächst auf John Perry Barlows „Principles of Adult Behavior“ verwiesen, und dann kursorische Notizen dazu vorgelegt, „was Digitalisierung in der Kirche nicht heißen kann“. Es waren sieben Einzelnotizen, die sich an Meldungen in überregionalen Zeitschriften und in einigen kirchlichen Periodika orientierten und 12 Seiten umfassten. Es war im gesamten Themenheft der kürzeste Text, ein Text, der zudem bewusst aus der Perspektive eines kulturell interessierten Gemeindeglieds in einer Kulturzeitschrift geschrieben war.
Mir ist dieses „Framing“ oder sagen wir dieser Kontext wichtig, damit nicht der Eindruck entsteht, mit dem von mir publizierten Text sollte umfassend zur Digitalisierung in der Kirche Stellung bezogen werden. Das hatten in derselben Ausgabe bereits zwei Theologen getan. Mein Fokus lag woanders, er war vor allem kulturell ausgerichtet.
Deshalb fand sich in der ersten Notiz der Rekurs auf „The Culture of Persuasion“, die Kultur der Überzeugung in der Zeit der Reformation als Reaktion auf Behauptungen, Luther würde heute Twitter und Facebook nutzen, um die Kirche voranzubringen. Wolfgang Huber hat zu Recht im Gespräch mit evangelisch.de auf die konstitutive Ambivalenz der Medien hingewiesen:
Kommunikationsmittel sind Instrumente für eine Reform der Kirche, nicht deren Inhalt. Und die Nutzung dieser Kommunikationsmittel ist zwiespältig. In der Zeit der Reformation konnte die Buchdruckerkunst auch für Ablassbriefe und Schmähschriften verwendet werden, nicht nur für die 95 Thesen oder die Bibelübersetzung.
Der rhetorische Charme, mit dem etwa Jochen Hörisch noch auf die kongeniale Nutzung des römischen Postsystems durch Paulus verweisen konnte [Hörisch, Jochen (2001): Der Sinn und die Sinne. Eine Geschichte der Medien. Frankfurt am Main], ist eben auch für dessen Verfolger in Anschlag zu bringen. Medien unterliegen immer dieser Dialektik – die gescheiterte grüne Revolution im Irak hat dies tragisch zum Ausdruck gebracht. Meine erste Notiz zielte also darauf, den Mediengebrauch der Reformation als Argument nicht überzustrapazieren, denn auch ihre Gegner nutzen die neuesten Medien.
Meine zweite Notiz setzte sich mit einem Buch auseinander, das im Titel eine „Digitale Theologie“ ankündigte. Es war zwei Jahre zuvor erschienen und umschrieb die jüngste Entwicklung zu den digitalen Medien in meiner Wahrnehmung etwas zu dramatisch, ohne ausreichend Perspektiven anbieten zu können. Meine abschließende Bemerkung in dieser Notiz lautete:
Es ist irgendwie merkwürdig und traurig, dass solide theologische Debatten über Digitalisierung heutzutage a) nicht von Theologinnen und Theologen und b) eher auf einer Plattform wie www.algorithmenethik.de als auf kirchlichen Seiten geführt werden. Und mit theologischen Debattenbeiträgen meine ich solche, die nicht um das "Bürgersein in der digitalen Welt" kreisen, sondern wirklich philosophische-humanistische-theologische Maßstäbe benennen, anhand derer Menschen mit Maschinen respektive mit Algorithmen umgehen sollten.
Das stieß denen übel auf, die meinten, zwischenzeitlich in ihren Publikationen durchaus angemessene „philosophische-humanistische-theologische Maßstäbe“ benannt zu haben. Sie meinten, ich hätte diese erst zur Kenntnis nehmen müssen, bevor ich mich äußere. Dass sie mich dabei auf Texte verpflichten wollten, die zur Zeit der Abfassung meines Textes im Dezember 2017 noch gar nicht erschienen waren, zeigt etwas von der Willkür der Argumente. Es ging mir aber auch gar nicht darum, ob jemand ein Buch zum Thema publiziert hat, sondern darum, welche öffentlichen Debatten dazu geführt wurden und werden. Man kann in irgendeinem Verlag ein Buch zu einem Thema schreiben, aber das heißt eben noch lange nicht, dass es auch zur Kenntnis genommen und diskutiert wird. In der Expertenkommission der Europäischen Union mit 85 Wissenschaftlern zu Fragen der Ethik des Digitalen sitzt kein einziger Theologe, aber mehrere Philosophen. Das hatte ich gemeint. Wenn Theologen sich äußern, spielt es keine Rolle. Und meine Vermutung lautet: weil den Menschen / der Gesellschaft theologische Argumente nicht mehr vertraut sind.
Meine dritte Notiz sollte andeuten, dass die Fragen zur Digitalisierung wesentlich „körpernäher“ ansetzen müssten, als dies bisher geschieht. Wir haben in unserer Gesellschaft immer mehr Cyborgs, immer mehr Menschen, deren Überleben von Computern und Technologien abhängt. Ich gehöre zu diesen Menschen. Hier würde ich mir mehr theologische Stimmen wünschen.
Die vierte, fünfte und sechste Notiz griffen ein Mem auf, das von Seiten kirchlicher Vertreter nun wirklich durch die Medien gejagt wurde: der Segensroboter. Also die Substitution eines Menschen und einer liturgischen Handlung durch eine Maschine. Ich schrieb, dass ich nichts gegen derartige Substitutionen habe, dass eine Religion, die das praktiziert, aber nicht mehr meine Religion wäre. Und dass ich mich frage, warum man nur das religiöse Personal, nicht aber die Gläubigen substituiert. Letzteres wäre doch effizienter. Und ich verwies auf ein historisches Beispiel, das aus dem Florenz der Medici stammte. Schließlich schlug ich vor, wenn schon Substitutionen des religiösen Personals, dann von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Das war natürlich – leicht erkennbar – nur Ironie. Ich hatte ja vorher schon geschrieben, dass ich von Substitutionen nichts halte. Das haben die missverstanden, die mir einen billigen Angriff auf den Ratsvorsitzenden und bayrischen Landesbischof vorwarfen.
Meine letzte Notiz verwies darauf, dass weiter gilt: Das Wort ward Fleisch. Und setzte fort:
Das scheint mir im Kern das zu enthalten, worum es in der Frage der Digitalisierung (nicht nur der pastoraltheologischen Handlungen) geht. Gibt es eine Begegnung mit Gott in der Person Jesu Christi? Dann ist die Frage der räumlichen Gestaltung und des Kontextes sekundär. Gibt es diese personale Begegnung nicht, ist alles hinfällig.
Damit hätte es sein Bewenden haben können, wenn nicht einige Pfarrblätter verschiedener Landeskirchen darum gebeten hätten, diesen Text nachdrucken zu dürfen. Warum sie dies taten, obwohl mein Text angeblich schwer verständlich sei, wie evangelisch.de behauptet, muss evangelisch.de bei den fünf Pfarrerblättern nachfragen. Schwer verständlich waren die Notizen sicher nicht – zumindest nicht für Leser des Magazins für Theologie und Ästhetik, die an Hypotaxe statt Parataxe gewohnt sind. Durch den Nachdruck ging natürlich das Framing verloren und für manchen, der den Ursprungsort nicht kannte oder nicht kennen wollte, musste es so erscheinen, als ob mein Text als umfassende theologische Stellungnahme gedacht gewesen sei. Dabei waren es nur ein paar Notizen, die ich mir im Rahmen der Vorbereitung des Heftes gemacht hatte. Deshalb auch der Exkurs zur Frage nach religiösen Robotern in Science-Fiction, der einem Kulturmagazin durchaus gut ansteht, in der theologischen Debatte aber vielleicht befremdlich wirkt.
Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass nun plötzlich ad personam argumentiert wurde und nicht mehr zur Sache. Das empfand ich gerade im kirchlichen Kontext als verstörend. Wer auf meine kursorischen Notizen nur so antworten kann, dass er schreibt, den Mertin muss man nicht ernst nehmen, der hat keine Ahnung, der führt eine Dauerfehde mit der EKD, der schreibt Fortsetzungs-Romane usw., argumentiert erkennbar ad hominem:
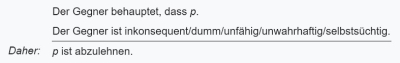
Einmal unterstellt, ich hätte wirklich eine grundsätzlich kritische Haltung gegenüber der EKD (was unzutreffend ist, ich halte nur einige Positionen für fehlbesetzt), dann entkräftet das nicht einmal im Ansatz das kritische Argument. Mit Adorno gesprochen: „Der Splitter in deinem Auge ist das beste Vergrößerungsglas“ (Minima Moralia). Wer also meint, durch den Verweis auf meine permanent kritische Haltung zur EKD die Debatte eröffnen zu müssen, dem geht es darum, durch Diskreditierung des Gegners dessen Argument nicht mehr erörtern zu müssen. Ein alter rhetorischer Trick, aber es bleibt ein Trick. Und er ist allzu leicht durchschaubar.
Deshalb hatte ich im Februar-Heft des Jahres 2019 in zwei Artikeln mit unterschiedlichem Fokus noch einmal das Thema aufgegriffen und meinen Ärger über die Art der Argumentation artikuliert. Hinzu kam das unerträgliche Verhalten einiger Netzaktivisten gegenüber Wolfgang Huber, der sich kritisch auf Twitter zu Twitter geäußert hatte, und den einige deshalb meinten, maßregeln zu müssen. Wolfgang Huber hat sich dazu inzwischen selbst mit deutlichen Worten geäußert. Im Zuge der Polemik gegen Huber kamen Gedanken zum Tragen, von denen ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie sich aus dem Gedankengut evangelischer Theologie herleiten lassen könnten. Die Nichtbeachtung synodaler Strukturen, die Nichtanerkennung theologischer Forschung schien mir inkompatibel mit dem Protestantismus, den ich kenne, den ich vertrete und dem ich vertraue.
Ergänzend hatte ich daran erinnert, dass das Engagement der Evangelischen Kirche in Deutschland in Sachen Digitalisierung bisher nicht als Erfolgsgeschichte gewertet werden kann. Und ich hatte auf zwei Beispiele verwiesen, die in dieser Zeitschrift schon früher Gegenstand einer kritischen Erörterung gewesen waren: zum einen die Suchmaschine Crossbot und zum anderen den unerträglichen Versuch, die Bibel zu twittern. Und ich fragte, ob die neuen Ansätze nicht auch die Fortsetzung der alten Fehler sein könnten.
Ich wollte wissen, wo neben simplen funktionalen und instrumentellen Aspekten die theologischen Gesichtspunkte in der vorangetriebenen Digitalisierung der Kirche liegen. Ich kann in der Kultur, meinem Arbeitsfeld, präzise sagen, wo Digitalisierung ihre unwiderlegbaren Vorteile bietet, weil sie Einsichten verschafft, die bisher nur wenigen zugänglich waren und Kunstwerke hervorbringt, die man so noch nicht gesehen hat. Und ich kann sagen, wo sie ein Gefährdungspotential entwickelt, weil alles gesampelt wird oder weil geistiges Eigentum plötzlich fungibel wird und nur noch den Kapitalströmen unterliegt. Und ich dachte, ähnlich leicht müssten doch auch die, die von den Synoden auf ihre Posten in Sachen Digitalisierung berufen wurden, ihre zentralen theologischen Argumente darlegen können. In diesem Sinne hatte Ralph Charbonnier in der ZEIT schon Gedanken geäußert, die nur weiter vorangetrieben werden müssten.
Relever le gant
Leider hat sich keiner der Herausgeforderten bereitgefunden, im Magazin für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik auf meine Anfragen zu antworten. Das ist ihr gutes Recht. Dieses Mal lag es nicht daran, dass die Betreffenden im Augenblick keine Zeit hatten, sondern daran, dass sie nicht in tà katoptrizómena schreiben wollten. Vermutlich hat mein empörter Tonfall auch das Seinige dazu beigetragen. Aber die polemischen Glossen, die kritischen Nachfragen sind ein Charakteristikum dieser Zeitschrift. Aber letztlich hat fast jeder auf seine Weise Stellung bezogen, das heißt im eigenen Blog. Vielleicht ist diese dezentrale Debattenführung charakteristisch für die Jetzt-Zeit. Aber ich hatte den Debattenteilnehmern ja vorab versprochen, dass ich antworte, wenn sie Beiträge zur Sache liefern. Wohlan. Leichte Überschneidungen sind in meinen Antworten nicht zu vermeiden, weil ich auf jeden einzelnen Beitrag eingehe.
Theonet.de
Ralf Peter Reimann hat auf Theonet eine kurze Replik geschrieben. Ihn hatte ich ja nicht zur Fehde herausgefordert, sondern ganz im Gegenteil, ich hatte auf seinen Artikel aus dem Jahr 2003 als Beispiel der Auseinandersetzung mit kritischen Einwänden im Theomag hingewiesen. Er nennt meine kurzen Notizen im letzten Heft einen „publizistischen Rundumschlag“. Nun, selbst wenn es einer wäre, würde es ja die Argumente nicht entkräften. Die Bezeichnung selbst gehört freilich ins Gebiet der Rhetorik. Erst wird etwas abwertend notiert, bevor man sich mit ihm auseinandersetzt. Man erspart dem Leser das Denken. Kath.net macht das ähnlich, wenn es von „umstrittenen Theologen“ spricht. Man bereitet das Gelände vor.
Nun aber im Einzelnen: Warum ein Bezug auf einen Vorgang des Jahres 2003 „fast schon historisch“ sein soll, erschließt sich mir nicht. Und was meint: „fast schon historisch“? Und was impliziert das: Ist es dann nicht mehr wahr? Wenn wir jedes Ereignis von vor 15 Jahren als „fast schon historisch“ relativieren, kommen wir nicht weit. Auch eine Entscheidung vom November 2018 ist dann „fast schon historisch“, weil sie in der Vergangenheit liegt. Auch Entscheidungen der EKD von 2003 prägen unsere Haltungen und Entscheidungen, sie sind durchaus gegenwärtig, auch wenn manche sie vielleicht gerne verdrängen wollen. Zumindest gehören sie nach der berühmten Unterscheidung von Jan und Aleida Assmann noch nicht zum kulturellen, sondern eher zum kommunikativen Gedächtnis und damit zur Gegenwart. Oder, wenn ich kurz die Einleitung des Wikipedia-Artikels zur Geschichte zitieren darf:
Unter Geschichte versteht man im Allgemeinen diejenigen Aspekte der Vergangenheit, derer Menschen gedenken und die sie deuten, um sich über den Charakter zeitlichen Wandels und dessen Auswirkungen auf die eigene Gegenwart und Zukunft zu orientieren.
Genau darum ging es mir im Rekurs auf die Crossbot-Debatte. Dann schreibt Reimann:
Jedem steht auch frei, das Design und die Ästetik(sic) protestantischer Websites zu kritisieren, so wie es Mertin z.B. in Bezug auf evangelisch.de tut- Aber es ist nur billig und polemisch, ein Satellitenbild mit einem Kirchtum(sic) zu veröffenlichen(sic) und daraus zu folgern, die Kirche vor Ort lasse sich auch so finden, ohne dass es eines Kirchenfinders bedürfe.
Was der erste Satz mit dem Zweiten zu tun hat, verstehe ich nicht. Es sind nicht einmal dieselben Abschnitte, auf die Reimann sich bezieht. Ironischerweise hat evangelisch.de sein Design inzwischen geändert und sieht ganz gewiss darin eine Verbesserung – so wie ich auch. Nun ‚schreit“ der erste Satz nach einem einschränkenden „aber“. Der erfolgt in der Sache jedoch nicht, vielmehr wird das Thema gewechselt und dennoch mit einem „Aber“ verbunden. Die Verknüpfung des ersten Satzes mit dem zweiten Satz durch das „Aber“ insinuiert aber einen Zusammenhang. Den gibt es zumindest in meinem Text nicht. Das „aber“ macht nur Sinn, wenn Reimann meint, im Gegensatz zum ästhetischen Urteil über evangelisch.de stünde es mir nicht frei, ein Satellitenbild zu veröffentlichen, um die Sichtbarkeit der Kirche vor Ort zu demonstrieren. Ich wüsste nicht, welche Autorität mir diese Freiheit einschränken könnte. Genau das steht mir frei. Billig finde dagegen ich es, wenn meine höchst subjektive Beschreibung, wie ich meine Heimatkirche finde, als billig und polemisch bezeichnet wird. Soll ich lügen? Ich hatte anschließend vermutet(!) und nicht geschlossen, dass die Mehrzahl der Menschen weiß, wo die nächste Kirche ist. Eine Schlussfolgerung wäre es gewesen, wenn ich aus der Tatsache, dass ich meine Kirche sehen kann, geschlossen hätte, dass auch alle anderen Menschen das könnten. Das liegt mir fern (es wäre auch eine unsinnige Behauptung). Aber Protestantismus gibt es nicht nur in Metropolen wie Düsseldorf, Berlin oder Hamburg, sondern in jedem Dorf und in jeder Kleinstadt und in jeder mittleren Großstadt wie jener, in der ich lebe. Und dort ist die Welt noch in Ordnung, jedenfalls was die Verortung der Kirche betrifft. Man sieht den Kirchturm vielleicht nicht, aber man weiß, wo er ist.
Und nun kommt eine Volte im Artikel von Reimann, die ich auch bei mehrmaligem Lesen nicht habe nachvollziehen können. Eben noch hatte er den Rekurs auf den Streit um crossbot als überholt und „fast schon historisch“ bezeichnet. Zur Erinnerung: Damals hatte mein Bruder hier im Magazin crossbot als falschen Weg bezeichnet und die EKD aufgefordert, sich auf Plattformen wie Google und Co. zu konzentrieren. Und nun schreibt Reimann dazu:
Jörg Mertin forderte 2003 dagegen, Google stärker in den Blick zu nehmen, anstatt eigene Angebote zu entwicklen (sic). Auch die kirchliche Online-Welt hat sich weiterentwickelt. Die Fokussierung auf bestehende Portale ist nun Strategie, ...
Ja, genau das war 2003 das Argument – und damals wurde man dafür angegriffen und belächelt. Und heute sollen wir uns dafür rechtfertigen, dass wir darauf hinweisen, dass wir die heutige Strategie der EKD schon 2003 empfohlen haben? Vor immerhin 15 Jahren! Wer versteht das? Es war schon 2003 klar und einsichtig, dass an Google kein Weg vorbeiführen würde. Aber offenbar nicht jedem. Man mag das rechthaberisch nennen, aber es kann doch nicht geleugnet werden, dass wir Recht hatten. Und es wäre doch ein Grund, darüber wenigstens nachzudenken, ob wir nicht auch dieses Mal bedenkenswerte Argumente haben. Das so genannte „Erfüllungskriterium“, biblisch wiederholt in Anspruch genommen, wäre doch zumindest ein Gesichtspunkt.
Wenn Andreas Mertin sich dafür ausspricht, Mittel in Jugendarbeit statt in Digitalisierung zu geben, hat er nicht verstanden, worum es geht. Es ist eben keine Alternative, entweder Jugendarbeit oder Digitalisierung, sondern Jugendarbeit und Digitalisierung. Denn wie bereits gesagt: Digitalisierung zahlt auch auf die Ortsgemeinde ein. Und wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Digitalisierung, um die Gemeinde zu stärken.
Nur zu Klärung: ich habe keinesfalls gefordert, dass alle Mittel für die Digitalisierung nun in die Jugendarbeit fließen, sondern nur ganz bestimmte Mittel. Ich hatte festgestellt, dass die jetzt von der Synode freigegebenen Mittel nur den Wasserkopf der EKD vergrößern und m.E. in unwichtige Projekte fließen. Dann doch lieber für die Jugendarbeit – das war mein Argument. Und ich glaube, ich bekäme bundesweit auf jeder Kreissynode eine Mehrheit dafür. Dass die jetzt beschlossene Digitalisierung konkret der Ortsgemeinde dient, ist schließlich zunächst nur eine Behauptung. Ich kenne nur Berichte von Pfarrerinnen und Pfarrern, dass irgendwelche kirchlichen Internetagenturen für Webauftritte Jahr für Jahr Geld verlangen, ohne dass dies einen messbaren Nutzen für Gottesdienst und Gemeindegruppen hätte. Ich warte gerne weitere 5 Jahre ab, um festzustellen, wie der Kirchenfinder nun zur Belebung des Kirchenbesuchs geführt hat. [Wenn ich Google frage, wann am nächsten Sonntag Gottesdienst in meiner Heimatstadt ist, dann ruft er zumindest schon die Ankündigungen der Gottesdienste auf der Seite des Kirchenkreises auf. Auch ohne Kirchenfinder.]
Ich lasse mich im Übrigen durchaus gerne von guten kirchlichen Start-ups überzeugen. Aber ich möchte auch solide evaluiert wissen, ob sie auch wirklich „die Gemeinden stärken“ – und das nicht nur auf ihren Webseiten behaupten. Auf einer Pfarrkonferenz zum Thema Digitalisierung und Kirche habe ich vor kurzen gesagt, wenn die 300.000 Euro, die nun für 2019 für den Kirchenfinder investiert werden sollen, als Beratungshonorar für 10 Jahre an Sascha Lobo, Konrad Lischka oder Christian Stöcker investiert worden wären, wären sie besser investiert gewesen. Dann haben wir alle nur gelacht – aber es lag ein Ton von Verzweiflung in dem Lachen.
Worin ich Ralf Peter Reimann Recht gebe, ist, dass man nicht alle kirchlichen Initiativen zur Digitalisierung vorab herabsetzen darf, ohne ihnen eine Chance zur Bewährung zu geben. Aber die Zustimmung muss doch begründet sein, sie darf nicht besinnungslos geschehen. Und ich hoffe nicht, dass man mir unterstellt, ich würde jede digitale Initiative der Kirche von vornherein ablehnen. In dem Bereich, in dem ich ab 1999 in der evangelischen Kirche aktiv war, habe ich mich engagiert am Aufbau des rpi-virtuell beteiligt und an dessen Konzeption mitgewirkt - über viele Jahre. Die Trennung erfolgte erst, als das rpi-virtuell einen Weg nahm, der sich weniger an theologischen Kriterien einer Qualitätssicherung im Netz, als vielmehr am technisch Machbaren orientierte. Heute hat sich auch das rpi-virtuell überholt, nur kann es nichts dafür. Es war die richtige Entscheidung, es gab keine Alternative und kann trotzdem in Zukunft gerade wegen der fortschreitenden Digitalisierung und Entwicklung säkularer Plattformen nur eine Schattenexistenz fristen. Es ist historisch überholt. Aber es war seinerzeit – anders als crossbot – unverzichtbar, weil es damals keine sinnvolle Alternative gab.
Evangelisch.de
Auch Hanno Terbuyken hatte ich in meinen Texten nicht direkt kritisiert, freilich die damalige Erscheinungsform von evangelisch.de als Plastikmüll bezeichnet (zur neuen Erscheinungsform äußere ich mich u.a. hier). Er antwortet mit der Aufforderung „‚Digital‘ und ‚Kirche‘ nicht als Gegensätze verstehen“. Zu seiner einleitenden Bemerkung, mein Text aus dem Magazin für Theologie und Ästhetik sei schwer verständlich, hatte ich oben schon Stellung bezogen. Es ist letztlich nur als Kritik an den Schriftleitern der evangelischen Pfarrblättern rezipierbar.
Nun zu Terbuykens Argumenten. Er meint, mich verbinde mit Wolfgang Hubers Überlegungen die Vermutung, die Digitalisierung solle die „echte Kirche“ irgendwie ersetzen. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es eine wie auch immer geartete „echte Kirche“ geben könnte, zielen meines Erachtens sowohl Wolfgang Hubers Argumente und meine Überlegungen darauf, wie die biblische Botschaft, dass das Wort Fleisch wurde, in dieser Gesellschaft konkret werden kann. Und ich bin mir sicher, dass wir beide keinem Versuch im Wege stehen würden, dies auf neuen Wegen plausibel zu machen.
Kleiner Exkurs: Leibliche statt echte Kirche
Ich möchte an dieser Stelle einen Exkurs einschieben, der für die gesamte Debatte meines Erachtens wichtig ist und der direkt mit Terbuykens Einwand zu tun hat. Nämlich mit der Frage: Was ist Kirche?
Christiane Tietz hat auf dem Hauptvortrag des Evangelischen Kirchentages 2011 darauf hingewiesen, dass „die Reformation, trotz aller Kritik an der kirchlichen Institution, nicht den Schluss gezogen [hat], der evangelische Christ könne und solle ganz für sich selbst Christ sein. Vielmehr hat sie neu darüber nachgedacht, was die Kirche ist und warum sie für den Christen nicht gleichgültig sein sollte.“ Und sie sagt weiter:
Grundlegend für alles Weitere wird das Augsburger Bekenntnis von 1530 mit seinem 7. Artikel. Dort heißt es: Die Kirche ist "die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden".
Was das bedeutet, kann man und muss man nun in der Auslegung konkretisieren. Tietz vertritt nun, dass die Versammlung an einem konkreten Ort geschehen muss:
Die Kirche ist nicht die Menge aller Gläubigen, sie ist die Versammlung aller Gläubigen, ist dies, dass die Gläubigen an einem konkreten Ort sichtbar zusammenkommen.
Zunächst verweist Tietz aber darauf, dass Kirche umfassender ist als eine Kirchenmitgliedschaft oder die Teilhabe am Gottesdienst: „Weil Christen zu Christus gehören, sind sie miteinander verbunden.“ Die Kirche sei ein "Geschöpf des Evangeliums". Das ist die verborgene Seite, nicht sichtbare Seite der Kirche.
Nun fügt sie diesem ersten Aspekt aber einen zweiten hinzu:
Weil ein Mensch nur durch das Hören des Evangeliums zu einem an Christus Glaubenden wird und er dafür Menschen braucht, die es ihm sagen, braucht er das sichtbare, d.h. das konkrete, tatsächliche Zusammentreffen mit anderen Glaubenden - und er braucht es stets neu, damit dieser lebendig bleibt.
Das klingt noch allgemein, wird aber konkret, wenn Kirche dahingehend konkretisiert wird, sie sei "die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden" (Augsburger Bekenntnis). Tietz fasst das zusammen:
In den Sakramenten, in Taufe und Abendmahl, wird die gnadenvolle Zuwendung Gottes, von der das Evangelium redet, fühlbar, schmeckbar, mit den Sinnen erfahrbar. Hier spüre ich leibhaft, wie sich Gott mich berührend, mich abwaschend, mich erquickend und stärkend, mir zuwendet. Damit geschieht in den Sakramenten nichts anderes als im Wort der Predigt. Aber es geschieht auf sinnenfällige und nicht nur meinen Intellekt ansprechende Weise.
Und die Frage, die daran anschließend zu erörtern wäre, ist die, wie sich „Digitale Kirche“ in diesem Prozess verortet. Ist sie vorgeordnet, quasi als Mittel, mit dem man Menschen zur leibhaften Gotteserfahrung einlädt? So zumindest lesen sich einige apologetische Äußerungen zur digitalen Kirche. Oder soll, genauer: kann die leibhafte Begegnung auch im Raum des Digitalen selbst geschehen? So lesen sich andere Äußerungen, die meinen, die nicht digital Affinen könnten natürlich weiter vor Ort feiern. Ist das theologisch legitim? Das ist die theologisch und nur(!) theologisch zu beantwortende Frage.
Evangelisch.de (Forts.)
Es ist auch der Vorwurf, dass die digitalen Aktivitäten, wie sie derzeit stattfinden, dem Auftrag der Kirche nicht dienen.
Nein, das geht haarscharf an dem vorbei, was mir Sorge macht. Vielmehr meine ich, dass es nicht reicht, etwas als dienlich hinzustellen, ohne auch theologische Gesichtspunkte bereitzustellen. Ich sage ganz ehrlich: anders als Wolfgang Huber ist mir die Frage, „was der Kirche dient“ eher egal. Da halte ich es in der Regel mit Karl Barth: „Man kann wohl oft einen Ekel bekommen vor dem ganzen kirchlichen Wesen. Wer diese Beklemmung nicht kennt, wer sich einfach wohl fühlt in den Kirchenmauern, der hat die eigentliche Dynamik dieser Sache bestimmt noch nicht gesehen. Man kann in der Kirche nur wie ein Vogel im Käfig sein, der immer wieder gegen die Gitter stößt.“ Darüber hinaus ist mir funktionalistisches Denken (Funktionärsdenken) allein schon als Ästhet wesensfremd. Mich interessiert, ob durch die vorgeschlagenen Maßnahmen etwas von dem Reichtum der biblischen und religiösen Überlieferung bewusster, etwas von dem Deutungspotential der jüdischen wie der christlichen Religion einsichtiger, etwas von der gesellschaftsverändernden Kraft spürbarer wird. Ob das der Kirche als Institution dient, scheint mir sekundär.
Nicht gleichgültig ist mir, wenn jemand die Verkürzung biblischer Texte mit dem Argument begründet, das diene der Kirche. Als einige in der Kirche in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts anfragten, ob „die Kirche nicht das Niveau ein wenig senken solle, um überhaupt einen Kontakt herbeizuführen“, antwortete der Jazz-Kritiker Ernst Berendt in der Zeitschrift twen entsetzt:
... das Niveau senken? Für den lieben Gott? Schlechter Jazz für guten Kirchenbesuch? Werft die Wechsler zum Tempel hinaus, sie haben das Niveau gesenkt. Aber viel Kontakt herbeigeführt.
Und er meinte, es wäre doch ziemlich dramatisch, wenn schlechte Musik mehr Kirchenbesuch bringen würde als gute. Das scheint mir nun auch für das folgende Beispiel zuzutreffen:
So ist für ihn auch die evangelisch.de-Twitterbibel, die 2009 zum Start unserer Seite gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern entstand, nur eine Spielerei. Die damalige mediale Aufmerksamkeit für das Bibelwort und das gedruckte Buch "Und Gott chillte", das inzwischen in zweiter Auflage ein beliebtes Konfirmationsgeschenk ist, sind ihm nichts wert.
Exakt darum geht es. Ich hatte seinerzeit am Beispiel von Hiob 19 gezeigt, wie durch den Twitter-Wettbewerb eine der beeindruckendsten biblischen Textpassagen, die über Jahrhunderte Literaten und Philosophen herausgefordert und beeinflusst hat, verfälscht und zur evangelikalen Traktat- und Tröstungsliteratur herabgewürdigt wurde. Es geht ja nicht darum, dass Jugendliche die Bibel kennenlernen, sondern darum, dass sie diese nach ihren Bedürfnissen ummodelten. Die mediale Aufmerksamkeit diente eben gerade nicht dem Bibelwort, sondern dessen Verkehrung ins Gegenteil. Wo in einem aufregenden Bibeltext zwei Drittel Klage und Anklage vor und gegen (!) Gott und ein Drittel Hoffnung auf Lösung (nicht Erlösung!) artikuliert wurde, da stand im Twitterwettbewerb am Ende ein Drittel Klage und zwei Drittel unerträgliche Gewissheit evangelikaler Frömmigkeit – was dem biblischen Text nun einmal nicht zu entnehmen ist. Das war seinerzeit die Kritik. Meine Frage war: Wo bleibt da das sola scriptura? Und was ist dann noch scriptura? Das muss als Frage doch gestellt werden können, ohne gleich als Mensch von gestern abgestempelt zu werden. Und was das Argument mit der nun schon zweiten Auflage angeht, so ist mir nicht klar, was es besagen soll: Auch ich habe mal mit Kollegen ein beliebtes Konfirmationsgeschenk geschrieben, das jetzt in dritter Auflage vorliegt und von der Bremer Kirche performant präsentiert wird (A – B - C - D). Und was sagt uns das? Nichts. Es sagt weder etwas über die Qualität noch über die religiöse Sinnhaftigkeit aus. Aber ich nehme das auch nicht in Anspruch.
Das Muster ist, zugespitzt von mir: Wer Digitalisierung predigt, predige nicht mehr das Evangelium.
Der mir unterschobene Satz ist zunächst einmal tautologisch. Wer Digitalisierung predigt, predigt natürlich nicht das Evangelium. Das ergibt sich aus dem Satz, sonst wären Digitalisierung und Evangelium deckungsgleich. Nur habe ich nie behauptet, dass die Social-Media-Beauftragten „Digitalisierung predigen“ würden. Sondern ich habe kritisiert, dass sie vehement die Digitalisierung fordern, ohne dabei einsichtig zu machen, inwiefern dies dem Evangelium dient.
Deshalb fordert Mertin die Vertreter einer Digitalen Kirche auf, "substantielle theologische, sich auf Schrift und Bekenntnis beziehende Argumente für die Digitale Kirche vorzubringen". Das ist eine billige Forderung, denn solche Argumente kann es nicht geben. Die Argumente für die Digitale Kirche sind die gleichen wie für jede andere Kirche.
Zunächst einmal habe ich die theologischen Argumente gefordert, weil es den Kritisierten auszureichen schien, auf Wolfgang Huber zu antworten, der verstünde nichts vom Internet. Das aber ist kein theologischer Einwand. Wenn sie wirklich theologische Argumente für die Kirche statt für die Digitale Kirche gebracht hätten, wäre es in meiner Sicht ja in Ordnung gewesen. Das haben sie in der Auseinandersetzung mit Huber aber nicht. Konkret darum ging es.
Und beim zweiten und dritten Satz widerspreche ich allen, die so argumentieren, auch früheren Autorinnen und Herausgeberinnen dieses Blattes: die Argumente für die digitale Kirche sind nicht automatisch die gleichen wie für jede andere Kirche. Und das erscheint mir unmittelbar einsichtig. Bei Kulturkirchen hätten es manche gerne, aber so ist es nicht. Das ist nur eine, mögliche, aber partikulare theologische Position. Und sie hat den Protest einer ganzen Theologengeneration ausgelöst.
Nehmen wir aber ein Beispiel, das überspitzt und krass ist, aber deutlich zeigt, dass es eben nicht gleich ist, welches Wort ich ‚Kirche‘ zuordne:
Die Argumente für die judenreine Kirche sind die gleichen wie für jede andere Kirche.
Ist das so? Mir will es so erscheinen, dass durch die Zufügung von „judenrein“, Kirche zu etwas anderem wird. [Und bevor es jemand wieder bewusst missversteht: ich meine nicht, dass digitale Kirche etwas Ähnliches wie judenreine Kirche sei. Es geht nur darum zu zeigen, dass umschreibende Ergänzungen den Inhalt des Ergänzten verändern.] Selbst wenn man - wie vermutlich Petra Bahr - meinen würde, die Begründung für Digitale Kirche dürfe keine andere sein, als die Begründung für Kirche, so glaube ich, dass das nicht funktioniert. Wir leben in einer Zeit, die durch Genderdebatten außerordentlich sensibel geworden ist, was sprachliche Zuschreibungen angeht. Und die weiß, dass durch Sprachhandlungen Dinge sich ändern. Im alltäglichen Leben wissen wir, dass der Satz
Die Argumente für eine grüne Republik sind die gleichen wie für eine braune, schwarze oder rote Republik
unzutreffend ist. Weil das charakterisierende Wort (grün / braun / schwarz / rot) das Substantiv (Republik) inhaltlich erst füllt und damit ändert. Nur im Katholischen scheint es so, als ob „Kirche“ den exklusiven Bedeutungsgehalt „katholische Kirche“ habe, während alle anderen dann eben Gemeinschaften sind. Evangelisch sehen wir das meines Erachtens nicht so. Hier sind die Zuordnungen immer noch inhaltsprägend: reformierte, lutherische, orthodoxe, katholische … Deshalb: digitale Kirche ist eine Bedeutungsbestimmung von Kirche, die mehr impliziert, als nur „Kirche sein“.
Da wird es eben doch sprachlich relevant, dass die Diskussion um #digitalekirche kreist und nicht um "Digitale Kirche". Denn das Hashtag bedeutet nicht, eine andere Kirche zu schaffen, sondern das "digital in "Kirche" zu integrieren.
Ich hätte beinahe geschrieben, das glaubt er selbst nicht. So möchte ich das nur als Sophismus bezeichnen. Dass #digitalekirche bedeutet, das „digital in ‚Kirche‘ zu integrieren“ mag eventuell die intentio auctoris einiger Beteiligter sein. Aus dem Wort (der intentio operis) ergibt sich das nicht. Und aus der intentio lectoris schon gar nicht. Denn jeder Blick in die Verlautbarungen der Avantgardisten zeigt, dass es ihnen doch um mehr als Digitales in der Kirche geht. Sie meinen wirklich: Digitale Kirche und schreiben dann: Natürlich könne es daneben auch noch heilige Orte und Räume geben, wenn die Menschen daran hängen. So etwa Christoph Breit:
Dass schließt nicht aus, das(sic) wir besondere Räume und Zeiten anbieten, die sich von der Welt abheben. Aber es bedeutet auch nicht, dass wir uns auf diese heiligen Räume und Zeiten beschränken, ja Kirche als nur dort möglich verstehen.
Wenn Petra Bahr recht hat, wenn Terbuyken recht hat, müsste es doch inhaltlich (nicht formal) um so etwas wie #kirchedigital gehen. Auf diese Art und Weise wäre der Impuls von Petra Bahr wahrnehmbar, Kirche vorzuordnen und dann zu schauen, wie und wo sich das konkretisiert: #kirchekulturell, #kirchedigital, #kirchefeministisch und so weiter. Damit hätte ich überhaupt keine Probleme. Die Fragen: Wie äußert sich Kirche kulturell? Wie äußert sich Kirche digital? Wie äußert sich Kirche feministisch? treiben mich seit langem um.
Aber wenn es stattdessen um #digitalekirche geht, dann wird hier eine Form zu einem Inhalt verschoben, da hat Wolfgang Huber recht. Ich kann mit engagierter, mit offener, mit kultureller Kirche leben. #digitalekirche wäre nicht meine Kirche. Das so zu sehen ist wiederum mein Recht als Teil der Kirche.
KircheDigital
Andreas Mertin hat mich eingeladen, in seinem Magazin „Tà katoptrizómena“, der Plattform für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik zu antworten. Auch die Länge war vorgegeben. Alles darunter sei „dahingerotzt“. Man mag mir verzeihen, dass ich dieser „wertschätzenden“ Einladung nicht folge und deswegen hier und länger in meinem Blog antworte.
So begründet der bayrische Pfarrer Christoph Breit, warum er nicht im Theomag schreiben will. Das Theomag ist keine Plattform, es ist, wie es in der TRE heißt, das älteste theologische E-Zine. Und es ist nicht ‚mein‘ Magazin, sondern wird zurzeit von vier Herausgebern betrieben, von einem emeritierten hessischen Professor für Praktische Theologie, von einem badischen Pfarrer und früheren Leiter der Berliner Evangelischen Akademie, vom Leiter der Hamburger Evangelischen Akademie und von mir als westfälischem Senior-Editor. Früher gehörten auch einmal die ehemalige Kulturbeauftragte Petra Bahr, die Akademiedirektorin Eveline Valtink, die Kunsthistorikerin Karin Wendt und der Studienleiter und Dekan Dietrich Neuhaus zu den Herausgebern.
Und nein, die Länge war nicht vorgegeben, ich war es nur leid, dass Pfarrer ihre Haltung zu anders Denkenden in 140 despektierlichen Zeichenakkumulationen „hinrotzen“. Ich kenne so ein Verhalten von den Pfarrerinnen und Pfarrern, Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich Woche für Woche zu tun habe, überhaupt nicht. Dort wird zunächst gefragt: Wie kommen Sie zu Ihrer Sicht und was meinen Sie zu folgenden Einwänden? Und nicht: Wer sind Sie denn überhaupt? Sie haben ja keine Ahnung! Sie wissen nicht mal, wie man ein Hashtag setzt! Und da kann ich nur sagen: So reden wir hier in Westfalen nicht miteinander. Und deshalb hatte ich geschrieben, man verurteilt Andere nicht in 140 Zeichen, sondern man setzt sich auseinander. Und dann hatte ich hinzugefügt:
Es „darf ruhig ein Essay mit 35.000 Zeichen sein. Als Ralf Peter Reimann 2003(!) in diesem Magazin zur Cyber Church zwischen Tradition und Postmoderne schrieb, waren es auch 46.000 Zeichen ... Also: übertreffen Sie ihn!“
Das ist keine vorgegebene Länge, sondern nur der Hinweis, dass er auch ausführlicher antworten kann. Nun hat Christoph Breit „länger“, d.h. mit 14.000 Zeichen geantwortet, ein Essay ist es nicht, aber er erscheint ja auch nicht im Theomag. Das schaue ich mir gerne an:
Es fällt schwer, auf Andreas Mertin und seinen Artikel „Was ‚Digitalisierung‘ in der Kirche nicht heißen kann“ und den nachgeworfenen „Fehdehandschuh“ zu antworten. Er zwingt dazu, sich rechtfertigen zu müssen. Theologische Beweise werden eingefordert. Wer so auftritt, will Recht haben. Und wird unterstützt durch eine Schriftleitung, die im Korrespondenzblatt 40.000 Zeichen für Digitalisierungskritik freihält und einer Antwort 5000 Zeichen zugesteht.
Allein die einleitenden Zeilen des Pfarrers Christoph Breit sind so weit von meinem Verständnis von protestantischer Kultur und evangelischer Freiheit entfernt, dass ich mich frage, ob ich wohl in derselben Welt lebe. Es fängt schon damit an, dass er zeitliche Abfolge bewusst falsch darstellt. Aber er verkehrt auch die sachliche Argumentation.
Theologische Argumente hatte ich Februar 2019(!) gefordert, nachdem mein Text bereits zehn Monate online war, und die einzige Antwort auf Twitter war, dass ich ebenso wie Wolfgang Huber keine Ahnung von dem hätte, worüber ich mich äußere. So sehen die Antworten von Social-Media-Diskutanten aus. Von der Denunziation Hubers als Troll ganz zu schweigen. Die bayrische Schriftleitung aber konnte mich in dieser Forderung aber gar nicht „stützen“, weil sie vom zweiten Text, in dem dieser Aufruf artikuliert wurde, nichts wissen konnte, weil er noch gar nicht geschrieben war. Meine Aufforderung war vielmehr eine Reaktion auf gereizte Reaktionen auf Twitter auf die Publikation meines Artikels im Pfarrerblatt. Insofern weiß Breit um die zeitliche Reihenfolge. Er tut nur so, als wäre das anders. Sein Verhalten konnte ja insgesamt als etwas kindisch bezeichnet werden: Nachdem mein Text bereits auf der EKD-Seite zur Vorbereitung der Synode verlinkt war, er bereits viermal in Pfarrerblättern abgedruckt wurde, „verriet“ Breit seinen vermutlich bayrischen Lesern Ende 2018 unter dem Etikett „Achtung Spoiler“ wie das Ende des Artikels lautet. Spoiler???? Wer denkt so? Das bayrische Pfarrerblatt hat übrigens auch nicht den Text aus dem Theomag nachgedruckt (das haben allein die badischen Pfarrblätter), sondern den Text, der zuvor in den badischen, hessischen, nordkirchlichen und westfälischen Pfarrblättern erschienen war. Und dann ich würde gerne wissen, wo ich theologische „Beweise“ gefordert habe. Ich hatte um theologische Argumente gebeten, mir hätten aber auch schon begründende Prämissen zum Thema gereicht.
In der Sache meint Breit, man hätte meinen Text besser überhaupt nicht publizieren sollen. Sonst macht sein empörter Hinweis auf die Schriftleitung, die mich auch noch stützt(sic!), keinen Sinn. Ich publiziere jetzt seit mehr als 35 Jahren, aber es ist erst das zweite Mal in meinem Leben, dass jemand einer Schriftleitung derartiges nahelegt. Jedes Mal geschah das „Tief in Bayern“ (R. W. B. McCormack). Einmal war es ein Vertreter des Forums Deutscher Katholiken, weil ich etwas über Kunst und Religion in Begegnung & Gespräch publiziert hatte, nun ist es ein evangelischer Pfarrer, der meinen Text in den bayrischen Korrespondenzblättern ungeschrieben sehen möchte. Das offenbart viel von kritischer Debattenkultur im gegenwärtigen kirchlichen Milieu – vielleicht ist es aber auch nur bayerntypisch und bedarf tatsächlich einer „Ethnographie“.
Was spricht denn dagegen, meinen Text zu publizieren? Was trifft einen Pfarrer so, dass er meint, einer Schriftleitung vorwerfen zu müssen, dass sie meinen Text publiziert? Und welche Selbsteinschätzung steckt in dem Ansinnen, er müsse nun aber im angemessenen Umfang antworten dürfen? Denn eine Antwort ist durchaus erschienen. Werner Thiede hat repliziert und auf bereits publizierte theologische Gedanken verwiesen (nur dass es in meinem Text ja mehr um kulturwissenschaftliche Aspekte ging). Und nein, mein Text umfasst nicht 40.000 Zeichen, das weiß Breit, aber er hätte sicher gern Vieles zu seinem Arbeitsfeld geschrieben. Hätte er ja machen können – er hatte das ganze Kirche-und-Digitalisierungs-Jahr 2018 dafür Zeit, nur scheint er keinen Text bei den Pfarrblättern eingereicht zu haben. Das habe ich freilich auch nicht. Aber die Schriftleitung von fünf verschiedenen Pfarrblättern fanden den Text anscheinend literarisch so kurzweilig, dass sie ihn auch in ihrem Medium zugänglich machen wollten. Das scheint zumindest in Bayern etwas Schlimmes zu sein. Nun könnte man fragen, warum hat die bayrische Schriftleitung so entschieden, warum sind sie nicht gleich auf den Social-Media-Spezialisten Breit zugegangen? Ja warum nur? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie den Leserinnen und Lesern einmal nicht die Gedanken eines dafür bestallten Pfarrers, sondern die eines Außenstehenden präsentieren wollten. Und nicht ahnen konnten, dass es Proteste gibt, wenn jemand schreibt, der nicht aus dem eigenen Stall kommt.
In anderen Landeskirchen waren die Reaktionen auf den Artikel übrigens völlig anders. Ich habe noch nie geglaubt, dass die Mehrheit der Leserinnen und Leser mit meinen Überlegungen übereinstimmt. Das wäre öde, denn dann bräuchte ich sie nicht zu aufzuschreiben. Es geht um Anregungen zum eigenständigen Nachdenken, um Widerspruch, um In-Frage-Stellungen, um Kritik. So war es auch im Fall von crossbot, als Ralf Peter Reimann seine kontroverse Sicht der Dinge zu den bisherigen Texten im Magazin einreichte und sie im folgenden Heft publiziert wurde.
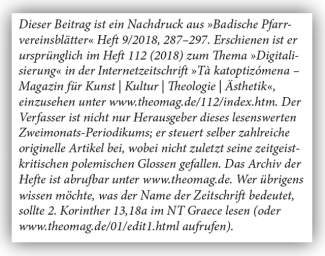 Nachgedruckt wurde mein Text von Anfang 2018, weil man hier „kurzweilige und pointierte Notizen der auch das Feld der Ethik und der Menschenwürde berührenden Diskussion zur Digitalisierung in der Kirche“ vorfand (so das Framing in der badischen Landeskirche). Ein vorbildliches Branding, das den Leser auch über den Kontext des Erscheinungsortes informierte, brachten die westfälischen Pfarrblätter (s. Screenshot). Nachgedruckt wurde mein Text von Anfang 2018, weil man hier „kurzweilige und pointierte Notizen der auch das Feld der Ethik und der Menschenwürde berührenden Diskussion zur Digitalisierung in der Kirche“ vorfand (so das Framing in der badischen Landeskirche). Ein vorbildliches Branding, das den Leser auch über den Kontext des Erscheinungsortes informierte, brachten die westfälischen Pfarrblätter (s. Screenshot).
Das alles kommt bei Breit nicht einmal ansatzweise vor. Allein schon der performative Widerspruch, dass er meinen Text, der zunächst exklusiv in digitaler Form in einem digitalen Medium erschienen ist, als pauschale Digitalisierungskritik darstellt, befremdet mich. Ich stelle alles, was ich schreibe, online und das kostenlos. Das unterscheidet mich und meine Kollegen von der vernetzten Kirche. Im Magazin bitten wir um Spenden und verkaufen keine Abos.
Eine von Breits Strategien in der Auseinandersetzung ist nun die des bewussten Missverständnisses, etwa wenn er mich zitiert:
„Gibt es eine Begegnung mit Gott in der Person Jesu Christi? Dann ist die Frage der räumlichen Gestaltung und des Kontextes sekundär. Gibt es diese personale Begegnung nicht, ist alles hinfällig?“ Spannend ist hier die Engführung: Ich kann Gott in der Person Jesu Christi auch im Netz begegnen. Wenn aber nur personale Begegnungen zählen, dann lasst uns Telekommunikation, Medienarbeit und alle moderne Technik abschaffen. Kirche ist dann nur da, wo zwei oder drei …
Das ist eine merkwürdige Hermeneutik. Ich zitiere einen Satz von Kurt Marti, in dem es darum geht, dass es nicht mehr des Tempels bedarf, um Gott zu begegnen, sondern wir Gott nun in der Person Jesu Christi begegnen. Und ich füge hinzu: Wenn kirchliche Aktivitäten zur Begegnung mit Gott in der Person Jesus Christi führen, dann haben sie ihr Werk getan. M.a.W., dass Kriterium ist nicht, Digitalisierung ja oder nein, sondern die ermöglichte Begegnung mit Gott in Jesus Christus. Wenn dies mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten gelingt, finde ich das gut und unterstützenswert. Da bin ich ganz mit Wolfgang Huber einig, wenn er sagt: „Die Kirche soll die digitalen Medien nutzen … Sie soll die jeweils besten Mittel einsetzen, aber keines dieser Mittel vergöttern.“ Breit macht aus meinem Argument das Gegenteil und unterstellt, ich hätte vertreten, dass man Gott im Netz nicht begegnen kann. Das ist eine Lüge. Selbstverständlich kann ich Gott in der Person Jesu im Netz begegnen. Daran arbeite ich selbst als Mitglied der Evangelischen Kirche seit 30 Jahren.
Als Theologe sollte Breit aber wissen, dass der Personenbegriff in der Theologie ein anderer ist als in der Lebenswelt. Denn wir begegnen Jesus Christus auch in unserer körperlichen Lebenswelt ja keinesfalls personal im lebensweltlichen Sinn. Das behaupten allenfalls Evangelikale: Mir ist Jesus Christus begegnet. In dieser Frage gibt es überhaupt keine Differenz von analog und digital. Und als Reformiertem wird er mir nicht unterstellen, ich würde an eine dingliche Präsenz Jesu Christi glauben. Die personale Begegnung mit Jesus Christus ist nicht eine Frage von analog oder digital. Die Frage ist vielmehr: wie und wo geschieht die personale Begegnung mit Jesus Christus in den digitalen Welten? Und ich finde es ehrenrührig, wie Breit versucht, meine Argumente ins Gegenteil zu kehren, indem er die Bezugspunkte weglässt. Worum es ging, war die auffällige Tatsache, dass in der Frage der Digitalisierung der Kirche theologische Aspekte gegenüber Modernisierungsaspekten zweitrangig werden. Und da habe ich gesagt, zeigt mir, wo es euch gelingt, Gott präsent zu machen. Wo geschieht es denn? Und dass jetzt so aggressiv darauf reagiert wird, ohne darauf eine Antwort zu geben, scheint mir ein Indiz (aber auch wirklich nur ein Indiz) zu sein, dass es um überzeugende Beispiele nicht so gut bestellt ist.
Auch die Art, mit der hier ein Jesus-Wort einfach weggewischt wird, überzeugt mich nicht: „Weiter sage ich euch: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matth. 18) Können wir einfach davon ausgehen, dass das neutestamentliche „versammelt“ an dieser Stelle auch die Virtualität miteinschließt? Um Kirche sein geht es dabei noch nicht einmal. Das müsste doch begründet werden.
Kommen wir zum nächsten rhetorischen Kniff:
Wer behauptet, digitale Kirche wolle althergebrachte Kirche ablösen oder ersetzen, diskeditiert(sic) um Pfründe zu sichern.
Das finde ich den spannendsten Aspekt seiner Ausführungen. Und da würde ich gerne mal konkreter hören, was Breit damit meint. Wessen Pfründe hat er da im Blick? Meine ja nun sicher nicht. Mir gewährt die evangelische Kirche keine Pfründe. Wenn man schreibt: das machen die nur, um ihre Pfründe zu behalten, behauptet man ja, die Kritiker verfügten über Pfründe und seien davon getrieben, ihre Geldtöpfe zu behalten und hätten dafür keine Argumente. Zunächst einmal: Er kann damit ja nicht mich als ein nicht von der Kirche Alimentierter gemeint haben. Welche imaginären Geldtöpfe könnte ich schon verteidigen? Wer das Theomag kennt, weiß das wir es aus gegenteiligen Gründen betreiben. Um ein Wissen, das bisher exklusiv analog, Bibliotheken-gebunden und nur pekuniär zugänglich war, allen kostenlos zur Verfügung zu stellen.
 Aber kirchenpolitisch ist das Argument mit den Pfründen durchaus interessant. Denn es macht nur Sinn, wenn es wirklich um die Verteilung von Geldern geht. Wenn also die notwendigen Geldmittel für die Digitalisierung tatsächlich Geldmittel für die Gemeinde gefährden, in Breits Worten: deren Pfründe einschränken. Ist das so? So deutlich hat man das bisher nicht gehört. Also müssen wir den Gemeinden etwas wegnehmen, das sie bisher hatten, versprechen im Gegenzug aber, sie haben etwas davon. Ist das die Logik? Und ist das also etwas Ähnliches wie die Rationalisierung im Neoliberalismus? Die sind ja nur gegen Digitalisierung, weil dann Arbeitsplätze wegfallen? Denn die Pfründe können noch meiner Einschätzung ja nur die der Gemeinde-Pfarrstellen sein. Ja die pfaffen, die viel pfründen haben. Den Rekurs auf den Begriff der Pfründe durch Breit fand ich auch deshalb interessant, weil er mir vorher süffisant den Gebrauch mittelalterlicher Worte wie „Fehdehandschuh“ vorgeworfen hatte. Ich sehe nicht, dass „Pfründe“ sprachlich moderner wäre – ganz im Gegenteil, es dürfte in die Antike datieren. Aber kirchenpolitisch ist das Argument mit den Pfründen durchaus interessant. Denn es macht nur Sinn, wenn es wirklich um die Verteilung von Geldern geht. Wenn also die notwendigen Geldmittel für die Digitalisierung tatsächlich Geldmittel für die Gemeinde gefährden, in Breits Worten: deren Pfründe einschränken. Ist das so? So deutlich hat man das bisher nicht gehört. Also müssen wir den Gemeinden etwas wegnehmen, das sie bisher hatten, versprechen im Gegenzug aber, sie haben etwas davon. Ist das die Logik? Und ist das also etwas Ähnliches wie die Rationalisierung im Neoliberalismus? Die sind ja nur gegen Digitalisierung, weil dann Arbeitsplätze wegfallen? Denn die Pfründe können noch meiner Einschätzung ja nur die der Gemeinde-Pfarrstellen sein. Ja die pfaffen, die viel pfründen haben. Den Rekurs auf den Begriff der Pfründe durch Breit fand ich auch deshalb interessant, weil er mir vorher süffisant den Gebrauch mittelalterlicher Worte wie „Fehdehandschuh“ vorgeworfen hatte. Ich sehe nicht, dass „Pfründe“ sprachlich moderner wäre – ganz im Gegenteil, es dürfte in die Antike datieren.
Es geht weiter, diesmal mit einer Notiz zum Erkenntniswert der Unterhaltungskultur:
Mit Mertins Ausflug in seine anscheinend sorgfältig gepflegte Science-Fiction-Sammlung kann ich wenig anfangen. Wenn man jede Zukunftsvision als „Spiegel der Sehnsüchte einer Gesellschaft begreift“, diskreditiert man Menschen, die einfach nur Probleme von Menschen lösen wollen und deswegen Lösungen neu denken.
Nun, meine Sci-Fi-Sammlung ist wirklich sehr klein und überschaubar, jedenfalls im Vergleich mit der Sammlung meiner theologischen, kunsthistorischen und literarischen Bücher. Ich wusste aber nicht, dass man sich für das Lesen von Science-Fiction schon wieder verteidigen muss. Wenn ich aber mit Kolleginnen und Kollegen aus der Theologie wissenschaftliche Akademietagungen zu „Science-Fiction und Religion“ veranstalte, dann besorge ich mir das zu untersuchende Material, hier also die Romane, möglichst in digitaler Form, weil sie sich dann gezielt durchsuchen lassen. Das würde Christoph Breit vermutlich auch so machen.
Den merkwürdigen Satz
„Wenn man jede Zukunftsvision als ‚Spiegel der Sehnsüchte einer Gesellschaft begreift‘, diskreditiert man Menschen, die einfach nur Probleme von Menschen lösen wollen und deswegen Lösungen neu denken“
hätte ich gerne in einfacherer Sprache erläutert, so ist er für mich nur unverständlich. Dass Science-Fiction-Romane Spiegel menschlicher Sehnsüchte sind (Reise zum Mond, zum Mars, zu fremden Galaxien, zum Mittelpunkt der Erde), vertreten viele, wenn nicht alle Literaturwissenschaftler, die mit Sci-Fi beschäftigt sind. Kann man ernsthaft daraus schlussfolgern, dass, wenn sie das tun, sie Menschen diskreditieren, die einfach nur Probleme von Menschen lösen wollen? Da scheinen mir aber ein paar Sätze in der Begründung ausgefallen zu sein. Oder darf man sich in gesellschaftlichen Diskussionen nicht mehr auf Literatur beziehen, weil man sonst Problemlöser diskreditiert? Angesichts der Tatsache, dass ja nun auch die Bibel Literatur ist, bekomme ich Angst vor Pfarrern, die so denken. Und zumindest geschichtlich ist es ja nun auch anders, die literarischen Zukunftsvisionen haben als Ausdruck der Sehnsüchte der Menschheit die Wissenschaft und die Technik vorangetrieben. Die Weltraumfahrt ist ein guter Beleg dafür.
Aber auch hier, es ist beinahe müßig, jeder Fehlzitierung nachzugehen, hatte ich de facto etwas ganz anderes geschrieben:
Insofern man Science-Fiction als Spiegel der Sehnsüchte einer Gesellschaft begreift, dann müsste doch in all diesen Bänden auch ein religiöser Virtuose als Roboter auftauchen.
Weder bezog ich mich auf Zukunftsvisionen generell, noch habe ich behauptet, dass Science-Fiction-Romane „Spiegel der Sehnsüchte einer Gesellschaft“ sind. Ich habe nur geschrieben: Insofern man das macht (wie es die Literaturwissenschaft macht), müsste sich doch auch ein religiöser Roboter darunter befinden. Aber genau das ergab sich überraschenderweise mit einer Ausnahme nicht. Und das schien mir ein Indiz zu sein. Geschlossen habe ich daraus: Gewünscht werden Segensroboter nicht.
Breit fährt nun unmittelbar fort, so dass es sich wie eine Konsequenz aus der Diskreditierung von Problemlösern durch Science-Fiction-Leser ableitet:
So macht es mich schon nachdenklich, wenn immer mehr Menschen die evangelische Kirche verlassen, weil sie keinen konkreten Mehrwert in der Kirche sehen.
Das wird es sein. Die Menschen verlassen die Kirche, weil wir sie daran hindern, die Digitalisierung voranzutreiben und stattdessen Literatur lesen. Komisch, dass dieses Argument so selten bei den Begründungen für den Kirchenaustritt auftaucht. Ja, wenn meine Kirche digitaler wäre und weniger Literatur vorkäme, wäre ich ja geblieben, aber so fehlt mir der Mehrwert.
Ebenfalls nicht genügen kann ich der Anforderung, man müsse sich erst akademisch bewährt haben um sich an einem Diskurs zu beteiligen. Wie Mertin sich aber über Kollegen wie den von mir sehr verehrten Lutz Neumeier auslässt, verträgt sich nicht mit dem Miteinander unter Christinnen und Christen.
Zur Erinnerung: Im konkreten Fall ging es darum, dass alle sich freuten, dass man nicht mehr – wie noch Wolfgang Huber – sich theologisch mit Dingen auseinandersetzen müsse, sondern jeder sagen könnte, was er wolle. Noch einmal mein Zitat aus dem Artikel:
Man polemisierte gegen den ‚alten Mann‘, der von Twitter nichts versteht (‚Troll emeritus‘). Und frau jubilierte, dass Twitter nun endlich die Hierarchien auf den Kopf stellt und ein Wissenschaftler wie Huber nichts mehr zu sagen habe: „Hier (wird) noch mal so deutlich, wie sehr Digitalisierung bisherige Hierarchien ad absurdum führt“. - „Ohja … das wird alles radikal auf den Kopf gestellt und dass ist herrlich. Es werden nicht mehr nur diejenigen Stimmen bekommen, die aufgrund ihres Amtes eine (laute) haben, sondern alle, die guten Willens sind.“ – „#socialmedia bricht Hierarchien! Wichtiger als ein Doktortitel o. eine Position sind am Ende eines Tages bei #Twitter die Inhalte!“
Das hatte ich mit einem Stammtisch verglichen und Theologisches erbeten. Der Diskurs ist kein Selbstzweck, er unterliegt Regeln. Hier ging es darum, dass man nicht einfach ausgewiesene Theologen und Kirchenvertreter abfertigt wie kleine Kinder. Meine türkischen Nachbarn würden sagen: dass man schlicht Respekt zeigt. Diese Forderung scheint nicht gut angekommen zu sein.
Ich wusste allerdings auch nicht, dass die Pfarrer Neumeier und Breit die norma normans für das korrekte Miteinander unter Christinnen und Christen sind. Sie scheinen ja zu wissen, wie das korrekte Miteinander unter Christinnen und Christen auszusehen hat. Als reformierter Christ schlage ich in solchen Fällen die Bibel auf und finde dort ganz andere Umgangsformen, etwa bei den sozialkritischen Propheten. Das hört sich auf Bayrisch so an:
Hoertß dös Wort, ös Samreiter Weiber, üeppig wie Bäsnküe: De Schwachn unterdrucktß, und kain Arms haat bei enk was z lachen. Und enkerne Mannen sauffetß ös glei non unter n Tish einhin.
Aber die Bibel mit ihrer Scharfzüngigkeit muss ja Pfarrer nicht in ihren Ansichten stören. Dennoch ist es immer schön, mal wieder ans 19. Jahrhundert erinnert zu werden, als Pfarrer noch den Gemeindegliedern vorschreiben konnten, wie sie sich zu verhalten hätten. Und darin sind sie ja nun bis heute vorbildlich. Vielleicht bin ich nur deshalb so entsetzt, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie Pfarrern wie diesen beiden begegnet bin.
Lutz Neumeier behandelt Wolfgang Huber wie der Oberlehrer aus der Feuerzangenbowle einen Pennäler und befiehlt ihm: Du musst erst lernen, bevor Du hier was sagen darfst! Und Du musst antworten, wo und wann ich es erwarte! Das scheint der neodigitale christliche Ton der Gegenwart zu sein. Das hatte ich mit einem Rekurs auf Adornos Studien zur autoritären Persönlichkeit eingeordnet. Angesichts dessen, dass Huber nun einer der führenden Theologen der Gegenwart ist, fand ich den Aufruf, er müsse noch mal die Schulbank drücken, unverschämt. Und ich fragte mich: was treibt jemanden dazu? Was hat er der Welt zu sagen? Konkret: was hat er über das von Huber Erarbeitete mehr zu sagen? Und ich fand nichts.
Man hätte nun antworten können, ich hätte mich geirrt, der Kritisierte habe durchaus weiterführende theologische Aspekte eingebracht. Nun aber soll ich mich mit Hinweis begnügen, Lutz Neumeier werde von Christoph Breit sehr verehrt? Ich schätze auch manche Menschen, aber das begründet doch nicht deren Qualität. Muss ich Breit einfach glauben?
Breit meint nun, meine Form der Kritik vertrage sich nicht mit dem Miteinander von Christinnen und Christen. Das freilich sagen sie immer gerne, nachdem sie vorher die Menschenwürde anderer in den Dreck getreten haben. Wie Huber sagte: es ist sein Menschenrecht, sich so zu verhalten. Und einige Twitterer wollten ihm das nehmen. Man muss es gar nicht so hoch hängen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns unsere Kommunikationsorte und -formen selbst wählen. [Auch Breit beruft sich darauf, wenn er die Stellungnahme im Theomag verweigert.] Dieses Recht haben wir in einer aufgeklärten Gesellschaft ebenso wie das Recht auf Verweigerung der Kommunikation. Nur BILD- und RTL-Reporter meinen, man müsse immer und jederzeit Auskunft geben. So ist das nicht.
Wenn freilich der Ton, den Neumeier gegenüber Huber angeschlagen hat, für das christliche Miteinander beispielgebend ist, sollte man diese Kirche so schnell wie möglich verlassen. Es zeigt, welche Tonlage denen drohen dürfte, die der digitalen Modernisierung nicht folgen.
Nach meinem letzten Artikel bekam einen Anruf eines kirchlichen Angestellten, der auch durch meine Formulierungen seine Menschenwürde verletzt sah und ebenso wie Breit (m)ein christliches Verhalten einklagte. Auf meine Rückfrage, ob er denn das von mir Kritisierte nicht gesagt habe (ich hatte es in einer Pressemeldung als wörtliches Zitat in Anführungsstrichen vorgefunden), sagte er: Ja vielleicht, aber er habe es nicht autorisiert. Wenn man also einen als wörtlich charakterisierten Satz als das charakterisiert, was er ist, verletzt man die christlichen Regeln? Was sind die dann noch wert?
Die Berufung auf die christlichen Werte, so erscheint es mir, kommt immer dann zum Tragen, wenn man sich an der Kritik anderer stößt. Solange man aber die anderen als Trolle, Unwissende, Dumme, Ahnungslose denunziert, gelten sie nicht. Bigott nennt man so etwas meines Wissens. Klerikalismus nennt es die katholische Kirche seit Neuestem und benennt damit die zentrale Ursache für die Krise der Kirche in der Gegenwart: Dass die Regeln, die man gegenüber anderen in Anschlag bringt, für einen selbst nicht gelten.
Abschließend noch ein Indiz, dass Breit nun wirklich nicht willens ist, den zentralen theologischen Einsichten des 20. Jahrhunderts zu folgen. Er schreibt zum Schluss seiner Ausführungen:
Und könnte es nicht sein, dass Gott die Digitalisierung schickte, um uns zu bewegen?
Verstehe ich das richtig? Weil Jesus Christus, Karfreitag und Ostern nicht ausreichten, schickt Gott uns nun die Digitalisierung? Auch wenn ich den halb-ironischen Unterton mitlese, finde ich diesen Satz theologisch schier unerträglich. Ist es denn nicht das, was wir am Ende des 20. Jahrhunderts feststellen mussten: im 19. Jahrhundert schickte Gott uns Waffen und segnete sie, bei Helmut Thielicke schickte Gott uns Auschwitz und hielt seine schützende Hand über Hitler, bei späteren Theologen schickte er uns einen Tsunami und ein Erdbeben für die Gottlosigkeit der Gesellschaft. Bei Breit schickt er uns nun also die Digitalisierung zur Bewegungssteigerung der Kirche. Dagegen gilt es nun wirklich theologisch aufzustehen:
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.
Dahinter gibt es keinen Weg zurück!
Alles in einem Topf?
Philipp Greifenstein meint, ich hätte mit meiner Philippika übertrieben. Eigentlich stünde ich doch auf der Seite der Digitalen und müsste doch eher die pauschale Kritik von Huber zurückweisen. Das stand aber gar nicht in meinem Fokus. Ich fand, wenn man Kritik an Huber äußert, kann die eben nicht lauten, der bedient nur alte Leute, sondern, die Kritik ist hier und dort falsch. Dass er alte Leute bedient, mag vielleicht zutreffend sein, sagt aber nichts über die Gültigkeit seiner Argumentation. Man kann also ein Argument nicht durch den Verweis auf die Klientel widerlegen. Dass Kirche, wie Huber sagt, nur leibhaft vollzogen werden kann, ist keine steile These, sondern zunächst einmal Ergebnis theologischer Gedanken. Da hilft es nicht, dagegen zu setzen: nein, für mich ist Kirche auch da, wo zwei über Abendmahl twittern. Sondern es müsste schon so sein, dass auch dafür dann theologische Argumente in Anschlag gebracht werden. Sonst landen wir bei der Kirche der fliegende Spaghettimonster.
Ansonsten kann ich Greifenstein in vielen Argumenten durchaus folgen. Nur frage ich mich, warum – auch in seinem Beitrag – so explizit auf das Alter abgehoben wird? Warum es überhaupt als Erklärungsmuster dient.
Wenig überraschend eigentlich, dass ein lange emeritierter älterer Herr mit Vorliebe für Theologie mit Twitter nicht so recht was anzufangen weiß.
Das war Greifensteins erste Reaktion auf Twitter zu Hubers Äußerung. Was kann man daran missverstehen? Ja, das ist Altersrassismus: Wenig überraschend, dass ein älterer Herr mit Twitter nicht so recht etwas anfangen kann. Und kann man einem Theologen vorzuwerfen, dass er Theologie liebt? Wird demnächst noch behauptet, Menschen mit Vorliebe für Theologie könnten mit Twitter nicht so recht etwas anfangen? Da sollte man doch auf dem Teppich bleiben.
Hubers Äußerungen sind populistisch, weil sie sich anbiedernd an diejenigen wenden, die aus Gewohnheit oder Neigung permanent Widersprüche zwischen Digitalisierung und Kirche beschreiben.
Ich persönlich habe Wolfgang Huber ganz anders erlebt, zuletzt bei einem Vortrag auf einer Loccumer Tagung mit niedersächsischen Schulleiterinnen und Schulleitern, in dessen Folge dann tatsächlich eine Stelle für eine Religionslehrerin neu geschaffen wurde. Das ist dann schon etwas Gewinnbringendes, auch für die Kirche. Da ging es konkret um Jugendkulturen, um Bildung und die Rolle von Religion. Da ging es um Erfahrungen, die er mit seinem Enkel auch in Sachen Technik und Erkundung der Welt macht. Nichts von dem, was ihm nun vorgeworfen wurde, traf auf sein Auftreten zu. Und da frage ich mich, wird da nicht einfach ein Vorurteil kolportiert – ein Vor-Urteil, dass sich bloß an Hubers Alter festmacht (ein lange emeritierter älterer Herr mit Vorliebe für Theologie)? Dass Twitter ein Weg ist, sich aus dem Weg zu gehen, könnten ja nun auch junge und jüngste Mitbürger behaupten. Tatsächlich nutzen nur 30% der Jüngsten Twitter, und immerhin 20% der Ältesten. So what.
Wenn ich „Die Kirchen brauchen andere Digitalprominente“ schreibe und von „ältlichen Bischöf*innen“ polemisiere, dann spreche ich damit doch recht eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit aus. Die #digitaleKirche braucht selbstverständlich andere, die ihr Geschäft erledigen, als diejenigen, die aus Desinteresse oder Neigung heraus lieber gerne von der Seitenlinie aus das Geschehen kommentieren.
Keinerlei Zustimmung zu einem dieser Sätze. Ehrlich gesagt, hatte mich daran vor allem gestört, dass jemand ernsthaft vertritt, wir bräuchten überhaupt „Digitalprominente“. Das glaube ich nicht, ich kritisiere ja schon seit Jahren die Tendenz evangelischer Öffentlichkeitsarbeit, Prominenz an Stelle des Arguments zu setzen. Es können Hunderte Prominente auf dem digitalen roten Sofa Platz nehmen, es beeindruckt mich nicht. Man kann prominent sein und dennoch etwas zu sagen haben: Sascha Lobo zähle ich dazu. Aber nicht, weil er prominent ist, sondern wegen seiner Argumente lese ich ihn regelmäßig.
Die Metapher mit der Seitenlinie finde ich entlarvend. Denn auch sie zielt auf herausgehobene Akteure. Nur, an der Seitenlinie stehen eben auch die Trainer. Man kann auch ohne Trainer und Publikum Fußball spielen, einfach so – quasi autonom. In der Regel basiert das Fußballspiel aber aus dem Zusammenwirken von Akteuren, Trainern und Publikum. Und deshalb sollte man Trainer (als solchen würde ich Huber deuten, er sich vermutlich auch, er nennt das auf seinem Account nur „Vordenker“) und auch das ja immer an der Seitenlinie versammelte Publikum nicht einfach wegwischen. In einem bin ich mit Greifenstein einig: bei den Akteuren auf dem Platz der digitalen Spiele brauchen wir andere. Die jetzigen können ja nicht einmal ihr Spiel gut spielen.
Bleibt die Frage des Respekts. Den hatte ich ja von Hubers Kritikern eingefordert. Greifenstein schreibt nun, Huber selbst sei respektlos gewesen:
Was ist daran respektvoll, wie Huber einen Satz herauszutwittern und sich dann schmollend zu wundern, dass die Gemeinten auch ge- und betroffen sind?
Aber ist das schon respektlos? Was war nun Hubers respektloser Satz? Er lautet so:
Vorsicht, Twitter-Falle: Die Kirche darf nicht denken, sie ist beständig neu, wenn sie sich digitalen Trends anschließt. Sie muss ein Ort sein, an dem sich Menschen begegnen und sich nicht durch Twittern aus dem Weg gehen.
Der Satz ist zunächst einmal überhaupt nicht respektlos, sondern nur eine Meinungsäußerung. Er macht eine Alternative auf, die ich nicht teile, die man aber vertreten kann: dass Twitter eine Ersatzhandlung oder Verdrängungshandlung gegenüber dem „wahren Leben“ ist. Ich finde dieses Argument keinesfalls respektlos. Ich hätte nur die Gegenfrage an Huber: Wo geschieht das denn? Das Argument selbst ist mir vertraut aus der Zeit der politischen Auseinandersetzung um Computerspiele und es besagte: Computerspieler vereinsamen vor dem Monitor. Aber dann stellte sich heraus, dass Computerspieler mehr lebensweltliche Kontakte haben ihre Mitmenschen und die Debatte hatte sich erledigt. Es hätte doch gereicht, zur Ehre des Twitterers, wenn man Huber auf eine entsprechende Studie hingewiesen hätte.
Aber respektlos war Hubers Vermutung zunächst nicht. Er greift ja auch niemanden unmittelbar an: Sein Kurztext enthält eine Soll-Bestimmung, die auf einer bestrittenen Behauptung basiert. Die unterstellte Behauptung lautet “Man ist neu, wenn man sich Trends anschließt“. Huber sagt nun zweierlei: das glaube er nicht und das solle man auch nicht. Nun ist das „Kirche darf nicht denken, dass ... “ selbst schon so eine Twitter-Verkürzung. Natürlich „darf“ Kirche das, ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ich glaube auch nicht, dass Twitter ein bedeutsamer Beitrag zur Erneuerung der Kirche ist – aber das behaupten wahrscheinlich/hoffentlich auch nur wenige.
Kontroverser ist vermutlich der zweite Teil des Kurztextes: Kirche „muss ein Ort sein, an dem sich Menschen begegnen und sich nicht durch Twittern aus dem Weg gehen.“ Da trickst Huber meines Erachtens, weil er mit den unterschiedlichen Konnotationen von „Kirche“ spielt. Denn die Kirche ist sowohl kein Ort wie ein Ort. Und er scheint nahezulegen, beides wäre dasselbe. Dem ist nicht so. Kirche geschieht auch außerhalb des Kirchenortes. Kirche ist überall dort, wo Menschen sich begegnen und wo Menschen glauben. Und das kann eben auch in Chats oder auf Twitter sein. Aber es kann keine Kirche nur auf Twitter geben. Wenn man das im Lichte von Luthers Auslegung des achten Gebots als Anliegen Hubers erkennt, dann wird man ihm doch folgen können. Eine Kirche, die meint, sich auf den virtuellen Raum, etwa auf Twitter beschränken zu können, und auch eine Kirche, die meint, sie sei schon durch die aufs Digitale beschränkten Handlungen vollgültige Kirche, diese Kirche wäre das Gegenteil von dem, was wir seit Jesu Zeiten unter Kirche verstanden haben. Insofern könnte man mit etwas gutem Willen Wolfgang Huber durchaus folgen und ihm dabei aufzeigen, wie beides Hand in Hand gehen kann. Aber man wollte unbedingt den Konflikt mit „dem alten Mann“. Ob man sich dabei mehr Aufmerksamkeit erhoffte oder ob man es dem mal so richtig zeigen wollte, scheint kontrovers zu deuten zu sein. Ich glaube, beides traf zu.
Kleiner Exkurs II: Twitter
Ich habe im letzten Heft auf den Konflikt hingewiesen der entsteht, wenn publizistische Organe der Kirche wie chrismon sich durch Werbung finanzieren, die zentralen Erkenntnissen der Kirche des 20. und 21. Jahrhunderts zuwiderlaufen, etwa der Bewahrung der Schöpfung. Kann man für den konziliaren Prozess eintreten, wenn man bezahlt wird von denen, die ihm entgegenarbeiten?
Etwas Ähnliches kann man nun auch im Blick auf Twitter fragen. Zunächst einmal finde ich den Satz „Auch Jesus hätte, wenn er heute auf die Welt käme, getwittert“ völlig pervers. Nichts deutet darauf hin, dass darin auch nur ein Funke von Wahrheit steckt. Und das hat zwei Gründe: zum einen, weil Jesus selbst durchaus konventionell in der Auswahl seiner medialen Kommunikation war. Er schreibt nicht, er diktiert nicht, er lässt nicht mal notieren, was ihm passiert. Er macht das, was viele Menschen seiner Zeit taten, er erzählt. Und ordnet sich damit in eine Jahrtausende alte orale Kultur ein. Jesus vollzieht Zeichenhandlungen, auch dies, wie die hebräische Bibel zeigt, durchaus im Stil der Tradition. Nicht ansatzweise ist erkennbar, dass Jesus medientechnisch innovativ ist. Das kann man mit guten Gründen im Blick auf Paulus und die junge missionarische Kirche anders sehen. Sie nutzen das römische Postsystem offenkundig intensiv. Paulus hätte vermutlich auch nicht getwittert, aber schlicht deshalb, weil er etwas zu sagen hatte. Er ist kein Sentenzen-Fabrikant. Eine Twitter-Neigung hat vielleicht das Buch der Sprüche oder das Buch Kohelet, die als Sammlung von Twitter-Sentenzen angelegt sind: „Die Ewige ehren und achten ist Anfang der Einsicht; Weisheit und Bildung verachten nur Dumme.“ (Sprüche Salomo 1,7). Aber auch diese Schriften haben eine implizite Tendenz, in der Verknappung das Falsche zu sagen: „Einem ungeliebten Kind enthält man den Prügelstock vor, einem geliebten Kind bringt man Bildung nahe.“ (Sprüche Salomo 13, 24).
Der andere Grund, warum ich meine, dass weder Jesus, noch Petrus oder Paulus Twitter genutzt hätten, liegt in der Logik von Twitter. Das hat Jens Berger auf den Nachdenkseiten angesichts des Rückzugs von Robert Habeck von Twitter treffend so formuliert:
Überflüssig zu erwähnen, dass in einem solchen Format keine ausführliche Analyse, kein hintergründiger Dialog und auch kein gepflegter Austausch von Gedanken erfolgen kann. Twitter ist schon vom Format her ein Medium, das zur Zuspitzung zwingt. Folgerichtig waren und sind es auch die „Sprücheklopfer“, die auf Twitter reüssieren und sich mit Gleichgesinnten einen schlagfertigen und oft durchaus unterhaltsamen Austausch liefern. Das ist ja alles auch ganz nett. Man sollte nur nicht der Illusion verfallen, dies hätte etwas mit der Realität „da draußen“ zu tun.
Die Narratio Jesu ist eine zwar sehr verknappte, darin aber überaus komplexe Narratio. Und sie ist eingebunden in lebensweltliche Handlungen. Und Jesus redet nicht nur mit seinen Jüngern (man könnte sagen: seiner Echokammer). Es sind lebensweltliche Handlungen, die auf den Protest von anders Denkenden und Handelnden stoßen und in der Auseinandersetzung darüber greift Jesus auf kurze Erzählungen zurück. Das unterscheidet ihn von Twitter-Diskursen:
Auch wenn Twitter pro forma ein offenes Medium ist, spielen sich die Dialoge … der Plattform zuallermeist in einem überschaubaren Kreis ab. Man polemisiert vornehmlich mit seiner Echokammer. Erstaunlicherweise merken die Beteiligten dies oft gar nicht und verwechseln ihre virtuelle Kommunikation mit einigen wenigen Mitgliedern … mit der realen Kommunikation mit realen Menschen …
schreibt Jens Berger auf den Nachdenkseiten. Und auch er ist ein Kritiker, der das Medium durchaus nutzt – aber auch seine Grenzen kennt.
Ähnliches ließe sich auch für WhatsApp skizzieren. Auch muss man fragen, inwiefern diese App für den kirchlichen Gebrauch „theologisch“ zu rechtfertigen ist. Theologisch problematisch ist daran, dass man mit der Nutzung der App geradezu zwangsweise in die Menschenrechte Unbeteiligter eingreift. Ich habe WhatsApp nie genutzt, dennoch verfügt die App und der dahinterstehende Konzern über alle meine Kontaktdaten, da alle meine Freunde, die WhatsApp nutzen, dem Konzern ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen. Daraus kann WhatsApp viel über mich erkennen, ohne dass ich mich dagegen wehren kann.
 Umgekehrt empfiehlt WhatsApp seinen Nutzern, wenn sie nicht wollen, dass WhatsApp mich erfasst, dann sollen sie mich doch einfach aus ihrem Telefonbuch löschen. Ich halte das für vollständig inkompatibel mit all dem, was theologische Ethik heißt. Umgekehrt empfiehlt WhatsApp seinen Nutzern, wenn sie nicht wollen, dass WhatsApp mich erfasst, dann sollen sie mich doch einfach aus ihrem Telefonbuch löschen. Ich halte das für vollständig inkompatibel mit all dem, was theologische Ethik heißt.
Zugleich, darauf verweisen Analysen auf Klicksafe und anderen Seiten, ist WhatsApp zum wirkungsmächtigsten schulischen Medium für Ausgrenzung und Mobbing geworden. Lehrerinnen und Lehrer sind permanent damit konfrontiert, dass Schülerinnen und Schüler über WhatsApp ausgegrenzt werden. Da will der Einsatz dieses Mediums (ganz angesehen von datenschutzrechtlichen Gründen) durchaus auch ethisch und theologisch reflektiert werden.
Zum Abschluss: (K)ein Troll
Ich will den Text abschließen mit einer kleinen Bemerkung zum verwendeten Begriff Troll. Dieser wird in der populärwissenschaftlichen Wikipedia so charakterisiert:
Als Troll wird bezeichnet, wer absichtlich Gespräche innerhalb einer Online-Community stört. Die Provokationen sind in der Regel unterschwellig und ohne echte Beleidigungen. Auf diese Weise vermeiden oder verzögern Trolle ihren Ausschluss aus administrierten Foren. Nach Judith Donath ist das Trollen für den Autor ein Spiel, in welchem das einzige Ziel das Erregen von möglichst erbosten und unsachlichen Antworten ist.
Das Wort Troll macht demnach nur Sinn, wenn die Störung der Community-Kommunikation nicht nur intendiert, sondern das primäre Ziel ist. Das war bei Wolfgang Huber erkennbar nicht der Fall. Er war eher erschrocken über die aggressiven Reaktionen. Alternativ könnte man nun sagen, aber er wirkte auf mich wie ein Troll. Dann liegt das aber an den Antwortenden, die ihn mit einem solchen verwechselten. Vermutlich hat Wolfgang Huber tatsächlich die kirchliche Online-Community gestört. Gott sei Dank – könnte man sagen. Diese erhoffte nun, in der Reibung mit dem als Troll nur Etikettierten, mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Diese hat die Community bekommen, begrenzt auf ihre kleine Ghettowelt, aber immerhin. Ich fürchte nur, das geschah zu ihrem eigenen Schaden. Nicht wegen der Machtfrage, nicht weil die Unbelehrbaren unbelehrbar bleiben, sondern weil nun die Gutwilligen von solchen Umgangsformen verstört sind. Zu diesen Gutwilligen und nun Verstörten zähle ich mich selbst. Ich habe in dieser Debatte gelernt:
- Die alte Diastase von Pfarrern und Gemeindegliedern im Sinne von Hirten und Schafen existiert immer noch – zumindest in den Köpfen mancher Pfarrer
- Was christlicher Umgang ist und was nicht, wird weiterhin von Funktionären festgelegt.
- Wer sich zu Twitter kritisch äußert, muss damit rechnen, als Troll bezeichnet zu werden.
- Theologie gehört nicht mehr zu den Grundlagen eines Pfarrers, sondern kann eine von vielen anderen denkbaren Vorlieben sein.
- Theologische Argumente einzufordern, ist eine Zumutung und eine Form der Rechthaberei.
- Mehr als 14.000 Zeichen ergeben einen Roman.
Und so schließe ich nun für mich nun dieses Kapitel. Jede Analyse eines Kunstwerks, jede Lektüre eines Werks der Literatur, jeder Besuch einer Ausstellung, jedes Musikstück bringt mir mehr, als diese Debatte jemals einbringen könnte. Sie war und ist demotivierend. Im Augenblick kann ich überhaupt nicht mehr erkennen, was die so propagierte „Kirche digital“ den Gemeinden und auch Kirchenmitgliedern wie mir an Vorteilen bringt. Warum sollte ich mich dann für sie einsetzen? Und so bleibe ich dabei: das jedenfalls kann Digitalisierung nicht heißen.
|

