
Paris II / CONTAINER |
Wang-luns Konzeption eines guten LebensZu Alfred Döblins Roman Die drei Sprünge des Wang-lunBurckhard Dücker 1. Einleitung
Schon die Erwähnung der formativen Konfliktkonstellation im ersten Satz des Romans kann auf dessen universalen Geltungsanspruch hinweisen. „Auf den Bergen Tschi-lis, in den Ebenen, unter dem alles duldenden Himmel saßen die, gegen welche die Panzer und Pfeile des Kaisers Khien-lung gerüstet wurden. Die durch die Städte zogen, sich über die Marktflecken und Dörfer verbreiteten“.[7] Dem Erzähler reicht die komplexitätsreduzierte Form der komplementären Kontrastierung von – scheinbar – Opfern und Tätern, um die Sozialdiagnose einer in Machtelite und rechtlose Mehrheit geteilten Gesellschaft zu stellen, die er dann mit der wenig differenzierenden Denk- und Argumentationsfigur des ‘entweder oder‘ entfaltet. Diesen Dualismus versucht Wang-lun durch die Gründung einer interessenfundierten Sammlungsbewegung der Benachteiligten aufzulösen; eine komplexitätssteigernde dritte Ebene in Form einer handlungstheoretischen und -praktischen politischen Konzeption[8] eines neuen als des guten, rechten Lebens soll dies ermöglichen. Deren Struktur, Ausrichtung und Funktion werden prioritär in diesem Beitrag untersucht. 2. Wang-luns politische Konzeption eines neuen Lebens2.1 Zum allgemeinen Rahmen
Wang setzt „in den Gestrandeten, viel Erfahrenen das tiefe Grundgefühl [frei]: ‘Die Welt erobern wollen durch Handeln, mißlingt. Die Welt ist von geistiger Art, man soll nicht an ihr rühren. Wer handelt, verliert sie; wer festhält, verliert sie.’ Wang bot ihnen ein heimatliches Gefühl. Sie hingen ihm auf ihre Art an, besorgten sich um ihn brüderlich, um den Stärksten unter ihnen fast mütterlich“.[15] Dafür gibt er ihnen Gelegenheit, sich als sozial nützlich zu erfahren; was ihren Fähigkeiten nicht entspricht, verlangt er nicht und bestätigt damit, was sie können. Mit diesem Verfahren reziproker Anerkennung »erlangte Wang über die hundert Männer die Gewalt, die ihm die Rolle des Bandenführers aufnötigte«.[16] Aus der genauen Beobachtung ihres Verhaltens, ihrer Erwartungen, Wünsche, Abwehrhaltungen erkennt er als fundamentale Frage jedes Einzelnen ’Wie soll ich leben?’. So wie bisher kann es nicht mehr weiter gehen, wie kann ich anders leben, was ist das Beste für uns? Auf diese Frage geht Wang ein, indem er vor allem zwei Erwartungen bestätigt: Erstens die Möglichkeit einer neuen, reflexionsbasierten Organisation des Lebens bei tendenzieller Befreiung vom ständigen Kampf jedes Einzelnen ums physische Überleben, zweitens die Gewissheit, dass das neue Leben nur als gemeinschaftliches unter Führung Wangs möglich ist. Allerdings sind Richtungskämpfe nicht auszuschließen. Damit scheint die Lebensfrage nicht nur ihre Form, sondern auch ihren Geltungsanspruch ändern zu müssen: „Wie können wir als Wesen mit dieser existentiellen Struktur in einer Welt mit dieser Struktur möglichst gut leben?“.[17] Wang beantwortet die Bereitschaft zur Veränderung, indem er speziell für diese Gruppe – zeit-, orts-, adressatenspezifisch – eine Konzeption des guten Lebens entwickelt, deren Praktiken er unmittelbar aus Bedingungen und Bedürfnissen ihrer Lebenssituation ableitet. Er legt ihnen scheinbar ihre eigenen Wünsche zur Entscheidung vor, aber in seiner Deutung. 2.2 Rahmenkomponenten der politischen Konzeption Wangs
Zugleich erklärt diese theoretische Ausrichtung die adverbiale Spezifizierung ‘Wahrhaft’ im Namen der Bewegung; verweist diese Kennzeichnung doch auf die reflexiv gewordene, traditionelle soziale Verortung und deren Ersetzung durch eine neue auf der Grundlage des Bekenntnisses zu dem, was man ist und kann. Mit ihrer Präsentation als Ausgestoßene repräsentieren die Wahrhaft Schwachen ihre Programmatik der Transformation, während die Schwachen weiterhin ohne Wissen um das Veränderungspotential ihrer sozialen Position und für die Zentralmacht unauffällig und ungefährlich bleiben. Als zweite Rahmenkomponente folgt daraus, den Wahrhaft Schwachen ein aktives Bewusstsein ihres sozialen Orts zu vermitteln, um die Binnenintegration der Bewegung zu erhöhen und die Außenabgrenzung zu profilieren. Genau diesen sozialen Ort scheint das Zitat von Liä Dsi in der Zueignung zu definieren: „Wir gehen und wissen nicht wohin. Wir bleiben und wissen nicht wo. Wir essen und wissen nicht warum. Das alles ist die starke Lebenskraft von Himmel und Erde: wer kann da sprechen von Gewinnen, Besitzen?“.[20] ’Haben‘ ist angesichts der ’Seins-‘ und Sinnfrage bedeutungslos. Wenn man seinen sozialen Ort kennt, kann man ‘sich machen’. Gerade dieses Wissen, das Wang den Wahrhaft Schwachen vermittelt, schließt die Selbstwahrnehmung als Subjekt ‘ich/ wir’ ein, womit immer schon die Referenz auf einen sozialen Partner ’du /ihr‘ verbunden ist. Wenn aus dem Zusammenspiel von negativer Funktionsangabe 'nicht wissen‘ bei gleichwohl fraglos ausgeführten Lebensbewegungen die Sinnfrage des Lebens auftaucht, erhält eine Übergangsphase zwischen einem Anfang und dem darin angelegten Ziel Relief.
Wang bereitet die Akzeptanz seiner Konzeption durch eine als Bekenntnis angelegte Schwellensituation vor: Alle Interessenten müssen den Schritt in die Bewegung aus eigenem Antrieb vollziehen und können ebenso frei die Bewegung wieder verlassen. Alle Mitglieder haben das Recht auf Teilhabe an Meinungsbildungsprozessen und Entscheidungen. Damit erhalten schon die vorbereitenden Diskussionen performative Funktion, indem sie die Wirklichkeit tendenziell herstellen, die sie sprachlich entwerfen. Auch bewirkt das Verfahren, die Mitglieder in den Aushandlungsprozess der Bewegung einzubinden, deren enge Bindung an die gemeinsam ausgehandelten Regeln und entspricht einem juristischen Phänomen: „Dieser Gesprächsprozess erzeugt Normen. Im Völkerrecht gibt es den Begriff des ’Soft Law‘, des weichen, gerade entstehenden Rechts“ (R.Merkel).[24] Nach Angriffen von Soldaten auf die Vagabunden, die dadurch als Einheit bestätigt werden, beginnt Wang – zunächst nur zu seinen beiden Vertrauten – appellativ zu argumentieren. „Sag selbst, Chu, Ma-noh, wir müssen mit unserer Sprache herauskommen«.[25] Darauf hebt Chu in seiner Rede die Macht- und Besitzgier der „Herren“ ebenso als Leidfaktor der Vagabunden hervor wie die fremde, nicht-chinesische „Reine Dynastie“ der „Mandschus, [der] harten Tataren, die aus ihren nördlichen Bergen geradewegs von der Fuchsjagd über unser schwaches Land hergefallen sind«, die als Fremde die Chinesen nicht als Menschen anerkannt haben und erwähnt als mögliche Verbündete die systemkritische Geheimgesellschaft der „Weißen Wasserlilie“.[26] Mit dieser Rede, die den Vagabunden „einen Feind“ präsentiert, was sie „glückselig in ihrem schäumenden Haß“[27] macht, bereitet Chu Wangs formelle Gründung der Bewegung der Wahrhaft Schwachen vor. Wang zentriert seine Ausführungen auf den normativen Satz, „daß nur eins hilft gegen das Schicksal: nicht widerstreben. Ein Frosch kann keinen Storch verschlingen.“ Obwohl er die Welt anerkennt, wie sie ist, bekennt er sich zur Abkehr von der Gewaltspirale:
Auf Chus Bitte: „Du mußt uns führen Wang. Tu wie du willst.“ bekräftigt dieser seinen Autoritätsanspruch:
Das Wu-wei kann den Weg in die Aporie der Gewaltanwendung nicht ausschließen, sobald die Institutionen der Macht beginnen, gegen die Bewegung vorzugehen. Für diesen Fall sieht Wang die Alternative, der Programmatik treu zu bleiben und „Selbstmörder“ zu sein oder zur Notwehr unter dem Signum des ’gerechten Krieges‘ bzw. Widerstands zu greifen, was auf aktuelle Diskussionen in Deutschland anspielen mag. „Der Kaiser, sag ich, ist ein Einbrecher. Der Kaiser Khien-lung hat kein Recht, gegen uns Edikte zu erlassen. […] Er ist ein Henker und kein Schicksal. […] Es – ist – uns – nicht – beschieden –, Wahrhaft Schwache zu sein, – es ist – uns – nicht beschieden“.[34] In „Notizen zu Vorträgen über sein Werk aus der Zeit des Pariser Exils“ scheint Döblin dieses Dilemma des erzwungenen Übergangs zur Gewaltanwendung gesehen zu haben. „Die taoist[ischen] Wahrhaft Schwachen wollen sich vom Staat zurückziehen, das bedeutet Aushöhlung, der Staat wehrt sich, sie werden zerschmettert“.[35] Gescheitert ist damit das Wu-wei bzw. – auf die Situation in Deutschland bezogen – der „Pazifismus als Gesellschaftsdoktrin“.[36] Auch wenn die Diagnose der zitierten Rezension über die Wahrhaft Schwachen zutreffen mag: „Sie haben kein Programm und keine Lehre“,[37] so ist gerade das ihr Programm, das auf eine zeitlich offene Übergangsphase mit flexiblen, je situativen Entscheidungen zugeschnitten und durch Routine nicht zu entlasten ist. Hier scheint es um einen – von Döblin nicht explizierten – temporalen Heimatbegriff zu gehen: Heimat besteht so lange, wie die Übergangsphase (Unterwegssein) akzeptiert wird. Als parallele Denkbewegung gehört zum Sezessionismus dauernde Selbstreflexion, was Wangs Position dient. 2.2 Praktiken und Merkmale des guten LebensUm die für die Wahrhaft Schwachen ungewohnte Lebensform zu konsolidieren, ’übersetzt‘ Wang die Maxime vom nicht handeln in konkrete Praktiken:
Auch betreibt Wang keine Erinnerungspolitik, legt keine Erinnerungsorte an, verzichtet auf ein stationäres Zentrum als Hauptquartier und lässt keine Geschichte der Bewegung schreiben. Im Gegensatz zu Wang, der keine Tradition erfindet, betreibt der Kaiser nach seinem Sieg Erinnerungspolitik, indem er Wangs Heimatdorf zerstören, die Leichen der Eltern ausgraben und zerstückeln sowie die Dorfbewohner und die Angehörigen der identifizierten Brüder und Schwestern vertreiben lässt. Um Nachfolgeorganisationen zu verhindern, soll ein Kult um Wang-lun nicht entstehen. Weil diese Maßnahmen von der Hofgeschichte überliefert werden, sichern sie die Erinnerung Wangs. Zentral für die Bewegung sind die Merkmale Solidarität – wechselseitiger Schutz – und grundsätzlicher Gewaltverzicht als Umsetzung der Komponente des Pazifismus, so dass die Gewaltspirale durch die Absage an Racheakte unterbrochen werden kann. Zur Praxis der Gewaltfreiheit der Wahrhaft Schwachen hat Döblin die um die Jahrhundertwende in Deutschland in Tier- und Naturschutzprogrammen, bei Vegetariern und Lebensreformern aktuelle Forderung „der möglichsten Schonung für alles Lebendige“[41] aufgenommen.[42] Wangs Konzeption, die sich für die Vagabunden zu den einfachen Geboten verdichtet, „sie sollten verzeihen, niemandem wehtun: das sollte die ganze Wirrnis lichten“, versetzt sie in starke Emotionen: „Es gab unter ihnen einige ältere, die sich umarmten, […] die Verzückung befiel sie, wo sie Brüder, schwache hilfsbedürftige Brüder schlimmer Vagabunden sein durften“.[43] Theoretische Basis von Wangs Erfolg scheint eine Philosophie der Möglichkeit und Andersheit zu sein, die er den „Brüdern“ in für sie bisher unverfügbaren Denkfiguren und Praxisanweisungen vermittelt. Alles könnte auch anders sein je nach Zufällen, Konflikten, retardierenden Elementen, Interessen und Perspektiven der auftretenden Personen, die der Erzähler Wang im Erzählprozess zu integrieren hat. Während Wangs Aufenthalt bei der Weißen Wasserlilie sollten sie seine Ge- und Verbote genau befolgen, keine aktive Mitgliederwerbung betreiben, aber auch keinen Interessenten zurückweisen. Während Wangs Abwesenheit übernimmt Ma-noh die Führung, so dass kein Zuwachs an Eigeninitiative der Mitglieder entsteht. Auch der Verstoß gegen das Keuschheitsgebot geht auf Ma-noh zurück, der die Befriedigung sexueller Triebe als Konsequenz des Wu-wei rechtfertigt. Viele Mitglieder folgen seiner Auslegung. Die ’heilige Prostitution‘ hebt tendenziell die Gleichstellung der ’Schwestern‘ auf.
Mit der Anspruchslosigkeit verbunden ist die Verpflichtung zu Besitzlosigkeit und Armut, um Konflikte aus Neid, Eifersucht, Arroganz, Elitebewusstsein auszuschließen. Für wohlhabende Interessenten wie Ngoh wird der Verkauf ihres Besitzes zugunsten der Bewegung Voraussetzung ihrer Zulassung. Ob die Armutsverpflichtung auf Dauer durchgehalten werden kann und ob sie neue Sozial- und Sichtbarkeitsformen generiert, bleibt wegen des kurzen Bestehens der Bewegung offen. Insgesamt wird die Bewegung durch das Bewusstsein jedes Einzelnen gesichert, dass vom je individuellen Verhalten unmittelbar die Kontinuität des Ganzen abhängt. Dafür können sie sich darauf verlassen, im Bedarfsfall Hilfe, Schutz, Ansprechpartner, auch Zuwendung und Aufmerksamkeit bei Wang selbst zu finden, nur mit Aufgaben konfrontiert zu sein, die ihren Fähigkeiten angemessen sind, weder Fremdbestimmung noch Angst erleiden zu müssen, Recht und Gelegenheit zur Empfindung von Freude und Glück zu haben, eigenes Leid mildern zu können, indem sie es anderen mitteilen. Ein wesentlicher Integrationsfaktor der Bewegung ist die Gelegenheit, die Wang jedem einräumt, sich erzählend machen und präsentieren zu können. Erzählt wird, wie und warum sich die Einzelnen von ihrer sozialen Herkunft (z.B. Familie, Beruf, fremdbestimmte Lebensperspektive) getrennt und für die – zunächst – fremde Lebensform der Wahrhaft Schwachen entschieden haben. Dies verschafft ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben die Gelegenheit narrativer Sinnkonstitution, indem sie ihre Lebensgeschichte von einem selbst bestimmten Anfang zum darin angelegten, notwendig zu erreichenden Ende, d.h. bis zum Anfang ihres neuen Lebens bei den Wahrhaft Schwachen erzählen. So werden die Ausgegrenzten privilegiert als Subjekte eines narrativen Prozesses, dessen Verlauf und Relief sie selbst bestimmen. Ihre Erzählung der eigenen Lebensgeschichte von einer Ursache zu einer dadurch determinierten Wirkung ergibt einen sinnstiftenden Prozess. Aus den gesammelten Narrativen defizitärer gesellschaftlicher Verhältnisse entwirft Wang Programmatik und Praktiken sozialer Transformation am Leitkonzept des Wu-wei, womit er ins Narrativ der Zentralmacht eingreift und Geschichte macht. Es ist davon auszugehen, dass Döblin mit dieser Privilegierung der Narration die kultur- und geschichtsbildende Funktion literarischer Weltauslegungsangebote – nicht zuletzt seiner eigenen – hervorheben wollte. Anmerkungen[1] Jochen Meyer, Katalog Alfred Döblin 1878-1978. Marbach 1978, S. 20: „S. Fischer […] beginnt mit kriegsbedingter Verzögerung am 23. März [1916] die Auslieferung des Romans (mit der gedruckten Jahresangabe 1915).“ Schon im Erscheinungsjahr erhält Döblin für den Roman den Fontanepreis, was er am 16.09.1916 an Herwarth Walden berichtet. Alfred Döblin, Briefe, hg. von Walter Muschg / Heinz Graber. Olten / Freiburg i. B. 1970, S. 90: „Neulich habe ich den ’Fontanepreis‘ für den Wangl[un] bekommen. [...] Übrigens sind 600 M nicht viel, vielleicht ist das bischen Erwähnen mehr wert. Ich weiß es nicht.“ Am 05.06.1920 schreibt Döblin an Albert Ehrenstein: „Wang-lun geht in 6.-8. Auflage“ (Alfred Döblin, ebenda, S. 114). Vgl. Autobiographische Skizze vom 01.04.1922 in: Alfred Döblin, Schriften zu Leben und Werk, hg. von Erich Kleinschmidt. Olten / Freiburg 1986, S. 36: „1911 wurde ich aus dieser Tätigkeit [Klinik] gerissen, mußte in die mich erst fürchterlich abstoßende Tagespraxis. Von da ab Durchbruch oder Ausbruch literarischer Produktivität. Es war fast ein Dammbruch; der im Original erst fast zweibändige Wang-lun wurde samt Vorarbeiten in acht Monaten geschrieben, überall geschrieben, geströmt, auf der Hochbahn, in der Unfallstation bei Nachtwachen, zwischen zwei Konsultationen, auf der Treppe beim Krankenbesuch; fertig Mai 1913.“ Im Brief an Winifred Ferris vom 27.07.1951 bestätigt Döblin die Schwellenfunktion des Romans. Der „Anlauf- und Frühperiode folgte die zweite, beginnend mit dem Wang-lun, die großen Romane, genauer gesagt, epische Werke in Prosa.“ In: Alfred Döblin, Briefe II, hg. von Helmut F. Pfanner. Düsseldorf / Zürich 2001, S. 390. [2] Ira Lorf, Maskenspiele. Wissen und kulturelle Muster in Alfred Döblins Romanen Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine und Die drei Sprünge des Wang-lun. Bielefeld 1999, S. 223ff.; Yuan Tan, Der Chinese in der deutschen Literatur. Unter besonderer Berücksichtigung chinesischer Figuren in den Werken von Schiller, Döblin und Brecht. Göttingen 2007, S.129: „ . . . ist Wang-lun nicht mehr nur ein historischer Roman, er ist ein zeitaktueller Text für die Europäer.“ [3] Vgl. „The Insurrection of Wang Lun in 1774“ in: J.J.M. de Groot: Sectarianism and Religious Persecution in China. A page in the history of religions. Vol II. Amsterdam 1904, S. 296-306. [4] Alfred Döblin, Der Bau des epischen Werks, in: ders., Aufsätze zur Literatur, hg. von Walter Muschg. Olten / Freiburg 1963, S. 106. [5] Alfred Döblin, Briefe, hg. von Walter Muschg. Olten / Freiburg 1970, S. 656. [6] Helmut Kiesel, Alfred Döblins „chinesischer“ Roman Die drei Sprünge des Wang-lun, in: Deutsch-chinesische Literaturbeziehungen, hg. von Wei Maoping und Wilhelm Kühlmann in Zusammenarbeit mit Roman Luckscheiter. Shanghai 2006, S. 204. Vgl. Qixuan Yu, Ein deutscher Traum von taoistischem „Nichthandeln“. Zeitkritik und Wu-Wei-Rezeption in Alfred Döblins chinesischem Roman Die drei Sprünge des Wang-lun. Magisterarbeit Fremdsprachenhochschule Beijing 1985. Vgl. Weijian Liu, Die daoistische Philosophie im Werk von Hesse, Döblin und Brecht. Bochum 1991, S. 96-99. Yuan Tan, a.a.O., S. 101: „Die Wahrhaft Schwachen sind in der Tat nichts anderes als Döblins arme Patienten und die in Not und Elend lebenden deutschen Arbeiter, die er persönlich kannte.“ [7] Alfred Döblin, Die drei Sprünge des Wang-lun. Chinesischer Roman, hg. von Gabriele Sander und Andreas Solbach. Düsseldorf 2007, S. 11. [8] Yuan Tan, a.a.O., S. 108: Döblin verwandelt „die taoistische Wu-wei-Lehre in eine verfügbare politische Konzeption und weist auf ihren Verwirklichungsweg hin.“ [9] Ebenda, S. 45. [10] Martha C. Nussbaum, Der aristotelische Sozialdemokratismus, in: dies., Gerechtigkeit oder Das gute Leben. Gender Studies. Frankfurt a. M. 1999, S. 45. [11] Vgl. Marcel Mauss, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Frankfurt a. M. 1990. [Essai sur le don, 1923/24] [12] Alfred Döblin, Wang-lun, S. 101. [13] Vgl. Burckhard Dücker, Literaturpreise und -wettbewerbe im deutsch- und englischsprachigen Raum, in: Handbuch Kanon und Wertung, hg. von Gabriele Rippl und Simone Winko. Stuttgart / Weimar 2013, S. 218. [14] Alfred Döblin, Wang-lun, S. 48f. [15] Ebenda, S. 49. [16] Ebenda, S. 59. [17] Ursula Wolf, Zur Struktur der Frage nach dem guten Leben, in: Holmer Steinfath (Hg.), Was ist ein gutes Leben? Philosophische Reflexionen. Frankfurt a. M. 1998, S. 41. [18] Alfred Döblin, Wang-lun, S. 60. [19] Vgl. Erich Fromm, Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. München 71980, S. 27. [1976] [20] Alfred Döblin, Wang-lun, S. 8. [21] Ebenda, S. 85. [22] Ira Lorf, a.a.O., S. 220 sieht die Gleichheit aller als Zeichen eines „Übergangsrituals“. [23] Vgl. Arnold van Gennep, Übergangsriten. (Les rites de passage), aus dem Französischen von Klaus Schomburg und Sylvia M. Schomburg-Scherff. Frankfurt a. M. / New York 1999. [24] Katarina Barley / Reinhard Merkel, „Brandgefährlich“ „Bodenlos naiv“, Streitgespräch. Interview: Daniel Brössler / Detlef Esslinger, in: SZ Nr. 283, 8./9.12.2018, S. 6. [25] Alfred Döblin, Wang-lun, S. 71. [26] Ebenda, S. 79. [27] Ebenda, S. 80. [28] Ebenda, S. 81f. [29] Ebenda, S. 82. [30] Ebenda, S. 414f.: „Du [Ngoh] kannst dich entscheiden, wofür du willst. Ich will keine Menschen sehen, die nicht Vertrauen zu mir haben. Ich will dich gar nicht; es kommt nicht an auf einen Menschen. Will mir abzwingen, weiß ich was. […] Aber kein Vertrauen. Nein, keine Spur von Vertrauen. Was hab ich euch gegeben; unbesiegbar hab ich euch gemacht; gerettet seid ihr worden aus –. Aber nichts, wenn ich einmal komme, als weiße Wände, Holzstücke. Fragen, warum, warum, warum? Es genügt nicht, daß ich komme und sage, so und so und so; es muß auch bar auf den Käsch bezahlt werden, begründet von fünf Seiten, daß nur nichts verloren geht.“ [31] Ebenda, S. 26. [32] H. Wetzel, Berliner Börsen-Courier (Morgenausgabe) vom 14.5.1916, in: Ingrid Schuster, Ingrid Bode (Hg.), Alfred Döblin im Spiegel der zeitgenössischen Kritik. Bern / München 1973, S. 27. [33] Walter Muschg, Nachwort, in: Alfred Döblin, Die drei Sprünge des Wang-lun. Ein chinesischer Roman. Jubiläums-Sonderausgabe. Olten / Freiburg i. B. 1977, S. 488: „Der wahre Held des Buches ist nicht er [Wang-lun], sondern sein Bund der Wahrhaft Schwachen. Diese Geschichte eines Heiligen ist Döblins erste Dichtung mit einem kollektiven Helden.“ Vgl. auch Brigitte Bergheim, Das gesellschaftliche Individuum. Untersuchungen zum modernen deutschen Roman. Tübingen / Basel 2001, S. 78 heißt es, „daß die Massenbewegung tatsächlich der kollektive Held des Romans ist.“ [34] Alfred Döblin, Wang-lun S. 415f. [35] Alfred Döblin, Schriften zu Leben und Werk, hg. von Erich Kleinschmidt. Olten / Freiburg i. B. 1986, S. 222. [36] Markus Joch, Der Platz des irdischen Friedens. Sommer 1912: Alfred Döblin beginnt die Arbeit am Wang-Lun, in: Alexander Honold / Klaus R. Scherpe (Hg.), Mit Deutschland um die Welt. Eine Kulturgeschichte des Fremden in der Kolonialzeit. Stuttgart / Weimar 2004, S. 417. Für den Pazifismus-Diskurs ist zu erinnern an den Aufsehen erregenden ’Fall‘ Muehlon, einen pazifistisch orientierten Krupp-Direktor, der bei Kriegsbeginn seine Stelle aufgab. Vgl. Wilhelm Muehlon, Ein Fremder im eigenen Land. Erinnerungen und Tagebuchaufzeichnungen eines Krupp-Direktors 1908-1914, hg. von Wolfgang Benz. Bremen 1989. [37] H. Wetzel, a.a.O., S. 26. [38] Alfred Döblin, Wang-lun, S. 85. [39] Rudolf Otto, Das Heilige. München 1991 [1917], S. 42. [40] Alfred Döblin, Wang-lun, S. 85. [41] Christian Wagner, Neuer Glaube, hg. von Harald Hepfer. Warmbronn 2013 [1894], S. 35. Zum “Pflanzenschutz“ heißt es S. 54: „Empörend und schmerzlich ist es, so viele gedankenlos abgerissene Blumen längs den Pfaden sehen zu müssen.“ Vgl. Ernst Rudorff, Heimatschutz. Leipzig / Berlin 1901, der der Industrialisierung „zahllose[] Grausamkeiten gegen die Natur“ (S. 36) vorwirft und sogar von „Verbrechen an der Menschheit“ (S.42) spricht. [42] Alfred Döblin, Wang-lun, z.B. S. 11: „Viele aßen kein Fleisch, brachen keine Blumen um, schienen Freundschaft mit den Pflanzen, Tieren und Steinen zu halten.“ [43] Ebenda, S. 86f. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/121/bd02.htm |
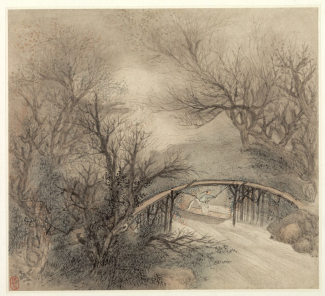 Alfred Döblin (1878-1957) erreicht seine endgültige Positionierung im ’literarischen Feld‘ (Pierre Bourdieu) durch seinen „chinesischen Roman“ – so der Untertitel – Die drei Sprünge des Wang-lun.
Alfred Döblin (1878-1957) erreicht seine endgültige Positionierung im ’literarischen Feld‘ (Pierre Bourdieu) durch seinen „chinesischen Roman“ – so der Untertitel – Die drei Sprünge des Wang-lun. Schon bei der frühen Begegnung des in die Berge geflüchteten Mörders Wang-lun, der den Tod seines Freundes Su-koh am dafür verantwortlichen Offizier gerächt und durch diese Tat gegen „die Arroganz der Macht“ (J. William Fulbright) seine subjektive Ordnung wieder hergestellt hat, mit dort lebenden „Vagabunden“, zeigt sich, dass diese eine Kooperation mit Wang wünschen, nicht aber den Erwerb von Besitz und Reichtum anstreben. „Sie wußten von der Tat Wangs, waren stolz, daß er zu ihnen zurückkehrte“
Schon bei der frühen Begegnung des in die Berge geflüchteten Mörders Wang-lun, der den Tod seines Freundes Su-koh am dafür verantwortlichen Offizier gerächt und durch diese Tat gegen „die Arroganz der Macht“ (J. William Fulbright) seine subjektive Ordnung wieder hergestellt hat, mit dort lebenden „Vagabunden“, zeigt sich, dass diese eine Kooperation mit Wang wünschen, nicht aber den Erwerb von Besitz und Reichtum anstreben. „Sie wußten von der Tat Wangs, waren stolz, daß er zu ihnen zurückkehrte“ Mit intensiver Aufmerksamkeit wendet Wang sich den Worten jedes Einzelnen zu. Wem es an Perspektiven der Lebensplanung, Rechts- und Orientierungssicherheit, Modernisierung traditioneller Normen, Zulassung sozialer Innovation fehlt, wem die soziale Ordnung insgesamt wegen ihrer Statik und Privilegierung der Eliten als Unordnung erscheint, dem bietet Wang mit der Bewegung der Wahrhaft Schwachen eine Ordnung der Dynamik und Teilhabe aller an. Fundiert ist deren Andersheit auf den programmatischen Verzicht auf jedes Handeln, das die bestehende Ordnung stützt – kein Gabentausch mit der Macht – und auf die horizontale Struktur – Gleichheit – aller Mitglieder. Vorgesehen ist eine Ordnung, die nicht auf extern vorgegebene Leistungsnormen, Besitz und Herkunft setzt, sondern auf die von Wang verkörperte Hoffnungsgewissheit, dass neue Gemeinschaft entstehen werde aus Selbstbestimmung, Solidarität und wechselseitiger Anerkennung. Die enorme Anziehungskraft der Wahrhaft Schwachen unter Wangs Führung zeigt, dass ein Typus wie er längst erwartet wurde, dass eine entsprechende Disposition latent in weiten Teilen der Bevölkerung ausgebildet war.
Mit intensiver Aufmerksamkeit wendet Wang sich den Worten jedes Einzelnen zu. Wem es an Perspektiven der Lebensplanung, Rechts- und Orientierungssicherheit, Modernisierung traditioneller Normen, Zulassung sozialer Innovation fehlt, wem die soziale Ordnung insgesamt wegen ihrer Statik und Privilegierung der Eliten als Unordnung erscheint, dem bietet Wang mit der Bewegung der Wahrhaft Schwachen eine Ordnung der Dynamik und Teilhabe aller an. Fundiert ist deren Andersheit auf den programmatischen Verzicht auf jedes Handeln, das die bestehende Ordnung stützt – kein Gabentausch mit der Macht – und auf die horizontale Struktur – Gleichheit – aller Mitglieder. Vorgesehen ist eine Ordnung, die nicht auf extern vorgegebene Leistungsnormen, Besitz und Herkunft setzt, sondern auf die von Wang verkörperte Hoffnungsgewissheit, dass neue Gemeinschaft entstehen werde aus Selbstbestimmung, Solidarität und wechselseitiger Anerkennung. Die enorme Anziehungskraft der Wahrhaft Schwachen unter Wangs Führung zeigt, dass ein Typus wie er längst erwartet wurde, dass eine entsprechende Disposition latent in weiten Teilen der Bevölkerung ausgebildet war. Wangs Konzeption, die jene Rahmenkomponenten umfasst, die es den Einzelnen erlauben sollen, ein gutes als selbstbestimmtes und rechtes Leben zu führen, gilt als politisch, weil sie die Deutungshoheit der kaiserlichen Zentralmacht tendenziell aufhebt, weil sie einen Wertewandel impliziert, der die herrschenden Normen negiert und staatliche Strukturen ändert. Zu den Rahmenkomponenten gehört zunächst die aktive Akzeptanz der Situation. Was die Vagabunden sind, nämlich Ausgegrenzte, Ausgestoßene, Rechtlose und was ihnen von der Macht als selbst verschuldete Schwäche, Unmoral, Verworfenheit, Armut vorgeworfen wird, bestätigt Wang gerade als ihre Fähigkeiten, Stärken und Basis ihres legitimen Selbstbilds, woraus sich Konsequenzen für ihre Vorstellung davon, wie sie leben wollen, ergeben. Ebenso wie die Gegenseite Privilegien und Legitimität ihrer Position mit ihrer Macht, ihrer Teilhabe an kultureller Tradition und ihrem Reichtum begründet, so die Vagabunden ihre Stärke aus ihrer faktischen Macht-, Besitz- und Rechtlosigkeit. Daher argumentiert Wang zunächst deskriptiv, indem er ihnen sagt, »daß sie arme ausgestoßene Menschen seien. Daß man ihnen nichts tun dürfe, wie sie selbst keinem etwas täten. Daß nichts schrecklicher sei, als wenn Menschen sich töteten, und der Anblick nicht zu ertragen«.
Wangs Konzeption, die jene Rahmenkomponenten umfasst, die es den Einzelnen erlauben sollen, ein gutes als selbstbestimmtes und rechtes Leben zu führen, gilt als politisch, weil sie die Deutungshoheit der kaiserlichen Zentralmacht tendenziell aufhebt, weil sie einen Wertewandel impliziert, der die herrschenden Normen negiert und staatliche Strukturen ändert. Zu den Rahmenkomponenten gehört zunächst die aktive Akzeptanz der Situation. Was die Vagabunden sind, nämlich Ausgegrenzte, Ausgestoßene, Rechtlose und was ihnen von der Macht als selbst verschuldete Schwäche, Unmoral, Verworfenheit, Armut vorgeworfen wird, bestätigt Wang gerade als ihre Fähigkeiten, Stärken und Basis ihres legitimen Selbstbilds, woraus sich Konsequenzen für ihre Vorstellung davon, wie sie leben wollen, ergeben. Ebenso wie die Gegenseite Privilegien und Legitimität ihrer Position mit ihrer Macht, ihrer Teilhabe an kultureller Tradition und ihrem Reichtum begründet, so die Vagabunden ihre Stärke aus ihrer faktischen Macht-, Besitz- und Rechtlosigkeit. Daher argumentiert Wang zunächst deskriptiv, indem er ihnen sagt, »daß sie arme ausgestoßene Menschen seien. Daß man ihnen nichts tun dürfe, wie sie selbst keinem etwas täten. Daß nichts schrecklicher sei, als wenn Menschen sich töteten, und der Anblick nicht zu ertragen«.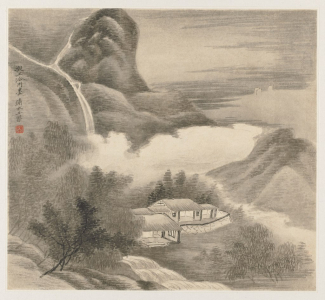 Schon die Gründung der Bewegung scheint – als dritte Komponente – einen Wendepunkt für ihre Mitglieder zu markieren, was diese mit dem Begriff der „Generalabsolution“
Schon die Gründung der Bewegung scheint – als dritte Komponente – einen Wendepunkt für ihre Mitglieder zu markieren, was diese mit dem Begriff der „Generalabsolution“ Im Zuge der Kämpfe mit den kaiserlichen Truppen verdichtet Wang diese Position zur Forderung absoluter Entscheidungskompetenz; er ist nicht bereit, seine Entscheidungen zu begründen, zu rechtfertigen oder zu relativieren.
Im Zuge der Kämpfe mit den kaiserlichen Truppen verdichtet Wang diese Position zur Forderung absoluter Entscheidungskompetenz; er ist nicht bereit, seine Entscheidungen zu begründen, zu rechtfertigen oder zu relativieren. Wird das Meidungsverhalten durchgehalten, kann es eine Entlastung des Staates im Sektor der Strafverfolgung zur Folge haben. Allerdings führt die Kombination mit fakultativer religiöser Praxis – Kritik am Kaiser und seiner Funktion die rituelle Praxis zu sichern – und der Zielvision eines paradiesischen Endzustands zur Entwertung des Ansatzes. Womöglich ist der Einzug ins westliche Paradies gemeint. „Es schien sich um Geheimnisse zu handeln“, daher insistieren die Mitglieder nicht auf präziser Auskunft. Scheinen diese doch eine außeralltägliche Erfahrung des Heiligen bzw. „Numinosen“ mit der Polarität von ’Faszination‘ und ’Schrecken‘
Wird das Meidungsverhalten durchgehalten, kann es eine Entlastung des Staates im Sektor der Strafverfolgung zur Folge haben. Allerdings führt die Kombination mit fakultativer religiöser Praxis – Kritik am Kaiser und seiner Funktion die rituelle Praxis zu sichern – und der Zielvision eines paradiesischen Endzustands zur Entwertung des Ansatzes. Womöglich ist der Einzug ins westliche Paradies gemeint. „Es schien sich um Geheimnisse zu handeln“, daher insistieren die Mitglieder nicht auf präziser Auskunft. Scheinen diese doch eine außeralltägliche Erfahrung des Heiligen bzw. „Numinosen“ mit der Polarität von ’Faszination‘ und ’Schrecken‘ Als weitere formative Komponente der Praktiken des guten Lebens gilt die Sichtbarkeit der Wahrhaft Schwachen. Sie müssen nicht mehr vereinzelt, unsichtbar, in Wäldern leben, sondern wandern als Gruppe durch das Land, deren bloße Existenz Defizite des Staates sichtbar macht, so dass sie sich als jene präsentieren können, die in freiwilliger Solidarität mit den Unterschichten ihren Lebenssinn und -unterhalt generieren. Angelegt ist der Konflikt mit dem Staat schon in der explizit negativen Form 'nicht handeln, nicht widerstreben’ ihrer bloß für den öffentlichen Raum geltenden Orientierungsbegriffe. Damit setzt sich die Bewegung in direkte Opposition zum kaiserlichen, ebenso explizit als absolut reklamierten Verfügungsrecht über den gesamten öffentlichen Bereich. ‘Nicht handeln’ bleibt ein Format sozialen Handelns, das nur die Meidung der Mitwirkung an jenen Prozessen verlangt, die von der Zentralmacht verantwortet werden. Diese kann das gezielte Meidungsverhalten, z.B. als Arbeitsverweigerung, kriminalisieren, weil sie keiner regulären Arbeit nachgehen, sondern als Fremde spontan und unbezahlt Bauern und Handwerker unterstützen, was als Propaganda für die Bewegung wirken, diese aber auch in Konflikt mit dem Staat (Entzug von Arbeitskräften; Behinderung des Fortschritts) bringen kann. Auch sind sie auf solche Gelegenheiten zur Hilfeleistung angewiesen, um sich als Wahrhaft Schwache erfahren zu können. Sie produzieren nichts und hinterlassen keine materiellen oder immateriellen Zeugnisse. Indem sie sich exponieren, widersprechen sie tendenziell ihrer Gründungsnorm des Wu-wei, weil ihre bloße Existenz von der Zentralmacht im Schema von Bedrohung und Abwehr gedeutet wird. Die sichtbare Gründung der Bewegung scheint schon den Anfang ihres Endes gesetzt zu haben.
Als weitere formative Komponente der Praktiken des guten Lebens gilt die Sichtbarkeit der Wahrhaft Schwachen. Sie müssen nicht mehr vereinzelt, unsichtbar, in Wäldern leben, sondern wandern als Gruppe durch das Land, deren bloße Existenz Defizite des Staates sichtbar macht, so dass sie sich als jene präsentieren können, die in freiwilliger Solidarität mit den Unterschichten ihren Lebenssinn und -unterhalt generieren. Angelegt ist der Konflikt mit dem Staat schon in der explizit negativen Form 'nicht handeln, nicht widerstreben’ ihrer bloß für den öffentlichen Raum geltenden Orientierungsbegriffe. Damit setzt sich die Bewegung in direkte Opposition zum kaiserlichen, ebenso explizit als absolut reklamierten Verfügungsrecht über den gesamten öffentlichen Bereich. ‘Nicht handeln’ bleibt ein Format sozialen Handelns, das nur die Meidung der Mitwirkung an jenen Prozessen verlangt, die von der Zentralmacht verantwortet werden. Diese kann das gezielte Meidungsverhalten, z.B. als Arbeitsverweigerung, kriminalisieren, weil sie keiner regulären Arbeit nachgehen, sondern als Fremde spontan und unbezahlt Bauern und Handwerker unterstützen, was als Propaganda für die Bewegung wirken, diese aber auch in Konflikt mit dem Staat (Entzug von Arbeitskräften; Behinderung des Fortschritts) bringen kann. Auch sind sie auf solche Gelegenheiten zur Hilfeleistung angewiesen, um sich als Wahrhaft Schwache erfahren zu können. Sie produzieren nichts und hinterlassen keine materiellen oder immateriellen Zeugnisse. Indem sie sich exponieren, widersprechen sie tendenziell ihrer Gründungsnorm des Wu-wei, weil ihre bloße Existenz von der Zentralmacht im Schema von Bedrohung und Abwehr gedeutet wird. Die sichtbare Gründung der Bewegung scheint schon den Anfang ihres Endes gesetzt zu haben.