
Lektüren |
Natur und Kultur im jüdischen und im abendländischen DenkenTextlektürenArmin Münch Dieser Essay ist ein Versuch über ontologische Grundlagen unserer westlichen Welt. Hier treten nach meiner Auffassung zwei divergierende und konfligierende, aber ebenso komplementäre Ontologien zutage. Es ist zum einen die Ontologie des Seins, der Natur, der Physis, in der gewissermaßen naturhaft-mechanische Kraftwirkungen und Relationen bestimmend sind. Stichworte hierbei sind: Ort, Bewegung, Kraft, Kampf, Austausch, Niederlage, Sieg, Ruhe, Körper usw. Die andere Ontologie ist eine solche der Sprache und der Forensik. Hierbei geht es um eine „coram“-Situation, wo das „Gericht“ die wesentliche Rolle spielt. Stichwörter hier sind: Anklage, Schuld, Verhaftung, Rechtfertigung, Strafe, Verurteilung, Freispruch, Prozess usw. (Man denke hierbei auch an Franz Kafkas „Der Prozess“). Die Entfaltung dieser beiden inkompatiblen Ontologien soll geschehen am Leitfaden eines Textes von Paul Celan. Paul Celan: Gespräch im Gebirg
Die besondere Aufmerksamkeit soll jetzt aber der Sprache gelten, und dabei werden wir feststellen, dass eine akustische Metaphorik vorherrscht, also Verben des Hörens und des Nicht-hörens - des Schweigens. Das Sehen spielt eine völlig untergeordnete Rolle. Die Augen sind verschleiert. Auch wird die Umgebung, die besonderen Umstände des Ereignisses, äußerst nachlässig und holzschnittartig beschrieben: „kam über den Stein“, „Gewölk“, „Gebirg“. Das Hauptinteresse liegt im Gespräch, auch und gerade, weil es ein Aneinander-vorbei-Reden ist. Nun kommt dem Wanderer dessen Vetter entgegen: Der ältere Jude Groß. In ihm ist, nach der Interpretation Otto Pöggelers, der Philosoph Theodor W. (Wiesengrund) Adorno zu erblicken, während Celan selbst der andere, der Jude Klein, ist. „Man muss Celans Gespräch im Gebirg wirklich einmal lesen als ein Mauscheln mit Adorno, den Celan im Schweizer Hochgebirge treffen wollte.“[4] Die geplante Begegnung in Sils Maria kam aber damals nicht zustande.
Celan benennt hier bereits, was sich dann im weiteren Verlauf entfalten wird: Dass „der Jud und die Natur zweierlei“ sind. Das Judentum hat zur Natur ein problematisches, ein gebrochenes, oder jedenfalls ein indirektes Verhältnis. Die Natur ist als solche, wie auch der exponierte Ort im Hochgebirge deutlich macht, nichts Heimatliches, nichts Bergendes, sondern etwas Fremdes. „Diese Fremdheit ist das erste Thema, in dem sich in diesem Text das Problem der jüdischen Existenz entfaltet. Sie zeigt sich als Fremdheit des Juden gegenüber der Natur.“[6] Dies besagt nicht weniger, als dass das Judentum nicht in der Kategorie oder Dimension der physis, des Naturhaften, des Erdverbundenen verortet ist, sondern in einem anderen „Reich“. Dieses ist die Sprache, der Geist, der Name. Also Thesis, Setzung, gegenüber Verwurzelung, Wachstum und alles Chthonische.
Die Kargheit der sonstigen Beschreibung steht im Gegensatz zu dieser genauen Benennung, ja botanischen Taxierung der Blumen. Die Blumen haben jedoch keine Augen, oder besser: Es hängt ein Schleier davor. Es entsteht im Anblick der „Geschwisterkinder“ ein seltsames Schweigen. Ein Schweigen, das keines ist, sondern eine Pause, eine Leerstelle, eine Dorflücke.[8]
Die Sprache der Natur ist keine Sprache. Sie ist jedenfalls unverständlich, da sie nicht den Menschen meint, keine Anrede ist (lauter Es...). Die Worte sind belanglos, ohne Bedeutung. Das Wort Gletscher wird, kaum ausgesprochen, wieder zurückgenommen (man soll`s nicht sagen). Nur die optische Anmutung wird wiedergegeben - eine ungeheure Verfremdung des Naturerlebnisses (ein Grünes, ein Weißes). Doch sie spiegelt nur die Fremdheit der Wanderer wider. „So scheint es, als sei das Schicksal, nicht von dieser Erde zu sein, ein grundsätzlich menschliches, das indessen von der Geistesgebundenheit der Juden schärfer erlitten wird.“[10] „Die Juden stehen vor der fremden Natur als vor einer Sprache, die der Geist indessen nicht als Sprache anerkennen darf.“[11] Und dann strebt die Unterhaltung ihrer Klimax zu, wenn die Gottesfrage hindurchschimmert, versteckt in dem „Hörstdu“, welches an das „Sch‘ma Israel“, das „Höre Israel“ anklingt.
Und dann kommt die Rede noch auf die Kerze, die herunterbrennt, auf den siebten Tag und auf den Stern (Judenstern? Davidsstern?), lauter Elemente des jüdischen Glaubens. Hier sind vehemente theologische Anfragen und hier ist eine ganze Theodizee versteckt. Die erschütternde Erkenntnis, dass Gott uns, in diesem Falle speziell dem Juden, nichts (mehr) sagt, uns nicht mehr angeht. Gott ist „Der mit den Gletschern“. Gott ist lauter Er oder gar Es, wie früher bereits gesagt. Kein Du. Gott steht nicht im Vokativ, sondern ist wie die anonyme, sprachlose Natur (Der Grün-und-Weiße dort). Gott scheint sich vom Judentum abgewandt zu haben und nur noch im Christentum und im Islam anzutreffen zu sein. „Der, der sich gefaltet hat, dreimal“ ist sicherlich eine Anspielung auf die christliche Trinitätslehre. Der „Türkenbund“ könnte auf den Islam zielen, da dieser Blumenname von Celan schwerlich ohne Absicht auftaucht, und „Bund“ ein eminent wichtiges jüdisches Theologoumenon ist. Die Rapunzel vertritt darüber hinaus das Deutschtum, da sie für die deutsche Volkskultur nach Art der Grimm`schen Märchen steht („Rapunzel, Rapunzel, lasse dein Haar herunter“). Viktor E. Frankl
Was Frankl beschreibt ist die Herangehensweise eines Von-weit-her-Kommenden an die Welt. Wie Extraterrestrische, wie Marsmenschen verhalten sich die dem Tod Entronnenen, die aus der Welt Gefallenen. Alles ist ihnen fremd geworden. Sie müssen sich, wie aus einem Jenseits Zurückgekehrte, wieder der Erde, der Natur annähern. Frankl schreibt aus eigener Erfahrung, und er erfasst die Situation aus psychologischer Sicht. Das Moment der Entfremdung mit der Natur ist ganz ähnlich wie bei Celan, nur dass es dieser als dem Judentum wesenhaft, sozusagen ontologisch versteht, während Frankl es nur okkasionell und spezifisch als Gefangenen-Syndrom vorstellt. Abraham Joschua Heschel: Eine Philosophie des Judentums
„Der abendländische Mensch muss sich entscheiden zwischen der Anbetung Gottes und der Anbetung der Natur.“[19] Hier weist Heschel auf den unverwechselbaren Beitrag des Judentums zur Weltkultur hin und auf den fundamentalen Unterschied zwischen Jerusalem und Athen.[20]
Das spezifisch Jüdische lässt sich benennen mit dem unscheinbaren Wort „Problem“. Seine Etymologie führt direkt zu dem, was man das „Wesen des Judentums“ nennen könnte.[22] Pro-blem, von lateinisch: pro = „vor“ oder auch „hervor“, und griechisch: ballo, pf. ebleka = „werfen“, das heißt also wörtlich: Vor-Wurf, Hervor-Geworfenes, und meint: Das mir Entgegenstehende, das Gegenüberliegende. Hier taucht die Kategorie der Frontalität auf, die charakteristisch ist für das Judentum. Dazu später mehr. Jüdisches Denken empfindet die in der Natur anzutreffende Ordnung nicht als aus der Natur selbst erwachsen und als in ihr liegend, sondern als etwas Dazukommendes, als Super-Struktur. Nach biblischer Auffassung ist Ordnung „vom Willen Gottes in die Natur hineingelegt und bleibt stets von ihm abhängig. Nicht immanentes Gesetz, sondern göttlicher Befehl herrscht überall.“[23] Heschel verweist in diesem Zusammenhang auf die amerikanische Prozessphilosophie: „A.N. Whitehead hat die hebräische Konzeption richtig charakterisiert, wenn er sie die „Lehre von dem auferlegten Gesetz“ nennt, das im Gegensatz steht zur „Lehre von dem immanenten Gesetz“, wie sie in der griechischen Philosophie entwickelt wurde.“[24] Hier siedelt Heschel auch die Weichenstellung der verschiedenen Gotteskonzeptionen an: „Die Lehre vom auferlegten Gesetz führt zur monotheistischen Auffassung über Gott als dem wesentlich Transzendenten und nur akzidentiell Immanenten, während die Lehre vom immanenten Gesetz zu der pantheistischen Auffassung von Gott führt, der wesentlich immanent und in keiner Weise transzendent gedacht ist.“[25] Das Judentum bringt also immer wieder sein Spezifikum ein, das - um nur einige Beispiele zu nennen - in seinem Beharren auf einem „extra nos“, einer Rebellion gegen das Bestehende (Hiob), einem gewissen polemischen Element (mit Gott Streiten und Rechten) besteht. Es dominiert also ein forensisches Verständnis von Welt. Ebenso wird Schöpfung primär als Sprech-Akt („Es sei...“), also von Wort und Willen Gottes abhängig, verstanden. Der in der Postmoderne-Debatte aufgekommene Begriff des „Logozentrismus“ (Derrida) trifft auf das Judentum unbedingt zu, sofern „logos“ nicht griechisch, sondern hebräisch als „dabar“ verstanden wird, als performatives, kreatives Wort. Noch einmal zum jüdischen Beitrag zur Welt-Kultur: „Nicht die Religion, die selbst aus der Erde entspringt und Verehrung für sich verlangt, nicht die Naturreligionen, sondern eine Buchreligion der Offenbarung bestimmt das Verhältnis zwischen dem jüdischen Volk und der Scholle Erde.“[26] „Wie in den meisten anderen Dingen, besteht die Geschichte des abendländischen Denkens auch hier in dem Versuch, Ideen, die ihrem Ursprung nach überwiegend hellenistisch sind, mit solchen zu vereinen, die ihrem Ursprung nach vorwiegend semitisch sind.“[27] Diese Eigenheit, ja Einzigartigkeit jüdischen Denkens ist eine unverzichtbare, wenn auch schwierige Stimme im Chor derer, die sich mit den Gegenwartsfragen und -Problemen beschäftigen. Hier wird vor einer Divinisierung und Wiederverzauberung der Natur gewarnt. Ein ökologischer Naturromantizismus kann da schwerlich aufkommen.
Ein Seitenblick zum Buddhismus
Ein großes und vielbehandeltes Thema im christlich-buddhistischen Dialog ist der christliche Theismus und dabei besonders der Personalismus gegenüber der a-theistischen Haltung des Buddhismus. Der Christ sagt zu Gott „Du“, er versteht Gott als Gegenüber (wenn wir von der Mystik absehen, die hier auch andere, nämlich a-personale Konzepte einbringt), hat also eine frontale Gottesvorstellung. Gedanken, die einem Buddhisten (wiederum müssen wir vom japanischen Amida-Buddhismus absehen) fremd sind. Über das Entstehen des Personalismus, der ja eine jüdische Tradition und Gabe an spätere Religionen darstellt, hat der japanische Denker Watsuji Tetsuro (1889-1960) eine bemerkenswerte Theorie aufgestellt. Für ihn sind Kulturen und damit Denk- und Sprach-Welten Produkte des sie umgebenden Klimas. Die Welt der Wüste, in der die Bibel entstanden ist, hat einen ganz bestimmten Menschen-Typen geprägt: „Der von einem starken Willen beseelte, gehorsam-kämpferische Mensch der Wüste“.[30] „Das Verhältnis dieses Menschen zu seiner Welt ist in erster Linie bestimmt durch Widerstand und Kampf, denn die Natur bedroht ihn mit dem Tod.“[31] Daher betrachtet Tetsuro Christentum, Judentum und Islam als Produkte der Wüste.[32] Die Wüstensituation war dann auch verantwortlich für die Entstehung der Vorstellung eines persönlichen Gottes. „Die besonderen Bedingungen in der Wüste führten dazu, dass die Stammesgottheit personale Züge erhielt. Dieser Gott ist die Bewusstwerdung der Einheit der Stammesangehörigen in ihrem Kampf gegen die Natur. Eine Vergöttlichung der Natur ist hier nicht zu finden, vielmehr ist die Natur Gott untergeordnet.“[33] Dies steht im Gegensatz schon zu den klimatisch gesegneteren Gebieten Griechenlands und des Mittleren Orients, wo die Mysterienreligionen entstanden sind. Ganz zu schweigen vom üppigen indischen Monsunklima, wo Gott als Absolutes, Nicht-Personhaftes erfahren wurde. „In der Wüste aber bedeutet Natur nicht Leben, sondern Tod; Leben gibt es nur auf Seiten des Menschen. Folglich muss die Gottheit hier personale Züge tragen.“[34] Wenn Tetsuros Einsichten nicht reduktionistisch und monokausal missverstanden werden, dann stellt seine Theorie „einen ersten und heute noch gültigen Versuch dar, die Konstellation der europäischen und der japanischen Kultur deutlich zu machen und die Einseitigkeit der historisch-zeitlichen Betrachtungsweise durch Einbeziehung der räumlichen Kategorie zu überwinden.“[35] Martin Heidegger: Der Feldweg
Unser Hauptaugenmerk soll im Folgenden auf der Wortwahl der Verben und Verbalnomina liegen: Ob eine Metaphorik des Verbal-Forensischen, oder des Ontisch-Physischen vorliegt. Die erste Wortgruppe wird kursiv, die andere unterstrichen markiert. Nun einige repräsentative Passagen aus dem Text: "Er läuft aus dem Hofgartentor zum Ehnried." Dies ist der erste Satz: eine reine Orts-Beschreibung. Der Verlauf des Feldwegs vom Meßkircher Schlosshof in südwestliche Richtung auf das Gewann "Ehnried" zu. Und doch kann man schon die Tendenz zu einer Hypostasierung erkennen, denn das "Er", der Weg, der in den ersten Sätzen noch gar nicht vorgestellt wird, ist der Handelnde. Er "läuft". "Vom Feldkreuz her biegt er auf den Wald zu. An dessen Saum vorbei grüßt er eine hohe Eiche, unter der eine roh gezimmerte Bank steht." Hier taucht das erste Verb der Verbal-Kategorie auf: "grüßen". Ein Wortgeschehen also. Und doch ist es wieder der Weg selbst, der nun auch sprachlich handelt, indem er eben grüßt. Die nächsten Sätze zusammengefasst: Auf der erwähnten Bank lag bisweilen eine Schrift, ein Buch, gewissermaßen ein Fremdkörper, der Rätsel beinhaltete, die schwer zu entziffern waren. Doch dabei "half der Feldweg." Der nächste längere Abschnitt enthält beide Kategorien in dichtem Wechsel: "Indessen begannen Härte und Geruch des Eichenholzes vernehmlicher von der Langsamkeit und Stete zu sprechen, mit denen der Baum wächst. Die Eiche selber sprach, dass in solchem Wachstum allein gegründet wird, was dauert und fruchtet: dass wachsen heißt: der Weite des Himmels sich öffnen und zugleich in das Dunkel der Erde wurzeln; dass alles Gediegene nur gedeiht, wenn der Mensch gleich recht beides ist: bereit dem Anspruch des höchsten Himmels und aufgehoben im Schutz der tragenden Erde." Nun ist es die Eiche, das Holz der Eiche, die sprechen. Der Baum spricht von Wurzeln, Wachsen und Gedeihen. Vom unten spricht er, vom Schutz der tragenden Erde, aber auch vom oben, vom Himmel, dem er entgegenwächst. Und von dort her kommt ein Anspruch, ein Wort also. Es ist der "höchste Himmel", der spricht. Ist das schon Gott, der da spricht? Oder ist es ein weltlicher, ein irdischer Himmel? Es folgt eine Reihe von Vorgängen, die sich um den Feldweg abspielen: Er selber sammelt und trägt allem, was um ihn sein Wesen hat, das Seine zu. Der Feldweg ist so etwas wie die Gravitationslinie der Landschaft, eine anziehende, ordnende, ausrichtende Entität. Sein Tun erinnert an ein Wort von Hölderlin, der den Neckar als den Meister bezeichnet, der das (Schwaben)-Land durchpflügt und den Segen herabzieht.[38] Um ihn, den Feldweg herum, sinkt die Dämmerung, schwingt die Hügelwelle, steigt die Lerche, stürmt der Ostluft (schwäbisch korrekt: DER Luft!), schwankt der Erntewagen, pflücken die Kinder, schiebt der Nebel. "Die Weite aller gewachsenen Dinge, die um den Feldweg verweilen, spendet Welt. Im Ungesprochenen ihrer Sprache ist, wie der alte Lese- und Lebemeister Eckehart sagt, Gott erst Gott." Hier kommt Sprache in Form von apophatischer, negativer Theologie ins Spiel. Gott ist im Ungesprochenen, im Vor-Sprachlichen, bei den wort-losen Dingen. Sie sind der Sprache vorgeordnet. "Aber der Zuspruch des Feldweges spricht nur so lange, als Menschen sind, die in seiner Luft geboren, ihn hören können. Sie sind Hörige ihrer Herkunft, aber nicht Knechte von Machenschaften." Wieder ein Stück theologischer Sprachform: "Zuspruch", ein performativer Sprech-Akt, wie beim Segen in der Kirche, wie bei Taufe und Sündenvergebung. Mitschwingt auch die Dimension des Trostes. Doch zur Wahrnehmung dieses Zuspruchs bedarf es des rückwärtsgewandten Hörens auf die Herkunft, nicht aber eines Zukunft gewinnen wollenden Planens und Ordnens. Dies sind Machenschaften, die die Welt in das Gestell eines technischen Apparats verwandeln. Der Feldweg kehrt dann zurück vom Ehnried zum Hofgartentor. Oder ist es der Wanderer, der zurückkehrt? Von ihm ist nie direkt die Rede. Immer ist es der Weg, der handelt, der sieht, der hört. Nun kommt der Turm der St. Martinskirche in den Blick. Martin Heidegger war in seiner Kindheit Läutebub und Ministrant gewesen; seine Eltern Mesner. Die Stimmung wird ernst; die Erinnerung an zwei Weltkriege kommt herauf. "Der Zuspruch des Feldweges ist jetzt ganz deutlich. Spricht die Seele? Spricht die Welt? Spricht Gott?" Nach dem Verklingen des Stundenschlags wird in der deutlicheren Stille ein noch kräftigerer Zuspruch wahrgenommen. Doch es bleibt unentschieden, wer spricht. Ich-Welt-Gott? Eine unauflösliche Trinität. "Alles spricht den Verzicht in das Selbe. Der Verzicht nimmt nicht. Der Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen. Der Zuspruch macht heimisch in einer langen Herkunft." Damit endet Heideggers Text. Es dürfte deutlich geworden sein, dass die ontisch-realistischen Verben ein Übergewicht haben vor den verbal-nominalistischen. Heideggers "Feldweg" könnte somit als Gegen-Text zu Celans "Gespräch im Gebirg" gelesen werden. Die Sprache, das Wort bei Heidegger, ist kein menschliches Wort, somit nichts Gesetztes, sondern ein Wort der Dinge, also Gewachsenes. Nicht nomos oder thesis, sondern physis. Nicht Gesetz, sondern Gewächs. Es ist auch kein verbum alienum, ein An-Spruch oder Zu-Spruch von einem transzendenten extra-nos. Auch Gott ist bei Heidegger ein weltlicher Gott. Freilich braucht der Mensch die Sprache, denn die Sprache ist das "Haus des Seins". Doch die Sprache kommt nicht von außen, sondern von den Dingen, von der Natur. Es ist "die Natur, die das Seiende in seiner Vielfalt von sich her ins Offene kommen lässt und so der wortbestimmten Seinsverfassung des Menschen allererst ein die Dinge verbindendes, vergleichendes, unterscheidendes und zusammenführendes Denken und Handeln ermöglicht."[39] Um die Sprache der Dinge aber möglichst rein vernehmen zu können, bedarf es der Dichter, denn: "Das dichterische Sagen lässt erst die Sterblichen auf der Erde unter dem Himmel vor dem Göttlichen wohnen. Ihr dichterisches Sagen bringt erst anfänglich die Hut und Hege, den Hort und die Huld für eine bodenständige Ortschaft hervor, die Aufenthalt im irdischen Unterwegs der wohnenden Menschen sein kann."[40] Welch ein Unterschied zu biblisch-jüdischem Denken. Hier das abrahamitische Herausgerufenwerden und Geführtwerden durch Gott, vermittelt allein durch das Wort. Dort das bodenständige Wohnen mit dem Gerechtwerden der Dinge. Auch der Vergleich des Wahrheitsbegriffs kann diesen Unterschied sehr deutlich machen. Bei Heidegger ist Wahrheit von der griechischen Wortbedeutung her a-letheia, d.h. Ent-bergung, Un-verborgenheit, oder auch Lichtung. Alles Ausdrücke der non-verbalen Kategorie. In der Bibel ist Wahrheit vom Hebräischen ämät her Treue, Verlässlichkeit, Zusage, Gehorchen. Es schwingt mit die Zuverlässigkeit in einem partnerschaftlichen Bundes-Verhältnis. Wenn man versucht, die Entstehung dieses Verständnisses im Lebensraum der Wüste zu imaginieren, so wird nachvollziehbar, wie lebensnotwendig das Vertrauen auf die Kunde von einer Wasserstelle war. Von der Wahrhaftigkeit, die versprochene Quelle tatsächlich anzutreffen, hing das Leben ab. Wahrheit als vertrauensvoller Lebenseinsatz auf das Wort eines vertrauenswürdigen Menschen hin. Ein Verhältnis, das auch auf Gott übertragen werden konnte. Emmanuel Levinas
Doch dem Primat der Ontologie und der Anonymität des Seins gilt auch die Kritik. In dem folgenden längeren Zitat, einer Darstellung der Philosophie Heideggers, ist bezeichnend das fast völlige Fehlen einer verbalen, nominalistischen Semantik. Levinas weist darauf hin, dass Heidegger Ontologie betreibt, auch wenn er "bei den Vorsokratikern das Denken als Gehorsam gegenüber der Wahrheit des Seins findet. Gehorsam, der sich als Bauen und Pflegen vollzieht, welches die Einheit des Ortes ausmacht, der den Raum trägt. Heidegger versammelt den Aufenthalt auf der Erde und unter dem Gewölbe des Himmels, die Erwartung der Göttlichen und das Geleit der Sterblichen im Aufenthalt bei den Dingen; Aufenthalt bei den Dingen heißt Bauen und Pflegen. Damit begreift er, wie die gesamte abendländische Geschichte, die Beziehung mit den anderen Menschen als etwas, das sich im Schicksal der sesshaften Völker, der Völker, die die Erde besitzen und bebauen, abspielt. Der Besitz ist in ausgezeichneter Weise die Form, unter der das Andere das Selbe wird, weil es meines wird. Indem Heidegger die Herrschaft der technischen Macht kritisiert, verherrlicht er die vortechnische Macht des Besitzes. Gewiss gehen seine Analysen nicht vom Ding qua Gegenstand aus, aber sie tragen das Zeichen der großen Landschaften, auf die sich die Dinge beziehen. Die Ontologie wird Ontologie der Natur, der Natur als unpersönlicher Fruchtbarkeit, großmütiger Mutter ohne Antlitz, Gebärerin der besonderen Seienden, unerschöpflicher Muttergrund der Dinge."[42] Levinas ist demgegenüber der Philosoph des Antlitzes, der die Ethik als prima philosophia einsetzt. "Die Moral ist nicht ein Zweig der Philosophie, sondern die erste Philosophie."[43] Nicht ein anonymes Sein, sondern "das Antlitz des Anderen (ist) der eigentliche Anfang der Philosophie."[44] Das Antlitz des anderen Menschen als das Persönlichste, in seiner Nacktheit und Ungeschütztheit auch Verwundbarste. "Die Nacktheit des Antlitzes ist Entblößung und in der aufrichtigen Geradheit, die mich meint, schon inständiges Flehen. Doch dieses inständige Flehen ist eine Forderung."[45] Das Ich kann sich dieser Forderung nicht entziehen. Es ist geradezu "Geisel, der dem Anderen ausgeliefert ist als Gabe."[46] "Das Ich angesichts des Anderen ist unendlich verantwortlich."[47] Der andere setzt mir keinerlei Macht oder Gewalt entgegen, aber die "Unendlichkeit seiner Transzendenz. Diese Unendlichkeit, die stärker ist als der Mord, widersteht uns schon in seinem Antlitz, ist sein Antlitz, ist der ursprüngliche Ausdruck, ist das erste Wort: "Du wirst keinen Mord begehen"."[48] Das Antlitz ist Schrift, Thora, Sprache, Anrede, Befehl. Als erstes das fünfte Gebot des Dekalogs. "Die Epiphanie des Antlitzes ist Heimsuchung."[49] "Das Antlitz spricht. Die Erscheinung des Antlitzes ist die erste Rede."[50] Das Antlitz ist jedoch nicht einfach Manifestation des Göttlichen, oder Fenster zur Ewigkeit wie die Ikone. "Das Wunder des Antlitzes rührt her vom Anderswo, von wo es kommt und wohin es sich auch schon zurückzieht."[51] Dieses Anderswo, dieses Jenseits weist auf die dritte Person[52], die "Illeität", die Spur. Hier kommt dann auch die Epiphanie Gottes vor Mose aus Ex 33 in den Blick.
Gegen den Ausdruck Heideggers vom Menschen als dem "Hirten des Seins" polemisiert Levinas und setzt dagegen den Menschen als den Hirten des Anderen. Und eben nicht nur Hirte, sondern drastischer und völlig einseitig "Geisel", Gefangener, Alleinverantwortlicher. Es gibt zum Anderen keine Beziehung, "dessen Strahl vom Ich ausgeht."[54] Auch keine symmetrisch-reziproke Dialog-Situation wie bei Martin Buber. Sondern nur das einseitige Von-wo-her vom Andern, der mich allererst einsetzt in mein Menschsein. Mensch-Sein wird also nicht gefunden oder vom Sein gegeben, sondern ist ein thetisch-forensischer Akt vom Anderen her. Gegen Heidegger: "...früher als die Ebene der Ontologie ist die Ebene der Ethik."[55] Diese fundamental andere Perspektive kann anhand des Begriffs "Ethik" abschließend illustriert werden. Das Wort kommt von griechisch „ethos“, ursprünglich der Weideplatz der Tiere; allgemein der Aufenthaltsort; im übertragenen Sinne dann die Gewohnheit, Sitte, der Brauch, der an diesem Ort herrscht. Heidegger würde hier in den Kategorien von Heimat und Bodenständigkeit denken. Levinas wendet sich immer wieder gegen ein solches eigenes Pflöcke-Einrammen, den Kampf um den Platz an der Sonne, den "conatus essendi" (Gier zu sein). Der Ort des Menschen wird vom Anderen zugewiesen, der Mensch wird eingesetzt, sein Ort ist bestimmt vom Wort, von der Verantwortung für den Anderen. Schlussbemerkung
Auch wenn es Ansätze gibt, diesen Ur-Dualismus zu überwinden (Das Wort ward Fleisch, Joh 1,14), und auch wenn wir eine noch mal ganz andere Logik und einen weiteren Ort hinzusetzen: Kyoto[57] - es scheint, als stünden wir mit unserem Verstehen erst am Anfang. Anmerkungen[1] Aus: Paul Celan. Ausgewählte Gedichte, Frankfurt: Suhrkamp 1982 (Bibliothek Suhrkamp), S. 181-186, hier S. 181. [2] Renate Böschenstein-Schäfer: Anmerkungen zu Paul Celans „Gespräch im Gebirg“, in: Dietlind Meinecke (Hg.): Über Paul Celan, Frankfurt: Suhrkamp 1970, S. 226. [3] Georg Büchner: Lenz. Erstveröffentlichung posthum 1839. Es geht darin um die Begegnung des vom Wahnsinn bedrohten Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) mit Pfarrer Oberlin im Steintal, Elsaß. Büchner griff vorwiegend auf Oberlins Aufzeichnungen zurück. [4] Otto Pöggeler: Spur des Worts: zur Lyrik Paul Celans, Freiburg, München: Alber 1986, S. 155. [5] Celan, aaO S. 182. [6] Böschenstein-Schäfer, aaO, S. 232f. [7] Celan, aaO S. 182. [8] ebd. [9] S. 183. [10] Böschenstein-Schäfer, S. 234. [11] dies. S. 237. [12] Celan, S. 184. [13] München, dtv-TB 1993 (12. Aufl.), Erstausgabe München: Kösel 1977. [14] Frankl, S. 140f. [15] S. 141. [16] ebd. [17] Abraham Joschua Heschel: Gott sucht den Menschen. Eine Philosophie des Judentums, Neunkirchen-Vluyn 1980, S. 68. [18] ebd. [19] S. 69. [20] Vgl. dazu: Leo Schestow: Athen und Jerusalem. Versuch einer religiösen Philosophie, mit einem Essay von Raimundo Panikkar, München: Matthes und Seitz 1994. [21] Heschel, S. 70. [22] Siehe dazu: Leo Baeck: Das Wesen des Judentums, Wiesbaden: Fourier 1991 (5. Aufl.). [23] Heschel, S. 71. [24] S. 71f. [25] S. 72. [26] Albert H. Friedlander: Religion und Natur nach jüdischem Verständnis, in: Dialog der Religionen, 3.Jg. (1993), Heft 2, S. 158-164, hier S. 160. [27] Heschel, S. 72. [28] Friedlander, aaO, S. 158f. [29] vgl. Masahiro Okino: Vom japanischen Naturverständnis aus der Sicht des Buddhismus, in: Evangelische Theologie 53 (1993) S. 452-460. [30] Watsuji Tetsuro: Fudo - Wind und Erde. Der Zusammenhang zwischen Klima und Kultur, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1992 (jap. Original 1935) S. 49. [31] S. 43. [32] S. 49. [33] S. 50. [34] S. 51. [35] Klappentext hinten. [36] Auf die Antisemitismus-Debatte, die aufgrund der Veröffentlichung von Heideggers „Schwarzen Heften“ im Jahr 2014 neu entflammt ist, wird hier nicht eingegangen. [37] Jetzt erhältlich als bebilderte Sonderausgabe im Vittorio Klostermann-Verlag Frankfurt 1989, 27 S. [38] In: Stuttgart. [39] Walter Strolz: Natur - Sprache - Heimat in Heideggers Denken, in: ZThK 83. Jg., (1986), S. 125f. [40] Martin Heidegger: Aus der Erfahrung des Denkens, zit. nach Strolz, aaO, S. 135. [41] Emmanuel Levinas: Ethik und Unendliches. Gespräche mit Philippe Nemo, Graz; Wien: Böhlau 1986, S. 27. [42] Emmanuel Levinas: Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität; Freiburg; München: Alber 1987, S. 56. [43] AaO, S. 442. [44] Emmanuel Levinas: Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie, Freiburg; München: Alber 1987 (2. Aufl.), S. 207. [45] Emmanuel Levinas: Humanismus des anderen Menschen, Hamburg: Meiner 1989, S. 42. [46] Emmanuel Levinas: Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, Freiburg; München: Alber 1992, S. 332. [47] E.L.: Humanismus, S. 43. [48] E.L.: Totalität, aaO, S. 285. [49] Ders.: Die Spur des Anderen, aaO, S. 221. [50] ebd. [51] S. 227. [52] S. 229. [53] S. 235. [54] E.L.: Totalität, aaO, S. 280. [55] S. 289. [56] Dazu Dietrich Ritschl: Zur Logik der Theologie. Kurze Darstellung der Zusammenhänge theologischer Grundgedanken, München: Kaiser 1988 (2. Aufl.), S. 87: "Die Spannung zwischen Prometheus und dem gekreuzigten Jesus ist unauflöslich." Ritschl spricht vom Jerusalemer und Athener Modell. [57] Siehe: Ryosuke Ohashi (Hg.): Die Philosophie der Kyoto-Schule, Texte und Einführung, Freiburg; München (Alber) 1990. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/122/arm02.htm |




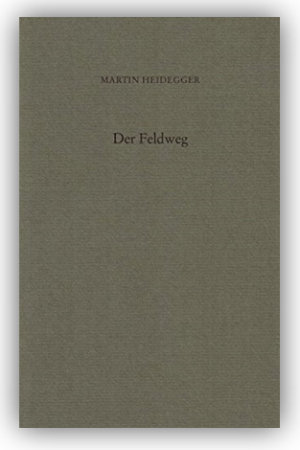

 Natur oder Gott, Athen oder Jerusalem, Odysseus oder Abraham, Prometheus oder Jesus,
Natur oder Gott, Athen oder Jerusalem, Odysseus oder Abraham, Prometheus oder Jesus,