Oder: Was lehren uns leere Städte – wenn sie sich wieder füllen?
Andreas Mertin
Der Schock der Leere II

In der letzten Ausgabe des Magazins für Theologie und Ästhetik hatte ich diesen Text über die Lehre der leeren Städte begonnen und ich hatte eigentlich nicht die Absicht, eine Fortsetzung zu schreiben. Er schien mir stimmig und treffend als Situationsanalyse. Aber jetzt, zwei Monate später wird mir klar, dass das, was ich seinerzeit als Alp-Traum beschrieben hatte, gar keiner war, sondern ganz im Gegenteil ein Traum. Diese Erkenntnis kam mir, als ich erneut auf die Bilder der weltweiten Webcams schaute und das Verhalten der zurückgekehrten Massen auf den Straßen und Plätzen geradezu als Sakrileg gegenüber der vorher weihevollen Stille empfand. Das hat mich schockiert, weil ich eigentlich Kommunikation schätze und anfangs dachte, menschenleere Städte wären ein Alptraum – aber sie sind auch eine Erholung. Nicht nur für die Tiere, die nun in manchen Städten zu beobachten sind, nicht nur für die Atemluft der Großstädte, die uns zeigt, wie ein nicht industriell fixiertes Leben aussehen könnte, sondern ganz allgemein für ein Leben der Entschleunigung. Was für eine Erlösung. Aber sie hat ihren Preis.
 Das spielt auch in Thomas Manns 1912 erschienener Novelle „Der Tod in Venedig“ eine Rolle, insbesondere im fünften Kapitel. Auch dort ist es eine Seuche, die die Lagunenstadt trifft und am Ende den Protagonisten dahinrafft. Ein renommierter, etwas älterer Schriftsteller kommt während einer Sommerreise nach Venedig, wohnt auf dem Lido und verliebt sich dort in einen schönen Knaben, der mit Mutter, Schwestern und Gouvernante im selben Hotel wohnt. Im fünften Kapitel wird ihm klar, dass etwas Ungewöhnliches in der Stadt vorgeht, sein Hotel leert sich, die Touristen verlassen die Stadt, ohne dass er weiß, warum. So erkundigt er sich in einem Reisebüro am Markusplatz, was denn los sei. Offiziell nichts, aber unter der Hand erfährt er, dass in Venedig die Cholera wütet und es für Touristen angeraten wäre, die Stadt sofort zu verlassen.
Das spielt auch in Thomas Manns 1912 erschienener Novelle „Der Tod in Venedig“ eine Rolle, insbesondere im fünften Kapitel. Auch dort ist es eine Seuche, die die Lagunenstadt trifft und am Ende den Protagonisten dahinrafft. Ein renommierter, etwas älterer Schriftsteller kommt während einer Sommerreise nach Venedig, wohnt auf dem Lido und verliebt sich dort in einen schönen Knaben, der mit Mutter, Schwestern und Gouvernante im selben Hotel wohnt. Im fünften Kapitel wird ihm klar, dass etwas Ungewöhnliches in der Stadt vorgeht, sein Hotel leert sich, die Touristen verlassen die Stadt, ohne dass er weiß, warum. So erkundigt er sich in einem Reisebüro am Markusplatz, was denn los sei. Offiziell nichts, aber unter der Hand erfährt er, dass in Venedig die Cholera wütet und es für Touristen angeraten wäre, die Stadt sofort zu verlassen.
 Mitte Mai dieses Jahres fand man zu Venedig an ein und demselben Tage die furchtbaren Vibrionen in den ausgemergelten, schwärzlichen Leichnamen eines Schifferknechtes und einer Grünwarenhändlerin. Die Fälle wurden verheimlicht. Aber nach einer Woche waren es deren zehn, waren es zwanzig, dreißig und zwar in verschiedenen Quartieren. … Venedigs Obrigkeit ließ antworten, dass die Gesundheitsverhältnisse der Stadt nie besser gewesen seien und traf die notwendigsten Maßregeln zur Bekämpfung. … Ja, es schien, als ob die Seuche eine Neubelebung ihrer Kräfte erfahren, als ob die Tenazität und Fruchtbarkeit ihrer Erreger sich verdoppelt hätte. Fälle der Genesung waren sehr selten; achtzig vom Hundert der Befallenen starben und zwar auf entsetzliche Weise, denn das Übel trat mit äußerster Wildheit … Anfang Juni füllten sich in der Stille die Isolierbaracken des Ospedale civico, in den beiden Waisenhäusern begann es an Platz zu mangeln, und ein schauerlich reger Verkehr herrschte zwischen dem Kai der neuen Fundamente und San Michele, der Friedhofsinsel. Aber die Furcht vor allgemeiner Schädigung, die Rücksicht auf die kürzlich eröffnete Gemäldeausstellung in den öffentlichen Gärten, auf die gewaltigen Ausfälle, von denen im Falle der Panik und des Verrufes die Hotels, die Geschäfte, das ganze vielfältige Fremdengewerbe bedroht waren, zeigte sich mächtiger in der Stadt als Wahrheitsliebe und Achtung vor internationalen Abmachungen; sie vermochte die Behörde, ihre Politik des Verschweigens und des Ableugnens hartnäckig aufrecht zu erhalten.
Mitte Mai dieses Jahres fand man zu Venedig an ein und demselben Tage die furchtbaren Vibrionen in den ausgemergelten, schwärzlichen Leichnamen eines Schifferknechtes und einer Grünwarenhändlerin. Die Fälle wurden verheimlicht. Aber nach einer Woche waren es deren zehn, waren es zwanzig, dreißig und zwar in verschiedenen Quartieren. … Venedigs Obrigkeit ließ antworten, dass die Gesundheitsverhältnisse der Stadt nie besser gewesen seien und traf die notwendigsten Maßregeln zur Bekämpfung. … Ja, es schien, als ob die Seuche eine Neubelebung ihrer Kräfte erfahren, als ob die Tenazität und Fruchtbarkeit ihrer Erreger sich verdoppelt hätte. Fälle der Genesung waren sehr selten; achtzig vom Hundert der Befallenen starben und zwar auf entsetzliche Weise, denn das Übel trat mit äußerster Wildheit … Anfang Juni füllten sich in der Stille die Isolierbaracken des Ospedale civico, in den beiden Waisenhäusern begann es an Platz zu mangeln, und ein schauerlich reger Verkehr herrschte zwischen dem Kai der neuen Fundamente und San Michele, der Friedhofsinsel. Aber die Furcht vor allgemeiner Schädigung, die Rücksicht auf die kürzlich eröffnete Gemäldeausstellung in den öffentlichen Gärten, auf die gewaltigen Ausfälle, von denen im Falle der Panik und des Verrufes die Hotels, die Geschäfte, das ganze vielfältige Fremdengewerbe bedroht waren, zeigte sich mächtiger in der Stadt als Wahrheitsliebe und Achtung vor internationalen Abmachungen; sie vermochte die Behörde, ihre Politik des Verschweigens und des Ableugnens hartnäckig aufrecht zu erhalten.
Das kommt vertraut vor – wenn auch nicht aus Italien, sondern eher aus dem Trumpschen Amerika. Keine Quarantäne aus Rücksicht auf das Kapital, die Hoteliers, die Restaurants, die Wirtschaft. Am Ende erliegt der Schriftsteller der Krankheit, die er sich zuzog, weil er beiläufig ein paar überreife Erdbeeren verzehrt hatte. Die Entvölkerung der Stadt geschieht in „Der Tod in Venedig“ eher verborgen. Plätze im Hotel bleiben frei, die Touristen bleiben aus. Der Protagonist zieht keinen Gewinn daraus, außer, dass er sich nun umso mehr auf das Objekt seines Begehrens fokussieren kann. Es geschieht nebenbei. Man muss also unterscheiden zwischen der sich leerenden Stadt im Bann einer Epidemie und der Erfahrung einer leeren Stadt, die neue und bisher unentdeckte Seiten offenbart.
Die cineastische Lehre II
 Das kann man anhand eines filmischen Essays nachvollziehen, den ARTE im Auftrag des ZDF über „Die Corona-Geisterstädte - Metropolen im Lockdown“ produziert und gesendet hat. Dieser Film, den Sie sich unbedingt anschauen sollten (Arte Mediathek) ist in einem gewissen Sinn ein Loblied auf den Stillstand – auch wenn er von Geisterstädten spricht.
Das kann man anhand eines filmischen Essays nachvollziehen, den ARTE im Auftrag des ZDF über „Die Corona-Geisterstädte - Metropolen im Lockdown“ produziert und gesendet hat. Dieser Film, den Sie sich unbedingt anschauen sollten (Arte Mediathek) ist in einem gewissen Sinn ein Loblied auf den Stillstand – auch wenn er von Geisterstädten spricht.
 Der Film hat mich wirklich fasziniert, als ich ihn gesehen habe. Die Corona-Krise hat uns Zugänge zu Paris und Venedig eröffnet (die anderen gezeigten Städte London und New York kann ich nicht beurteilen), die so zuvor nicht sichtbar waren, weil sie von Touristenströmen und vom Kapitalismus überlagert wurden. Was für Bilder von Venedig!!! Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das wurde hier wahrnehmbar. In 1500 Jahren hat es so eine Situation nicht gegeben – nicht zu Pest- oder Cholerazeiten, nicht während all der kriegerischen Auseinandersetzungen, von denen die Geschichte ja reich ist.
Der Film hat mich wirklich fasziniert, als ich ihn gesehen habe. Die Corona-Krise hat uns Zugänge zu Paris und Venedig eröffnet (die anderen gezeigten Städte London und New York kann ich nicht beurteilen), die so zuvor nicht sichtbar waren, weil sie von Touristenströmen und vom Kapitalismus überlagert wurden. Was für Bilder von Venedig!!! Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das wurde hier wahrnehmbar. In 1500 Jahren hat es so eine Situation nicht gegeben – nicht zu Pest- oder Cholerazeiten, nicht während all der kriegerischen Auseinandersetzungen, von denen die Geschichte ja reich ist.
Venedig für sich, an sich, freigesetzt von all den kommerziellen Interessen, die es in den letzten 1500 Jahren dominiert haben. Kann man das nicht wirklich als ein – hoffentlich einmaliges – Geschenk begreifen, eines, dass wir vielleicht nicht vor Ort, aber wenigstens medial vermittelt wahrnehmen können? Mir jedenfalls ging es so. Es ist gar nicht so, dass es um ein menschenleeres Freilichtmuseum geht, durch das nun einige stellvertretend für uns wandern können, das wäre banal. Ich habe vielmehr das Gefühl, dass das leere Venedig eine eigene Lebendigkeit bekommt, ein Eigenleben, eine eigene Sprache. Bei den Bildern über London und New York im ARTE-Film fiel mehr dagegen mehr das Fehlen der Menschen auf und nicht die Eigensprachlichkeit der Städte.
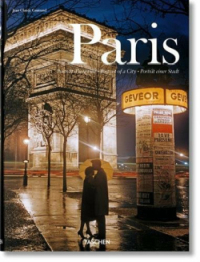 Bei Paris dagegen habe ich gedacht, was das für eine Gelegenheit ist, ein anderes Bild der Stadt zu entwickeln. Jean-Claude Gautrands Fotografie-Geschichte der Stadt Paris ist mit Fotos gefüllt, die Menschen kunstvoll vor Stadtszenen drapieren. Das entfällt nun und ermöglicht neue Wahrnehmungen, nicht des Verlustes, sondern neuer Einsichten. Der Fotograf, der im ARTE-Film mit seiner Kamera durch Paris streift, sagte offen und ehrlich, dass er, wenn die Quarantäne fortdauern würde, nicht unglücklich sein würde. Und ich würde ihm zustimmen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Jedenfalls bin ich dankbar dafür, dass er nun durch die Stadt streift, in der ich zuletzt vor einem Jahr kurz vor dem Brand von Notre Dame war, und Fotos schießt, die diesen einmaligen und unglaublichen Moment festhalten.
Bei Paris dagegen habe ich gedacht, was das für eine Gelegenheit ist, ein anderes Bild der Stadt zu entwickeln. Jean-Claude Gautrands Fotografie-Geschichte der Stadt Paris ist mit Fotos gefüllt, die Menschen kunstvoll vor Stadtszenen drapieren. Das entfällt nun und ermöglicht neue Wahrnehmungen, nicht des Verlustes, sondern neuer Einsichten. Der Fotograf, der im ARTE-Film mit seiner Kamera durch Paris streift, sagte offen und ehrlich, dass er, wenn die Quarantäne fortdauern würde, nicht unglücklich sein würde. Und ich würde ihm zustimmen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Jedenfalls bin ich dankbar dafür, dass er nun durch die Stadt streift, in der ich zuletzt vor einem Jahr kurz vor dem Brand von Notre Dame war, und Fotos schießt, die diesen einmaligen und unglaublichen Moment festhalten.
Das Schweigen der Städte II
Vor zwei Monaten war ich vier verschiedenen Webcams in Europa gefolgt, die Einsichten in die neue Leere der Städte vermittelten – Webcams in Venedig, in Rom, in Mailand und in Madrid. Nun, 2 Monate später, suche ich die gleichen Webcams wieder auf und schaue, was sich nach der Aufhebung der strikten Einschränkungen verändert hat. Je nach Lockerungsbestimmungen der einzelnen Länder und Regionalverwaltungen ergeben sich dabei andere Einsichten.
Venedig

 Der Platz vor dem Markusdom war im März 2020 menschenleer. Und daran hat sich bis heute, zwei Monate später, wenig geändert. Venedig ist ein Ort, der durch und durch vom Tourismus abhängig ist und solange dieser europaweit, ja weltweit nicht wieder angelaufen ist, vermögen die wenigen Bewohner von Venedig die Stadt nicht zu beleben. Insofern ist Venedig die Stadt, die momentan auf der Webcam noch die wenigsten Veränderungen aufweist.
Der Platz vor dem Markusdom war im März 2020 menschenleer. Und daran hat sich bis heute, zwei Monate später, wenig geändert. Venedig ist ein Ort, der durch und durch vom Tourismus abhängig ist und solange dieser europaweit, ja weltweit nicht wieder angelaufen ist, vermögen die wenigen Bewohner von Venedig die Stadt nicht zu beleben. Insofern ist Venedig die Stadt, die momentan auf der Webcam noch die wenigsten Veränderungen aufweist.
Man kann auf Skyline, wenn man die Webcam vom Markusplatz aufruft, sich auch den Zeitraffer des letzten Tages anschauen. Und dann sieht man, dass zurzeit, also Mitte Mai 2020, nur etwa 100 Personen zeitgleich auf dem Platz sind, vor allem Familien mit ihren Kindern und Berufstätige. Gegen Abend, wenn die Beleuchtung anspringt, leert sich der Platz nahezu vollständig. Man muss wahrscheinlich warten, bis die Cafés wieder öffnen, um die Differenz von geleertem Markusplatz und gefülltem Markusplatz richtig erfassen zu können. Es ist eine Stimmung des Wartens und Ausharrens.
Mailand

 Das ist in Mailand natürlich anders, hier blicken wir auf eine Millionenmetropole nach der Aufhebung des strikten Lockdowns. Mailand gehört als Teil der Lombardei zu den am stärksten in Italien betroffenen Regionen, die Stadt selbst meldete über 22.000 Infizierte. Das ist eine Rate, die bei einer Einwohnerzahl von 1,4 Millionen mit 1,56 deutlich höher als der Schnitt europäischer Länder liegt, deutlich höher als der allgemeine Schnitt in Italien (0,37), aber noch etwas niedriger als der Schnitt in der Stadt New York (1,85). Das erhöht den Druck auf die Bevölkerung, sich auch weiterhin vorsichtig in der Öffentlichkeit zu bewegen. Und dennoch können wir auf der Webcam immer mehr Menschen sehen, die über den Platz gehen, bis hin zu ersten Demonstrationen, die den Platz vor der Kirche, wenn nicht füllen, so aber doch merklich beleben. Ob es sich um Protestler gegen die Corona-Auflagen handelt oder – wahrscheinlicher – um eine Solidaritätskundgebung lässt sich anhand der Webcam-Bilder nicht entscheiden. Auf Tripadvisor finde ich Mitte Mai eine schöne Beschreibung eines Mailänders zur aktuellen Situation der Viktor-Emanuel-Galerie:
Das ist in Mailand natürlich anders, hier blicken wir auf eine Millionenmetropole nach der Aufhebung des strikten Lockdowns. Mailand gehört als Teil der Lombardei zu den am stärksten in Italien betroffenen Regionen, die Stadt selbst meldete über 22.000 Infizierte. Das ist eine Rate, die bei einer Einwohnerzahl von 1,4 Millionen mit 1,56 deutlich höher als der Schnitt europäischer Länder liegt, deutlich höher als der allgemeine Schnitt in Italien (0,37), aber noch etwas niedriger als der Schnitt in der Stadt New York (1,85). Das erhöht den Druck auf die Bevölkerung, sich auch weiterhin vorsichtig in der Öffentlichkeit zu bewegen. Und dennoch können wir auf der Webcam immer mehr Menschen sehen, die über den Platz gehen, bis hin zu ersten Demonstrationen, die den Platz vor der Kirche, wenn nicht füllen, so aber doch merklich beleben. Ob es sich um Protestler gegen die Corona-Auflagen handelt oder – wahrscheinlicher – um eine Solidaritätskundgebung lässt sich anhand der Webcam-Bilder nicht entscheiden. Auf Tripadvisor finde ich Mitte Mai eine schöne Beschreibung eines Mailänders zur aktuellen Situation der Viktor-Emanuel-Galerie:
"Als ich nach über zwei Monaten selbst auferlegter häuslicher Isolation endlich ins Stadtzentrum zurückkehrte, habe ich mir, wenn auch nur kurz, den traditionellen Gang durch die Galerie ("quater pass in Galleria")* gegönnt, die ich halbverlassen und auf einmal in einer völlig ungewohnten Atmosphäre vorfand, auch wegen diverser Geschäfte, die geschlossen waren. Das kann anfangs desorientieren / orientierungslos machen, aber dann gewinnen Stille und Ruhe die Oberhand und verleiten, den Schritt weiter zu verlangsamen und stehenzubleiben, um die klaren Perspektiven und die vielen architektonischen und künstlerischen Details zu bewundern, die den Reichtum der Galerie ausmachen."
*"fare i quater pass in Galleria" sagen die alten Mailänder, wenn sie in gewohnter Manier durch den "Salon" ihrer Stadt, die Galleria Vittorio Emanuele, gehen - "fare i quattro passi", die vier Schritte gehen.
Rom

 Die Webcam am Fuße der Spanischen Treppe in Rom war mir von allen beobachteten Webcams am liebsten, da sie nicht weit über allem schwebt, sondern ganz nah am Geschehen des Platzes und den Menschen darauf angebracht ist. Aber hier hat mich die Aufhebung des Lockdowns am schmerzlichsten getroffen.
Die Webcam am Fuße der Spanischen Treppe in Rom war mir von allen beobachteten Webcams am liebsten, da sie nicht weit über allem schwebt, sondern ganz nah am Geschehen des Platzes und den Menschen darauf angebracht ist. Aber hier hat mich die Aufhebung des Lockdowns am schmerzlichsten getroffen.
Am Anfang waren es die Römer selbst, die bewaffnet mit Digitalkameras und den Linsen ihrer Smartphones auftauchten, um die leere Spanische Treppe zu fotografieren, so als ob sie sich nach acht Wochen davon überzeugen mussten, ob es dieses Kulturdenkmal wirklich noch gibt. Sie testeten aus, was geht und was nicht. Mehrere Tage wurde man noch vertrieben, wenn man sich auf den Brunnenrand setzte, um sich zu erholen, jetzt schreiten die Polizisten nicht mehr ein. Auch das „normale“ Publikum an derartigen öffentlichen Orten kehrt wieder zurück, sie lungern am Rande herum, unterhalten sich. Die Mitarbeiter der Museen rund um die Spanische Treppe scheinen zurückzukehren, um die Wiedereröffnung vorzubereiten. Das englische Café Babingtons hat aber immer noch geschlossen, auch wenn es am Anfang der Coronakrise den Kunden versichert hatte, nur kurz geschlossen zu sein. Der Acqua di Parma Shop neben dem Keats-Shelly-Museum hat dagegen schon geöffnet und verkauft Parfüm und Accessoires. In Zeiten, in den gerade keine Polizisten vor Ort sind, setzen sich nun auch Besucher wieder auf die Stufen der Spanischen Treppe, so wieder ein Stück „Normalität“ herbeiführend.
Zugleich wird mit all dem ein Stück Profanität hergestellt, das Geheimnisvolle, das den Platz in den letzten zwei Monaten ausgezeichnet hatte, verschwindet, viel Banales kehrt zurück.
Madrid

 In Madrid ist immer noch wenig los, das liegt aber vermutlich am geschichteten Zeitmodell, das den in Altersklassen segmentierten Menschen vorschreibt, nur zu ganz bestimmten Zeiten in die Öffentlichkeit zu gehen. Die autonome Region Madrid umfasst 6.685.471 Einwohner, von denen 27.509 als infiziert gemeldet wurden. Das ist die zweithöchste Infektionsrate Spaniens, mehr als doppelt so viel wie im Landesschnitt.
In Madrid ist immer noch wenig los, das liegt aber vermutlich am geschichteten Zeitmodell, das den in Altersklassen segmentierten Menschen vorschreibt, nur zu ganz bestimmten Zeiten in die Öffentlichkeit zu gehen. Die autonome Region Madrid umfasst 6.685.471 Einwohner, von denen 27.509 als infiziert gemeldet wurden. Das ist die zweithöchste Infektionsrate Spaniens, mehr als doppelt so viel wie im Landesschnitt.
 Anfang Mai gab es auf der Puerta del Sol eine öffentliche Veranstaltung mit Ansprachen und mit musikalischen Einblendungen für die Helfer in der Krise. Da war der Platz natürlich stärker gefüllt (vor allem mit dem Fuhrpark der Hilfskräfte), aber jetzt ist immer noch überraschend wenig los, wenn man bedenkt, dass die Puerta del Sol nicht nur ein städtischer Knotenpunkt, sondern auch das Zentrum Spaniens ist.
Anfang Mai gab es auf der Puerta del Sol eine öffentliche Veranstaltung mit Ansprachen und mit musikalischen Einblendungen für die Helfer in der Krise. Da war der Platz natürlich stärker gefüllt (vor allem mit dem Fuhrpark der Hilfskräfte), aber jetzt ist immer noch überraschend wenig los, wenn man bedenkt, dass die Puerta del Sol nicht nur ein städtischer Knotenpunkt, sondern auch das Zentrum Spaniens ist.
Post-Skriptum: The Rolling Stones - Living in a Ghost Town (2020)

Der Leere / Lehre der Städte gehen auch die Rolling Stones als „Homies“ in ihrem neuen Stück „Living in a Ghost Town“ nach. Und wie fast immer, wenn die Stones singen, haben sie in der Sache nicht recht [Sie merken, ich bin kein Stones-Fan]. Als Rock’n’Roller verstehen sie die Lehre der leeren Städte nicht. Mit vollem Pathos beschwören die Stones die alte Hektik, den Rock’n’Roll-Rhythmus der guten alten Zeit. „Life was so beautiful - Then we all got locked down“.
Once this place was humming
And the air was full of drumming
The sound of cymbals crashing
Glasses were all smashing
Trumpets were all screaming
Saxophones were blaring
Nobody was caring if it's day or night
 Ja, den alt gewordenen Rolling Stones ist langweilig: So much time to lose / Just staring at my phone. Das ist Welten entfernt von der Selbstbesinnung eines späten Leonard Cohen, der Souveränität des alten Pete Seeger oder gar des Flaneurs mit Schildkröte im Sinne Walter Benjamins. Umgesetzt wird das Lied der Stones videoästhetisch in einer Orgie extrem beschleunigter Bilder in Fish-Eye-Optik, die Jagd geht über Plätze, durch Straßen, U-Bahn-Stationen und Metrozüge. Da, wo das Bild für einen Bruchteil einer Sekunde zur Ruhe kommt, kann man es genießen, wie etwa beim historischen Leadenhall Market in London, aber nur einen Augenblick später hetzt die Fish-Eye-Kamera im juvenilen Wahn wie bescheuert die Passage entlang und vernichtet jede sinnliche Wahrnehmung. Dabei wurde schon vor der Corona-Krise der Leadenhall-Market am liebsten menschenleer fotografiert.
Ja, den alt gewordenen Rolling Stones ist langweilig: So much time to lose / Just staring at my phone. Das ist Welten entfernt von der Selbstbesinnung eines späten Leonard Cohen, der Souveränität des alten Pete Seeger oder gar des Flaneurs mit Schildkröte im Sinne Walter Benjamins. Umgesetzt wird das Lied der Stones videoästhetisch in einer Orgie extrem beschleunigter Bilder in Fish-Eye-Optik, die Jagd geht über Plätze, durch Straßen, U-Bahn-Stationen und Metrozüge. Da, wo das Bild für einen Bruchteil einer Sekunde zur Ruhe kommt, kann man es genießen, wie etwa beim historischen Leadenhall Market in London, aber nur einen Augenblick später hetzt die Fish-Eye-Kamera im juvenilen Wahn wie bescheuert die Passage entlang und vernichtet jede sinnliche Wahrnehmung. Dabei wurde schon vor der Corona-Krise der Leadenhall-Market am liebsten menschenleer fotografiert.
 Und man kann sich ja fragen, warum ist das so? Und dann käme man zu der Erkenntnis: weil diese Orte ihren eigenen Ausdruck haben. Wir leben aktuell gerade nicht in Ghosttowns, die Städte kommen nur zu sich selbst, ihre ortsspezifische Ästhetik wird sichtbar. Und die gleiche Beschleunigung, die die Stones nun videoästhetisch zelebrieren, brachte eben auch den Corona-Virus rasend schnell rund um die Welt. Hotspots sind eben genau das: Hotspots. Nur Entschleunigung hilft da weiter.
Und man kann sich ja fragen, warum ist das so? Und dann käme man zu der Erkenntnis: weil diese Orte ihren eigenen Ausdruck haben. Wir leben aktuell gerade nicht in Ghosttowns, die Städte kommen nur zu sich selbst, ihre ortsspezifische Ästhetik wird sichtbar. Und die gleiche Beschleunigung, die die Stones nun videoästhetisch zelebrieren, brachte eben auch den Corona-Virus rasend schnell rund um die Welt. Hotspots sind eben genau das: Hotspots. Nur Entschleunigung hilft da weiter.
Vielleicht wäre es gut gewesen, die Rolling Stones hätten im Home-Office ein paarmal ihren Klassiker 19th Nervous Breakdown von 1965 vor sich hin gespielt, bevor sie die Stille der Geisterstädte beklagen und die Rückkehr zur Hektik des gewohnten Lebens einfordern.
|
You're the kind of person you meet
at certain dismal, dull affairs
Center of a crowd, talking much too loud,
running up and down the stairs
Well, it seems to me that you have seen
too much in too few years
And though you've tried you just can't hide
your eyes are edged with tears
You better stop, look around
Here it comes, here it comes,
here it comes, here it comes
Here comes your 19th nervous breakdown
|
Du bist die Art einer Person, die man bestimmt
bei tristen, langweiligen Angelegenheiten trifft
Mitten in der Menge, sprichst du viel zu laut,
rennst die Treppen rauf und runter
Nun, es scheint mir, du hast schon zu viel gesehen
in viel zu wenigen Jahren
Auch wenn du's versuchst, du kannst nicht verbergen
deine Augen sind umrandet mit Tränen
Halt besser an und schau dich um
Hier kommt er, hier kommt er,
Hier kommt er, hier kommt er
hier kommt dein 19er Nervenzusammenbruch
|
 Zeitgeschichtlich interessant ist, dass die Aufzeichnung des Original-Auftritts der Stones in den „Top of the Pops“ verloren gegangen ist. Die BBC strahlte aber im gleichen Jahr eine Dokumentation über „Depressive Frauen“ aus, in der sich eine Frau in einem Plattenladen 19th Nervous Breakdown auflegen lässt und dann in eine Hörkabine geht, um es anzuhören. Die BBC blendet dazu Ausschnitte aus dem „Top of the Pops“-Auftritt der Stones ein. Ich hatte diese Kultur der Plattenläden mit den Kabinen, in denen man sich Musik anhören konnte, vollständig verdrängt (vielleicht gab es sie in Deutschland auch so nicht). Aber diese Hörkabinen gehören auch zur Entschleunigung, des Sich-Zurückziehens – wovon viele Popstars in ihren Biographien berichten (es gibt eine berühmte, geradezu intime Szene in einer Hörkabine mit Ingrid Bergmann und Goldie Hawn im Film „Die Kaktusblüte“ von 1969). Aber Social Distancing war in den Hörkabinen natürlich nicht angesagt. „Living in a Ghost Town“ dagegen beschwört eine Kultur des Lebens als Taumel, als unendliche Beschleunigung, die pulsierende Stadt, die niemals schläft, die Kultur, in der immer etwas los. Da ist jede Still-Stellung, und sei sie nur für lächerliche zwei Monate, ein Alptraum. Für mich nicht (mehr).
Zeitgeschichtlich interessant ist, dass die Aufzeichnung des Original-Auftritts der Stones in den „Top of the Pops“ verloren gegangen ist. Die BBC strahlte aber im gleichen Jahr eine Dokumentation über „Depressive Frauen“ aus, in der sich eine Frau in einem Plattenladen 19th Nervous Breakdown auflegen lässt und dann in eine Hörkabine geht, um es anzuhören. Die BBC blendet dazu Ausschnitte aus dem „Top of the Pops“-Auftritt der Stones ein. Ich hatte diese Kultur der Plattenläden mit den Kabinen, in denen man sich Musik anhören konnte, vollständig verdrängt (vielleicht gab es sie in Deutschland auch so nicht). Aber diese Hörkabinen gehören auch zur Entschleunigung, des Sich-Zurückziehens – wovon viele Popstars in ihren Biographien berichten (es gibt eine berühmte, geradezu intime Szene in einer Hörkabine mit Ingrid Bergmann und Goldie Hawn im Film „Die Kaktusblüte“ von 1969). Aber Social Distancing war in den Hörkabinen natürlich nicht angesagt. „Living in a Ghost Town“ dagegen beschwört eine Kultur des Lebens als Taumel, als unendliche Beschleunigung, die pulsierende Stadt, die niemals schläft, die Kultur, in der immer etwas los. Da ist jede Still-Stellung, und sei sie nur für lächerliche zwei Monate, ein Alptraum. Für mich nicht (mehr).

 Zeitgeschichtlich interessant ist, dass die Aufzeichnung des Original-Auftritts der Stones in den „Top of the Pops“ verloren gegangen ist. Die BBC strahlte aber im gleichen Jahr eine Dokumentation über „Depressive Frauen“ aus, in der sich eine Frau in einem Plattenladen 19th Nervous Breakdown auflegen lässt und dann in eine Hörkabine geht, um es anzuhören. Die BBC blendet dazu Ausschnitte aus dem „Top of the Pops“-Auftritt der Stones ein. Ich hatte diese Kultur der Plattenläden mit den Kabinen, in denen man sich Musik anhören konnte, vollständig verdrängt (vielleicht gab es sie in Deutschland auch so nicht). Aber diese Hörkabinen gehören auch zur Entschleunigung, des Sich-Zurückziehens – wovon viele Popstars in ihren Biographien berichten (es gibt eine berühmte, geradezu intime Szene in einer Hörkabine mit Ingrid Bergmann und Goldie Hawn im Film „Die Kaktusblüte“ von 1969). Aber Social Distancing war in den Hörkabinen natürlich nicht angesagt. „Living in a Ghost Town“ dagegen beschwört eine Kultur des Lebens als Taumel, als unendliche Beschleunigung, die pulsierende Stadt, die niemals schläft, die Kultur, in der immer etwas los. Da ist jede Still-Stellung, und sei sie nur für lächerliche zwei Monate, ein Alptraum. Für mich nicht (mehr).
Zeitgeschichtlich interessant ist, dass die Aufzeichnung des Original-Auftritts der Stones in den „Top of the Pops“ verloren gegangen ist. Die BBC strahlte aber im gleichen Jahr eine Dokumentation über „Depressive Frauen“ aus, in der sich eine Frau in einem Plattenladen 19th Nervous Breakdown auflegen lässt und dann in eine Hörkabine geht, um es anzuhören. Die BBC blendet dazu Ausschnitte aus dem „Top of the Pops“-Auftritt der Stones ein. Ich hatte diese Kultur der Plattenläden mit den Kabinen, in denen man sich Musik anhören konnte, vollständig verdrängt (vielleicht gab es sie in Deutschland auch so nicht). Aber diese Hörkabinen gehören auch zur Entschleunigung, des Sich-Zurückziehens – wovon viele Popstars in ihren Biographien berichten (es gibt eine berühmte, geradezu intime Szene in einer Hörkabine mit Ingrid Bergmann und Goldie Hawn im Film „Die Kaktusblüte“ von 1969). Aber Social Distancing war in den Hörkabinen natürlich nicht angesagt. „Living in a Ghost Town“ dagegen beschwört eine Kultur des Lebens als Taumel, als unendliche Beschleunigung, die pulsierende Stadt, die niemals schläft, die Kultur, in der immer etwas los. Da ist jede Still-Stellung, und sei sie nur für lächerliche zwei Monate, ein Alptraum. Für mich nicht (mehr).
 Das spielt auch in Thomas Manns 1912 erschienener Novelle „Der Tod in Venedig“ eine Rolle, insbesondere im fünften Kapitel. Auch dort ist es eine Seuche, die die Lagunenstadt trifft und am Ende den Protagonisten dahinrafft. Ein renommierter, etwas älterer Schriftsteller kommt während einer Sommerreise nach Venedig, wohnt auf dem Lido und verliebt sich dort in einen schönen Knaben, der mit Mutter, Schwestern und Gouvernante im selben Hotel wohnt. Im fünften Kapitel wird ihm klar, dass etwas Ungewöhnliches in der Stadt vorgeht, sein Hotel leert sich, die Touristen verlassen die Stadt, ohne dass er weiß, warum. So erkundigt er sich in einem Reisebüro am Markusplatz, was denn los sei. Offiziell nichts, aber unter der Hand erfährt er, dass in Venedig die Cholera wütet und es für Touristen angeraten wäre, die Stadt sofort zu verlassen.
Das spielt auch in Thomas Manns 1912 erschienener Novelle „Der Tod in Venedig“ eine Rolle, insbesondere im fünften Kapitel. Auch dort ist es eine Seuche, die die Lagunenstadt trifft und am Ende den Protagonisten dahinrafft. Ein renommierter, etwas älterer Schriftsteller kommt während einer Sommerreise nach Venedig, wohnt auf dem Lido und verliebt sich dort in einen schönen Knaben, der mit Mutter, Schwestern und Gouvernante im selben Hotel wohnt. Im fünften Kapitel wird ihm klar, dass etwas Ungewöhnliches in der Stadt vorgeht, sein Hotel leert sich, die Touristen verlassen die Stadt, ohne dass er weiß, warum. So erkundigt er sich in einem Reisebüro am Markusplatz, was denn los sei. Offiziell nichts, aber unter der Hand erfährt er, dass in Venedig die Cholera wütet und es für Touristen angeraten wäre, die Stadt sofort zu verlassen. Mitte Mai dieses Jahres fand man zu Venedig an ein und demselben Tage die furchtbaren Vibrionen in den ausgemergelten, schwärzlichen Leichnamen eines Schifferknechtes und einer Grünwarenhändlerin. Die Fälle wurden verheimlicht. Aber nach einer Woche waren es deren zehn, waren es zwanzig, dreißig und zwar in verschiedenen Quartieren. … Venedigs Obrigkeit ließ antworten, dass die Gesundheitsverhältnisse der Stadt nie besser gewesen seien und traf die notwendigsten Maßregeln zur Bekämpfung. … Ja, es schien, als ob die Seuche eine Neubelebung ihrer Kräfte erfahren, als ob die Tenazität und Fruchtbarkeit ihrer Erreger sich verdoppelt hätte. Fälle der Genesung waren sehr selten; achtzig vom Hundert der Befallenen starben und zwar auf entsetzliche Weise, denn das Übel trat mit äußerster Wildheit … Anfang Juni füllten sich in der Stille die Isolierbaracken des Ospedale civico, in den beiden Waisenhäusern begann es an Platz zu mangeln, und ein schauerlich reger Verkehr herrschte zwischen dem Kai der neuen Fundamente und San Michele, der Friedhofsinsel. Aber die Furcht vor allgemeiner Schädigung, die Rücksicht auf die kürzlich eröffnete Gemäldeausstellung in den öffentlichen Gärten, auf die gewaltigen Ausfälle, von denen im Falle der Panik und des Verrufes die Hotels, die Geschäfte, das ganze vielfältige Fremdengewerbe bedroht waren, zeigte sich mächtiger in der Stadt als Wahrheitsliebe und Achtung vor internationalen Abmachungen; sie vermochte die Behörde, ihre Politik des Verschweigens und des Ableugnens hartnäckig aufrecht zu erhalten.
Mitte Mai dieses Jahres fand man zu Venedig an ein und demselben Tage die furchtbaren Vibrionen in den ausgemergelten, schwärzlichen Leichnamen eines Schifferknechtes und einer Grünwarenhändlerin. Die Fälle wurden verheimlicht. Aber nach einer Woche waren es deren zehn, waren es zwanzig, dreißig und zwar in verschiedenen Quartieren. … Venedigs Obrigkeit ließ antworten, dass die Gesundheitsverhältnisse der Stadt nie besser gewesen seien und traf die notwendigsten Maßregeln zur Bekämpfung. … Ja, es schien, als ob die Seuche eine Neubelebung ihrer Kräfte erfahren, als ob die Tenazität und Fruchtbarkeit ihrer Erreger sich verdoppelt hätte. Fälle der Genesung waren sehr selten; achtzig vom Hundert der Befallenen starben und zwar auf entsetzliche Weise, denn das Übel trat mit äußerster Wildheit … Anfang Juni füllten sich in der Stille die Isolierbaracken des Ospedale civico, in den beiden Waisenhäusern begann es an Platz zu mangeln, und ein schauerlich reger Verkehr herrschte zwischen dem Kai der neuen Fundamente und San Michele, der Friedhofsinsel. Aber die Furcht vor allgemeiner Schädigung, die Rücksicht auf die kürzlich eröffnete Gemäldeausstellung in den öffentlichen Gärten, auf die gewaltigen Ausfälle, von denen im Falle der Panik und des Verrufes die Hotels, die Geschäfte, das ganze vielfältige Fremdengewerbe bedroht waren, zeigte sich mächtiger in der Stadt als Wahrheitsliebe und Achtung vor internationalen Abmachungen; sie vermochte die Behörde, ihre Politik des Verschweigens und des Ableugnens hartnäckig aufrecht zu erhalten. Das kann man anhand eines filmischen Essays nachvollziehen, den ARTE im Auftrag des ZDF über „Die Corona-Geisterstädte - Metropolen im Lockdown“ produziert und gesendet hat. Dieser Film, den Sie sich unbedingt anschauen sollten (
Das kann man anhand eines filmischen Essays nachvollziehen, den ARTE im Auftrag des ZDF über „Die Corona-Geisterstädte - Metropolen im Lockdown“ produziert und gesendet hat. Dieser Film, den Sie sich unbedingt anschauen sollten ( Der Film hat mich wirklich fasziniert, als ich ihn gesehen habe. Die Corona-Krise hat uns Zugänge zu Paris und Venedig eröffnet (die anderen gezeigten Städte London und New York kann ich nicht beurteilen), die so zuvor nicht sichtbar waren, weil sie von Touristenströmen und vom Kapitalismus überlagert wurden. Was für Bilder von Venedig!!! Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das wurde hier wahrnehmbar. In 1500 Jahren hat es so eine Situation nicht gegeben – nicht zu Pest- oder Cholerazeiten, nicht während all der kriegerischen Auseinandersetzungen, von denen die Geschichte ja reich ist.
Der Film hat mich wirklich fasziniert, als ich ihn gesehen habe. Die Corona-Krise hat uns Zugänge zu Paris und Venedig eröffnet (die anderen gezeigten Städte London und New York kann ich nicht beurteilen), die so zuvor nicht sichtbar waren, weil sie von Touristenströmen und vom Kapitalismus überlagert wurden. Was für Bilder von Venedig!!! Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das wurde hier wahrnehmbar. In 1500 Jahren hat es so eine Situation nicht gegeben – nicht zu Pest- oder Cholerazeiten, nicht während all der kriegerischen Auseinandersetzungen, von denen die Geschichte ja reich ist.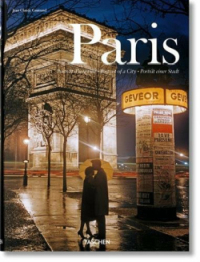 Bei Paris dagegen habe ich gedacht, was das für eine Gelegenheit ist, ein anderes Bild der Stadt zu entwickeln. Jean-Claude Gautrands Fotografie-Geschichte der Stadt Paris ist mit Fotos gefüllt, die Menschen kunstvoll vor Stadtszenen drapieren. Das entfällt nun und ermöglicht neue Wahrnehmungen, nicht des Verlustes, sondern neuer Einsichten. Der Fotograf, der im ARTE-Film mit seiner Kamera durch Paris streift, sagte offen und ehrlich, dass er, wenn die Quarantäne fortdauern würde, nicht unglücklich sein würde. Und ich würde ihm zustimmen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Jedenfalls bin ich dankbar dafür, dass er nun durch die Stadt streift, in der ich zuletzt vor einem Jahr kurz vor dem Brand von Notre Dame war, und Fotos schießt, die diesen einmaligen und unglaublichen Moment festhalten.
Bei Paris dagegen habe ich gedacht, was das für eine Gelegenheit ist, ein anderes Bild der Stadt zu entwickeln. Jean-Claude Gautrands Fotografie-Geschichte der Stadt Paris ist mit Fotos gefüllt, die Menschen kunstvoll vor Stadtszenen drapieren. Das entfällt nun und ermöglicht neue Wahrnehmungen, nicht des Verlustes, sondern neuer Einsichten. Der Fotograf, der im ARTE-Film mit seiner Kamera durch Paris streift, sagte offen und ehrlich, dass er, wenn die Quarantäne fortdauern würde, nicht unglücklich sein würde. Und ich würde ihm zustimmen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Jedenfalls bin ich dankbar dafür, dass er nun durch die Stadt streift, in der ich zuletzt vor einem Jahr kurz vor dem Brand von Notre Dame war, und Fotos schießt, die diesen einmaligen und unglaublichen Moment festhalten.
 Der Platz vor dem Markusdom war im März 2020 menschenleer. Und daran hat sich bis heute, zwei Monate später, wenig geändert. Venedig ist ein Ort, der durch und durch vom Tourismus abhängig ist und solange dieser europaweit, ja weltweit nicht wieder angelaufen ist, vermögen die wenigen Bewohner von Venedig die Stadt nicht zu beleben. Insofern ist Venedig die Stadt, die momentan auf der Webcam noch die wenigsten Veränderungen aufweist.
Der Platz vor dem Markusdom war im März 2020 menschenleer. Und daran hat sich bis heute, zwei Monate später, wenig geändert. Venedig ist ein Ort, der durch und durch vom Tourismus abhängig ist und solange dieser europaweit, ja weltweit nicht wieder angelaufen ist, vermögen die wenigen Bewohner von Venedig die Stadt nicht zu beleben. Insofern ist Venedig die Stadt, die momentan auf der Webcam noch die wenigsten Veränderungen aufweist.
 Das ist in Mailand natürlich anders, hier blicken wir auf eine Millionenmetropole nach der Aufhebung des strikten Lockdowns. Mailand gehört als Teil der Lombardei zu den am stärksten in Italien betroffenen Regionen, die Stadt selbst meldete über 22.000 Infizierte. Das ist eine Rate, die bei einer Einwohnerzahl von 1,4 Millionen mit 1,56 deutlich höher als der Schnitt europäischer Länder liegt, deutlich höher als der allgemeine Schnitt in Italien (0,37), aber noch etwas niedriger als der Schnitt in der Stadt New York (1,85). Das erhöht den Druck auf die Bevölkerung, sich auch weiterhin vorsichtig in der Öffentlichkeit zu bewegen. Und dennoch können wir auf der Webcam immer mehr Menschen sehen, die über den Platz gehen, bis hin zu ersten Demonstrationen, die den Platz vor der Kirche, wenn nicht füllen, so aber doch merklich beleben. Ob es sich um Protestler gegen die Corona-Auflagen handelt oder – wahrscheinlicher – um eine Solidaritätskundgebung lässt sich anhand der Webcam-Bilder nicht entscheiden. Auf Tripadvisor finde ich Mitte Mai eine schöne Beschreibung eines Mailänders zur aktuellen Situation der Viktor-Emanuel-Galerie:
Das ist in Mailand natürlich anders, hier blicken wir auf eine Millionenmetropole nach der Aufhebung des strikten Lockdowns. Mailand gehört als Teil der Lombardei zu den am stärksten in Italien betroffenen Regionen, die Stadt selbst meldete über 22.000 Infizierte. Das ist eine Rate, die bei einer Einwohnerzahl von 1,4 Millionen mit 1,56 deutlich höher als der Schnitt europäischer Länder liegt, deutlich höher als der allgemeine Schnitt in Italien (0,37), aber noch etwas niedriger als der Schnitt in der Stadt New York (1,85). Das erhöht den Druck auf die Bevölkerung, sich auch weiterhin vorsichtig in der Öffentlichkeit zu bewegen. Und dennoch können wir auf der Webcam immer mehr Menschen sehen, die über den Platz gehen, bis hin zu ersten Demonstrationen, die den Platz vor der Kirche, wenn nicht füllen, so aber doch merklich beleben. Ob es sich um Protestler gegen die Corona-Auflagen handelt oder – wahrscheinlicher – um eine Solidaritätskundgebung lässt sich anhand der Webcam-Bilder nicht entscheiden. Auf Tripadvisor finde ich Mitte Mai eine schöne Beschreibung eines Mailänders zur aktuellen Situation der Viktor-Emanuel-Galerie:
 Die Webcam am Fuße der Spanischen Treppe in Rom war mir von allen beobachteten Webcams am liebsten, da sie nicht weit über allem schwebt, sondern ganz nah am Geschehen des Platzes und den Menschen darauf angebracht ist. Aber hier hat mich die Aufhebung des Lockdowns am schmerzlichsten getroffen.
Die Webcam am Fuße der Spanischen Treppe in Rom war mir von allen beobachteten Webcams am liebsten, da sie nicht weit über allem schwebt, sondern ganz nah am Geschehen des Platzes und den Menschen darauf angebracht ist. Aber hier hat mich die Aufhebung des Lockdowns am schmerzlichsten getroffen.
 In Madrid ist immer noch wenig los, das liegt aber vermutlich am geschichteten Zeitmodell, das den in Altersklassen segmentierten Menschen vorschreibt, nur zu ganz bestimmten Zeiten in die Öffentlichkeit zu gehen. Die autonome Region Madrid umfasst 6.685.471 Einwohner, von denen 27.509 als infiziert gemeldet wurden. Das ist die zweithöchste Infektionsrate Spaniens, mehr als doppelt so viel wie im Landesschnitt.
In Madrid ist immer noch wenig los, das liegt aber vermutlich am geschichteten Zeitmodell, das den in Altersklassen segmentierten Menschen vorschreibt, nur zu ganz bestimmten Zeiten in die Öffentlichkeit zu gehen. Die autonome Region Madrid umfasst 6.685.471 Einwohner, von denen 27.509 als infiziert gemeldet wurden. Das ist die zweithöchste Infektionsrate Spaniens, mehr als doppelt so viel wie im Landesschnitt. Anfang Mai gab es auf der Puerta del Sol eine öffentliche Veranstaltung mit Ansprachen und mit musikalischen Einblendungen für die Helfer in der Krise. Da war der Platz natürlich stärker gefüllt (vor allem mit dem Fuhrpark der Hilfskräfte), aber jetzt ist immer noch überraschend wenig los, wenn man bedenkt, dass die Puerta del Sol nicht nur ein städtischer Knotenpunkt, sondern auch das Zentrum Spaniens ist.
Anfang Mai gab es auf der Puerta del Sol eine öffentliche Veranstaltung mit Ansprachen und mit musikalischen Einblendungen für die Helfer in der Krise. Da war der Platz natürlich stärker gefüllt (vor allem mit dem Fuhrpark der Hilfskräfte), aber jetzt ist immer noch überraschend wenig los, wenn man bedenkt, dass die Puerta del Sol nicht nur ein städtischer Knotenpunkt, sondern auch das Zentrum Spaniens ist.
 Ja, den alt gewordenen Rolling Stones ist langweilig: So much time to lose / Just staring at my phone. Das ist Welten entfernt von der Selbstbesinnung eines späten
Ja, den alt gewordenen Rolling Stones ist langweilig: So much time to lose / Just staring at my phone. Das ist Welten entfernt von der Selbstbesinnung eines späten  Und man kann sich ja fragen, warum ist das so? Und dann käme man zu der Erkenntnis: weil diese Orte ihren eigenen Ausdruck haben. Wir leben aktuell gerade nicht in Ghosttowns, die Städte kommen nur zu sich selbst, ihre ortsspezifische Ästhetik wird sichtbar. Und die gleiche Beschleunigung, die die Stones nun videoästhetisch zelebrieren, brachte eben auch den Corona-Virus rasend schnell rund um die Welt. Hotspots sind eben genau das: Hotspots. Nur Entschleunigung hilft da weiter.
Und man kann sich ja fragen, warum ist das so? Und dann käme man zu der Erkenntnis: weil diese Orte ihren eigenen Ausdruck haben. Wir leben aktuell gerade nicht in Ghosttowns, die Städte kommen nur zu sich selbst, ihre ortsspezifische Ästhetik wird sichtbar. Und die gleiche Beschleunigung, die die Stones nun videoästhetisch zelebrieren, brachte eben auch den Corona-Virus rasend schnell rund um die Welt. Hotspots sind eben genau das: Hotspots. Nur Entschleunigung hilft da weiter.