Nachdenken über die antijudaistischen Folgen eines Paradigmenwechsels
Andreas Mertin
Anstoß
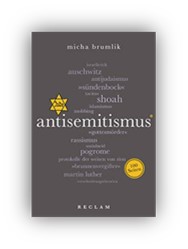 In seinem 100-Seiten-Buch über den Antisemitismus schreibt Micha Brumlik im dritten Kapitel über den „Christlichen Antijudaismus“. Dabei kommt er auch auf einen Paradigmenwechsel um die Wende zum Jahr 1000 zu sprechen, der mir gut bekannt ist, und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die jüdische Bevölkerung, über die ich bis dahin noch nie nachgedacht hatte:
In seinem 100-Seiten-Buch über den Antisemitismus schreibt Micha Brumlik im dritten Kapitel über den „Christlichen Antijudaismus“. Dabei kommt er auch auf einen Paradigmenwechsel um die Wende zum Jahr 1000 zu sprechen, der mir gut bekannt ist, und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die jüdische Bevölkerung, über die ich bis dahin noch nie nachgedacht hatte:
Der Ärger über Schulden und Zinsen wurde auf die Juden projiziert, wobei sich damals auch das Bild Jesu in Glauben und Kunst wandelte. In dem Augenblick, in dem an die Stelle des triumphierenden Weltenherrschers bzw. des argumentierenden und predigenden Rabbi von Nazareth der am Kreuz hängende Schmerzensmann trat, drängte sich die Frage nach den Urhebern seines Leidens auf. Eine Antwort war schnell gefunden: die Juden! Die Passion Jesu rückte ins Zentrum des Glaubens, und damit wurde auch das Kruzifix zum alles überschattenden Symbol.
Das erste historisch bekannte Kruzifix hängt noch heute im Kölner Dom - es entstand im späten 10. Jahrhundert. 100 Jahre später rief Papst Urban II. im Jahre 1095 auf einer Synode in Clermont-Ferrand den Ersten Kreuzzug aus und forderte den christlichen Adel Europas auf, bewaffnet ins mittlerweile sarazenische Jerusalem zu wallfahren, um das »Heilige Grab« zu befreien.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Wende vom triumphierenden Gott-Christus zum leidenden Menschen-Christus einerseits mit den Verfolgungen der Juden, die verstärkt mit dem Beginn des zweiten Jahrtausends einsetzt andererseits? Man wird das nicht als monokausale These vertreten können und so das Verhältnis von Basis und Überbau auf den Kopf stellen, aber vielleicht ist der ikonographische Wechsel auch mehr als nur der Reflex einer zeitgeschichtlichen Situation. Denn in einem bestimmten Sinn ist es ja evident, dass der triumphierende Christus andere Reaktionen bei den Menschen auslöst als der leidende Christus.
Es gibt einen komplementären Paradigmenwechsel, auf den Ulrich Reck in seinem Buch „Kunst als Medientheorie“ hinweist. Danach wechselt im 11. Jahrhundert die Bildprogrammatik der Tympana der christlichen Kirchen von der Weltgerichtsdarstellung zum gütigen Christus bzw. zur hilfreichen Madonna. Das ist nicht notwendig ein Kontrast, sondern könnte auch ein Moment der Effektsteigerung darstellen, insofern man sich nun umso mehr fragt, wer diesem gütigen Christus, dem man beim Eintritt in die Kirche begegnet ist, das angetan hat, was man dann am Kruzifix über dem Altar oder im Seitenschiff sieht. Das wäre durchaus plausibel. Natürlich können solche Bilder nicht der Auslöser des Judenhasses sein, dazu sind sie ja zu wenig anti-judaistisch akzentuiert, aber im Kontext von Predigten und lokalen Erzählungen können sie durchaus ihre Wirkungsmacht entfalten.
 Das Blut Christi
Das Blut Christi
Was unterscheidet aber das Christus-Pantokrator-Bild von einem Kruzifix des leidenden Christus? Simpel gesprochen, das Blut. Wenn wir das berühmteste Bild von Christus als Pantokrator betrachten, die Christus-Ikone vom Katharinen-Kloster auf dem Sinai, die in das 6. Jahrhundert nach Christus datiert wird, so werden wir dort kein Blut feststellen können. Es ist ein konzentriert meditatives Bild, seine Botschaft lautet – vor allem wenn wir den Einfluss der Totenmasken von Fayum mitbedenken – dass der Gestorbene den Tod überwunden hat und lebt.
Selbst auf den expliziten Kreuzigungsdarstellungen, die eher narrativ als meditativ gestaltet sind, wie etwa die Kreuzigung auf dem syrischen Rabula-Kodex von 586, spielt das Blut nur eine marginale Rolle. Wir sehen zwar Blut von den Stigmata Jesu (wie auch das seiner Mitgekreuzigten), aber sein Kopf ist keinesfalls blutüberströmt, so wie es einige Jahrhunderte später üblich werden wird.
Den Übergang bilden Bilder wie die Kreuzigung aus dem Apokalypse-Kommentar von 975 (hier im Detailausschnitt), bei dem die Schächer unblutig gezeigt werden, während Christi Blut betont wird. Dennoch ist der Gesichtsausdruck der des Pantokrators, des triumphierenden Christus. Nur wenige Jahre später wird sich dann die Ikonographie geändert haben, das Blut wird ein neues visuelles Argument im Bild.
„Das Wesen des Christentums", Ludwig Feuerbachs philosophisches Hauptwerk, erschien 1841, knapp ein Jahrtausend später. Auch wenn Sprache und Inhalt vielleicht manchen heute befremden mögen, so beschreibt er doch zutreffend, welche Bedeutung das sichtbare Blut für das Christentum bekommen hat.
Wie aber die Wahrheit der Persönlichkeit die Einheit, die Wahrheit der Einheit die Wirklichkeit, so ist die Wahrheit der wirklichen Persönlichkeit – das Blut. Der letzte … Beweis, dass die sichtbare Person Gottes kein Phantasma, keine Illusion, sondern wirklicher Mensch gewesen, ist, dass Blut aus seiner Seite am Kreuze geflossen. Wo der persönliche Gott eine wahre Herzensnot ist, da muss er selbst Not leiden. Nur in seinem Leiden liegt die Gewissheit seiner Wirklichkeit; nur darauf der wesentliche Ein- und Nachdruck der Inkarnation. Gott sehen genügt dem Gemüte nicht; die Augen geben noch keine hinlängliche Bürgschaft. Die Wahrheit der Gesichtsvorstellung bekräftigt nur das Gefühl. Aber wie subjektiv das Gefühl, so ist auch objektiv die Fühlbarkeit, Antastbarkeit, Leidensfähigkeit das letzte Wahrzeichen der Wirklichkeit …; denn nur im Blute Christi ist der Durst nach einem persönlichen, d.i. menschlichen, teilnehmenden, empfindenden Gotte gestillt.
Man hat darauf hingewiesen, dass diese hervorgehobene Betonung des Blutes ein Erbe der byzantinischen Tradition sein könnte, die nach dem byzantinischen Bilderstreit im 8. Jahrhundert in den Bildern vor allem die Inkarnation, also die Menschlichkeit Jesu betont sehen wollte. Wenn Gott ganz und gar Mensch geworden war, musste er auch als Mensch – und das heißt eben auch in seinem Leiden und Sterben – darstellbar sein.
Vor 1000: Das Gero-Kreuz
Micha Brumlik hat nun zu Recht auf das berühmte Gero-Kreuz im Kölner Dom vom Ende des ersten Jahrtausends verwiesen, das heute dort immer noch meditiert werden kann. Freilich muss man es zunächst in der Imagination von späteren Zutaten befreien, denn weder die Gloriole noch das Kreuz sind ursprünglich.

 Die Seitenwunde Jesu ist eher dezent unterhalb der rechten Achsel angebracht und für die Gläubigen nur aus einer schrägen Unterperspektive direkt unter dem Kreuz erkennbar. Was aber am Gero-Kreuz deutlich wird, ist der leidende Zug des Gekreuzigten. Dieses Moment wird sich in den Folgenden Jahren verstärken, entweder weil sich die Theologie der Gemeinden oder weil sich die Not der Menschen geändert hat. Eine Überlegung könnte dahin gehen, dass zum Jahr 1000 die Hoffnung bestand, dass mit dem Millennium das Reich Gottes anbrechen würde und man ein Gottesbild bevorzugte, das einen Gott präsentierte, der über den Tod triumphiert. Nachdem Gottes Gericht im Jahr 1000 ausblieb und die Leiden der Menschen fortdauerten, präferierte man ein Gottesbild, dass einen mit den Menschen leidenden Gott zeigte. Er hat gelitten wie wir – das wäre die neue visuelle Botschaft. Nahezu zwangsweise stellte sich dann aber die Frage: warum musste er denn leiden? Und eine der theologisch bereits präfigurierten Antworten war eben: wegen der Juden. Und daraus ließ sich eine wohlfeile Verschwörungstheorie ableiten, dass auch das eigene Leiden auf „die Juden“ zurückzuführen sei. Bilder vom leidenden Christus könnten in diesem Sinne Auslöser wie Verstärker von Judenverfolgungen gewesen sein.
Die Seitenwunde Jesu ist eher dezent unterhalb der rechten Achsel angebracht und für die Gläubigen nur aus einer schrägen Unterperspektive direkt unter dem Kreuz erkennbar. Was aber am Gero-Kreuz deutlich wird, ist der leidende Zug des Gekreuzigten. Dieses Moment wird sich in den Folgenden Jahren verstärken, entweder weil sich die Theologie der Gemeinden oder weil sich die Not der Menschen geändert hat. Eine Überlegung könnte dahin gehen, dass zum Jahr 1000 die Hoffnung bestand, dass mit dem Millennium das Reich Gottes anbrechen würde und man ein Gottesbild bevorzugte, das einen Gott präsentierte, der über den Tod triumphiert. Nachdem Gottes Gericht im Jahr 1000 ausblieb und die Leiden der Menschen fortdauerten, präferierte man ein Gottesbild, dass einen mit den Menschen leidenden Gott zeigte. Er hat gelitten wie wir – das wäre die neue visuelle Botschaft. Nahezu zwangsweise stellte sich dann aber die Frage: warum musste er denn leiden? Und eine der theologisch bereits präfigurierten Antworten war eben: wegen der Juden. Und daraus ließ sich eine wohlfeile Verschwörungstheorie ableiten, dass auch das eigene Leiden auf „die Juden“ zurückzuführen sei. Bilder vom leidenden Christus könnten in diesem Sinne Auslöser wie Verstärker von Judenverfolgungen gewesen sein.
Um 1000: Das Schaftlacher Kruzifix
Wir haben ein historisches Beispiel, das diesen Prozess vom Christus triumphans zum Leidens-Christus am selben Objekt vor Augen führt: das Schaftlacher Kruzifix. Es wurde etwa zeitgleich zum Gero-Kreuz geschaffen, gehört also auch zu den ältesten Großkruzifixen, wurde dann aber später einer Bearbeitung unterzogen.

Lange Zeit hielt man das Kruzifix für eines aus dem 12. oder 13. Jahrhundert, bis genauere Untersuchungen feststellten, dass das Holz vom Ende des 1. Jahrtausends stammt und eine frühere Datierung um die Jahrtausendwende wahrscheinlich wurde. Zugleich stellte man fest, dass der aktuelle Zustand nicht ursprünglich ist und die Theologie des Kruzifixes verändert hat. Die spätere Form präsentiert uns einen leidenden Christus, die Augen sind geschlossen, das Blut strömt nur so, ein „Haupt voll Blut und Wunden“. Zuvor aber war der Christus formstreng angelegt, nicht mehr ganz im erhabenen Pantokrator-Stil der Jahrhunderte davor, aber doch deutlich als jener erkennbar, der den Tod endgültig überwunden hat.

Das wird in der Nahaufnahme noch einmal besonders deutlich. Unter dem Kopfhaar rinnt das Blut dramatisch hervor, über die Wangen bis zum Brustkorb. Auch die Seitenwunde Christi wird nun deutlich akzentuiert. Gleichzeitig wurden die Augen mit Holzpaste überstrichen, so dass sie nun geschlossen sind. Der Gesamteindruck und damit auch die Botschaft des Kruzifixes werden damit vollständig anders.
Es ist nicht bekannt, wann die Gemeinde diesen Wechsel in der Gestaltung in Auftrag gegeben hat, aber es ist jedem einsichtig, dass dabei das Kruzifix nicht nur „renoviert“, sondern tatsächlich bewusst umgestaltet wurde. Und das ist schon ein starker Eingriff in das vertraute Bild des Kruzifixes im Kirchenraum.
Da wir nicht wissen, wann der Wechsel vorgenommen wurde, kann er nicht als direktes Beispiel einer Veränderung von Christusbildern nach dem Jahr 1000 dienen, aber er führt deutlich vor Augen, wie ein solcher ausgesehen haben muss. Denn dass es diesen Wechsel gab, lässt sich an vielen anderen Kreuzes- und Kreuzigungs-Darstellungen der damilgen Zeit aufweisen. Aber natürlich haben wir nur selten einen so eindrücklichen Vorher-Nachher-Vergleich wie beim Schaftlacher Kruzifix.
Gezerot Tatnu
Was wir beobachten können ist, wie sich europaweit spätestens mit den ersten Kreuzzügen die Lage der Juden dramatisch ändert. Leo Trepp fasst die Entwicklung in seinem Buch „Die Juden. Volk. Geschichte. Religion“ so zusammen:
Die um 1096 einsetzende Kreuzzugsbewegung bedeutet für das Schicksal der Juden die entscheidende Wende; denn von nun an wurden sie unterdrückt. Viele Kreuzfahrer meinten, sie könnten, ehe sie ins Heilige Land aufbrächen, um die Ungläubigen daraus zu verjagen, ihre Methoden ebenso gut zunächst einmal an jenen Ungläubigen erproben, die mitten unter ihnen wohnten: den Juden. Ganz nebenbei verhieß das zugleich auch fette Beute. In Mainz, Worms, Speyer, jenen Mutterstädten aschkenasischer Judenheit, setzten sich die Juden tapfer zur Wehr, wurden aber von den zügellosen Volkshaufen überrannt und zogen es vor zu sterben, anstatt ihren Glauben aufzugeben. Tausende kamen ums Leben.
Dementsprechend berichtet der jüdische Chronist Salomo bar Simson (11./12. Jahrhundert) über die beginnenden Pogrome:
„Als sie nun auf ihrem Zug durch die Städte kamen, in denen Juden wohnten, sprachen sie: ‚Sehet, wir ziehen den weiten Weg, um die Grabstätte aufzusuchen und uns an den Ismaeliten zu rächen. Und siehe, hier wohnen unter uns die Juden, deren Väter Christus unverschuldet umgebracht und gekreuzigt haben! So lasset zuerst an ihnen uns Rache nehmen und sie austilgen unter den Völkern, dass der Name Israel nicht mehr erwähnt werde. Oder sie sollen unseresgleichen werden und zu unserem Glauben sich bekennen.‘“
Von Speyer zog das Kreuzfahrerheer nach Worms, wo 800 Juden ermordet wurden, dann nach Mainz, wo zweidrittel der dortigen Juden getötet wurden.
Damals nahmen die wilden Fluten überhand und sie ersannen gegen das Volk des Ewigen unrechte Worte, indem sie sagten: „Ihr seid die Nachkommen derer, die unseren Gott umgebracht und gehängt haben." …
Da die Feinde über sie kamen und Kinder und Frauen, Jung und Alt an einem Tage umbrachten. Sie achteten kein Ansehen der Priester, verschonten nicht die Greise, hatten kein Mitleid mit den Kleinen und Säuglingen und erbarmten sich nicht der Hochschwangeren, bis sie keinen zum Entrinnen übrig gelassen hatten… Denn alle sehnten sich darnach, den Namen ihres Schöpfers zu heiligen, und als der Feind über sie herfiel, riefen sie alle mit erhobener Stimme einmütig und wie mit einem Munde: „Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig!"'
Unter dem Namen Gezerot Tatnu („Verfolgung des Jahres 4856“ [nach jüdischer Zeitrechnung]) wird in der jüdischen Liturgie der Opfer des Massakers im Jahre 1096 gedacht.
Um 1166: Psalmenkommentar des Petrus Lombardus

Visuell wird die Abwertung und Verteufelung der Juden sehr deutlich auf einer Illustration von 1166 zu den Psalmenkommentaren des Petrus Lombardus (1100-1160), das sich heute in der Universitätsbibliothek Bremen findet. Derartige Handschriften sind zwar nicht für das Volk gedacht und diesem auch nicht zugänglich (in diesem Falle handelt es sich um ein Auftragswerk des Bremer Erzbischofs Hartwig I.), aber das Bild dürfte eine Tendenz in der Visualisierung des Themas anzeigen, die auch auf anderen öffentlichen Bildern zum Tragen gekommen sein dürfte. Wir sehen auf dem Bild zwölf Figuren, von denen acht durch ihre Hüte als Juden kenntlich gemacht werden. Die beiden Figuren oben links und rechts dürften als Maria und Johannes zu identifizieren sein, die der klassischen Figurenkonstellation entsprechen. Etwas überraschend sind die Darstellungen des Speerträgers und des Soldaten mit dem Essigschwamm: sowohl der römische Centurio Longinus wie auch der römische Soldat Stephanton werden durch ihre Hüte als Juden dargestellt. Das spricht dafür, dass das Judentum das zentrale Thema des Bildes ist.
Ich glaube, man muss das Bild zweigeteilt lesen. Auf der oberen Ebene sehen wir die gebündelte Darstellung der Kreuzigung mit den klassischen vertrauten Figuren. Die Stigmata Christi sind betont, Longinus wird in dem Moment gezeigt, in dem er in die Seite Jesu sticht. Jesus ist also tot, seine Augen sind geschlossen.

Auf der unteren Ebene sehen wir dann die Vorgeschichte, wie sie uns von Matthäus 27 überliefert wird, also die Präsentation Christi vor dem jüdischen Volk durch Pilatus. Wir sehen auf der linken Seite eine Gruppe von sechs Juden, von denen der vorderste ein Spruchband trägt, auf dem sanguis eius super nos – sein Blut komme über uns (Matthäus 27, 25) steht. Die Figur auf der rechten Seite könnte dann entweder Pilatus sein oder der Evangelist Matthäus, vielleicht auch der Täufer Johannes als typologischer Mose. Mindestens vier der Juden unten links werden von Schlangen in den Hals gebissen, eine Schlange am Kreuzesstamm wendet sich der rechten Figur zu.

Das mag auf den ersten Blick überraschen, nimmt aber eine Erzählung auf, die auch Jahrhunderte später auf einigen berühmten Kreuzigungsdarstellungen des Protestantismus auftauchen wird: die Erzählung von der Ehernen Schlange (Numeri 21, 6-9).
„Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.“
Die Verbindung beider Erzählungen stellt Johannes 3, 14-15 dar:
„Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der (an ihn) glaubt, in ihm das ewige Leben hat.“

So wie dieses Motiv in der Illustration zum Psalmenkommentar des Petrus Lombardus genutzt wird, ist aber meines Erachtens der antijudaistische Impuls dominant geworden. Alle Juden links unten werden als Nicht-Christgläubige verworfen, sie werden jeweils von einer Schlange gebissen. Nur Longinus und Stephanton werden gerettet.
 Man könnte einwenden, dass doch zumindest einige der Juden auf Christus blicken, aber dann macht der hervorgehobene Spruch in ihrer Hand wenig Sinn. Allenfalls in dem judenmissionarischen Sinn, dass, wenn die Juden sich dem Christentum zuwenden und sich taufen lassen, würde diese Kombination plausibel sein. Ich halte das aber im vorliegenden Fall für nicht wahrscheinlich. Die jüdische Gemeinde Bremen schreibt, dass die ersten urkundlichen Hinweise auf Juden in Bremen aus dem beginnenden 14. Jahrhundert stammen. Sie werden nach der Ausbreitung der Pest 1349 getötet oder aus Bremen vertrieben. Da die Illustration aus dem Jahr 1166 stammt, kann sie kaum lokal anlassbezogen sein. Es geht um Grundsätzliches, die Verwerfung der Juden als Juden, die weiter ihrem Glauben anhängen. Damit ordnet es sich in den seit dem Jahr 1000 entwickelnden Antijudaismus in Deutschland ein.
Man könnte einwenden, dass doch zumindest einige der Juden auf Christus blicken, aber dann macht der hervorgehobene Spruch in ihrer Hand wenig Sinn. Allenfalls in dem judenmissionarischen Sinn, dass, wenn die Juden sich dem Christentum zuwenden und sich taufen lassen, würde diese Kombination plausibel sein. Ich halte das aber im vorliegenden Fall für nicht wahrscheinlich. Die jüdische Gemeinde Bremen schreibt, dass die ersten urkundlichen Hinweise auf Juden in Bremen aus dem beginnenden 14. Jahrhundert stammen. Sie werden nach der Ausbreitung der Pest 1349 getötet oder aus Bremen vertrieben. Da die Illustration aus dem Jahr 1166 stammt, kann sie kaum lokal anlassbezogen sein. Es geht um Grundsätzliches, die Verwerfung der Juden als Juden, die weiter ihrem Glauben anhängen. Damit ordnet es sich in den seit dem Jahr 1000 entwickelnden Antijudaismus in Deutschland ein.
Nach 1175: Hortus Deliciarum
 Ein fast schon extremes Beispiel für die nun einsetzende Herabsetzung des Judentums und der Verfolgung und Vernichtung von Juden sind einige Illustrationen im Hortus Deliciarum der Herrad von Landberg, die um 1175 entstanden sind. In ihrer Höllendarstellung sind die Juden mit den entsprechenden Hüten charakterisiert und ihnen ist „natürlich“ die Hölle zugewiesen. Während die anderen Gruppen für ihre spezifischen Taten in die Hölle kommen, werden Juden für ihr „Jude-sein“ bestraft.
Ein fast schon extremes Beispiel für die nun einsetzende Herabsetzung des Judentums und der Verfolgung und Vernichtung von Juden sind einige Illustrationen im Hortus Deliciarum der Herrad von Landberg, die um 1175 entstanden sind. In ihrer Höllendarstellung sind die Juden mit den entsprechenden Hüten charakterisiert und ihnen ist „natürlich“ die Hölle zugewiesen. Während die anderen Gruppen für ihre spezifischen Taten in die Hölle kommen, werden Juden für ihr „Jude-sein“ bestraft.
Noch dramatischer und hetzerischer ist es auf folgendem Bild:

Hier wird dezidiert der Zusammenhang von Eucharistie und Abwendung vom Judentum am Bildthema Ecclesia und Synagoga herausgearbeitet. Was in der Illustration des Psalmenkommentars von Petrus Lombardus noch einzelnen Juden zugewiesen wurde, wird nun „den Juden“ in der Gestalt der blinden Synagoga zugewiesen und das Blut Christi wird von der Ecclesia aufgefangen. Die verkehrtherum auf dem Esel sitzende Synagoga aber ist verworfen.
Zusammenfassung
Wir waren ausgegangen von dem Hinweis von Micha Brumlik, dass der aufflammende Antijudaismus und Judenhass in Deutschland zusammenfällt mit einer ikonographischen Wende, der vom Bild des Pantokrators zum Schmerzensmann. Tatsächlich lässt sich eine Linie aufzeigen, die von der Betonung des Leides Jesu am Kreuz, der Akzentuierung des geflossenen Blutes zur bewussten Herabsetzung der Juden als ‚Gottesmörder‘ führt und den ersten Judenpogromen parallel geht. Diese Verfolgungen werden explizit unter Verweis auf die biblischen Überlieferungen gestützt: „Ihr seid die Nachkommen derer, die unseren Gott umgebracht und gehängt haben." Dazu mussten die erhabenen Christusdarstellungen aufgegeben und die des leidenden Christus in den Vordergrund gestellt werden.
Diese Bildgeschichte entwickelt sich nach der ersten Jahrtausendwende, zieht sich aber durch das ganze Mittelalter und die Neuzeit. Auch viele Bildwerke des Protestantismus, die nach dem Schema Gesetz und Gnade arbeiten, führen diese fatale Bildgeschichte fort.
Weiterdenken
Der Hamburger Pfarrer Hartmut Winde (1937-2017) hat in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts angesichts einer den Altarraum mit Bildern aus den Massengräbern der Konzentrationslager überwältigenden Installation von Harald Frackmann weiter Gottesdienste abgehalten und den sich daraus ergebenden Problemkomplex so resümiert:
„In dieser Schwerarbeit mit dem Bild im ausdauernden Hinschauen ging uns allmählich auf, dass Frackmann bewusst/unbewusst eine schlüssige Formulierung für das Problem gefunden hatte, das Kreuz Christi in heutiger Zeit darzustellen, wo Massengräber einkalkuliert werden und man sich doch daran vorbeistehlen möchte, nach einer so langen Geschichte der Kreuzbildnerei. Geht es doch für die Kunst der Zukunft darum, über die bloße Fortsetzung der Kreuz-Ikonographie hinauszukommen und die Wahrheit des Kreuzes, seine Brutalität und Humanität, unter Verzicht aller geläufigen Symbolik anschaulich zu machen, so dass im ursprünglichen Sinne wieder spürbar wird, was Paulus im 1. Korintherbrief zu sagen wusste, dass das Kreuz in der Tat ein Skandal sei, und als Skandal auch eine Gotteskraft.“

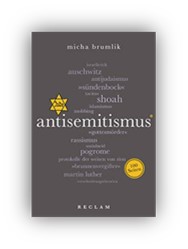 In seinem 100-Seiten-Buch über den Antisemitismus schreibt Micha Brumlik im dritten Kapitel über den „Christlichen Antijudaismus“. Dabei kommt er auch auf einen Paradigmenwechsel um die Wende zum Jahr 1000 zu sprechen, der mir gut bekannt ist, und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die jüdische Bevölkerung, über die ich bis dahin noch nie nachgedacht hatte:
In seinem 100-Seiten-Buch über den Antisemitismus schreibt Micha Brumlik im dritten Kapitel über den „Christlichen Antijudaismus“. Dabei kommt er auch auf einen Paradigmenwechsel um die Wende zum Jahr 1000 zu sprechen, der mir gut bekannt ist, und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die jüdische Bevölkerung, über die ich bis dahin noch nie nachgedacht hatte: Das Blut Christi
Das Blut Christi
 Die Seitenwunde Jesu ist eher dezent unterhalb der rechten Achsel angebracht und für die Gläubigen nur aus einer schrägen Unterperspektive direkt unter dem Kreuz erkennbar. Was aber am Gero-Kreuz deutlich wird, ist der leidende Zug des Gekreuzigten. Dieses Moment wird sich in den Folgenden Jahren verstärken, entweder weil sich die Theologie der Gemeinden oder weil sich die Not der Menschen geändert hat. Eine Überlegung könnte dahin gehen, dass zum Jahr 1000 die Hoffnung bestand, dass mit dem Millennium das Reich Gottes anbrechen würde und man ein Gottesbild bevorzugte, das einen Gott präsentierte, der über den Tod triumphiert. Nachdem Gottes Gericht im Jahr 1000 ausblieb und die Leiden der Menschen fortdauerten, präferierte man ein Gottesbild, dass einen mit den Menschen leidenden Gott zeigte. Er hat gelitten wie wir – das wäre die neue visuelle Botschaft. Nahezu zwangsweise stellte sich dann aber die Frage: warum musste er denn leiden? Und eine der theologisch bereits präfigurierten Antworten war eben: wegen der Juden. Und daraus ließ sich eine wohlfeile Verschwörungstheorie ableiten, dass auch das eigene Leiden auf „die Juden“ zurückzuführen sei. Bilder vom leidenden Christus könnten in diesem Sinne Auslöser wie Verstärker von Judenverfolgungen gewesen sein.
Die Seitenwunde Jesu ist eher dezent unterhalb der rechten Achsel angebracht und für die Gläubigen nur aus einer schrägen Unterperspektive direkt unter dem Kreuz erkennbar. Was aber am Gero-Kreuz deutlich wird, ist der leidende Zug des Gekreuzigten. Dieses Moment wird sich in den Folgenden Jahren verstärken, entweder weil sich die Theologie der Gemeinden oder weil sich die Not der Menschen geändert hat. Eine Überlegung könnte dahin gehen, dass zum Jahr 1000 die Hoffnung bestand, dass mit dem Millennium das Reich Gottes anbrechen würde und man ein Gottesbild bevorzugte, das einen Gott präsentierte, der über den Tod triumphiert. Nachdem Gottes Gericht im Jahr 1000 ausblieb und die Leiden der Menschen fortdauerten, präferierte man ein Gottesbild, dass einen mit den Menschen leidenden Gott zeigte. Er hat gelitten wie wir – das wäre die neue visuelle Botschaft. Nahezu zwangsweise stellte sich dann aber die Frage: warum musste er denn leiden? Und eine der theologisch bereits präfigurierten Antworten war eben: wegen der Juden. Und daraus ließ sich eine wohlfeile Verschwörungstheorie ableiten, dass auch das eigene Leiden auf „die Juden“ zurückzuführen sei. Bilder vom leidenden Christus könnten in diesem Sinne Auslöser wie Verstärker von Judenverfolgungen gewesen sein.





 Man könnte einwenden, dass doch zumindest einige der Juden auf Christus blicken, aber dann macht der hervorgehobene Spruch in ihrer Hand wenig Sinn. Allenfalls in dem judenmissionarischen Sinn, dass, wenn die Juden sich dem Christentum zuwenden und sich taufen lassen, würde diese Kombination plausibel sein. Ich halte das aber im vorliegenden Fall für nicht wahrscheinlich. Die jüdische Gemeinde Bremen schreibt, dass die ersten urkundlichen Hinweise auf Juden in Bremen aus dem beginnenden 14. Jahrhundert stammen. Sie werden nach der Ausbreitung der Pest 1349 getötet oder aus Bremen vertrieben. Da die Illustration aus dem Jahr 1166 stammt, kann sie kaum lokal anlassbezogen sein. Es geht um Grundsätzliches, die Verwerfung der Juden als Juden, die weiter ihrem Glauben anhängen. Damit ordnet es sich in den seit dem Jahr 1000 entwickelnden Antijudaismus in Deutschland ein.
Man könnte einwenden, dass doch zumindest einige der Juden auf Christus blicken, aber dann macht der hervorgehobene Spruch in ihrer Hand wenig Sinn. Allenfalls in dem judenmissionarischen Sinn, dass, wenn die Juden sich dem Christentum zuwenden und sich taufen lassen, würde diese Kombination plausibel sein. Ich halte das aber im vorliegenden Fall für nicht wahrscheinlich. Die jüdische Gemeinde Bremen schreibt, dass die ersten urkundlichen Hinweise auf Juden in Bremen aus dem beginnenden 14. Jahrhundert stammen. Sie werden nach der Ausbreitung der Pest 1349 getötet oder aus Bremen vertrieben. Da die Illustration aus dem Jahr 1166 stammt, kann sie kaum lokal anlassbezogen sein. Es geht um Grundsätzliches, die Verwerfung der Juden als Juden, die weiter ihrem Glauben anhängen. Damit ordnet es sich in den seit dem Jahr 1000 entwickelnden Antijudaismus in Deutschland ein. Ein fast schon extremes Beispiel für die nun einsetzende Herabsetzung des Judentums und der Verfolgung und Vernichtung von Juden sind einige Illustrationen im Hortus Deliciarum der Herrad von Landberg, die um 1175 entstanden sind. In ihrer Höllendarstellung sind die Juden mit den entsprechenden Hüten charakterisiert und ihnen ist „natürlich“ die Hölle zugewiesen. Während die anderen Gruppen für ihre spezifischen Taten in die Hölle kommen, werden Juden für ihr „Jude-sein“ bestraft.
Ein fast schon extremes Beispiel für die nun einsetzende Herabsetzung des Judentums und der Verfolgung und Vernichtung von Juden sind einige Illustrationen im Hortus Deliciarum der Herrad von Landberg, die um 1175 entstanden sind. In ihrer Höllendarstellung sind die Juden mit den entsprechenden Hüten charakterisiert und ihnen ist „natürlich“ die Hölle zugewiesen. Während die anderen Gruppen für ihre spezifischen Taten in die Hölle kommen, werden Juden für ihr „Jude-sein“ bestraft.