
Ent-Festung
|
Theologie ist kein SchwarzbrotEine Apologie nicht nur der Heidschi-Bumbeidschi-TheologieAndreas Mertin
Man könnte auch sagen: Not lehrt Beten (aber die Schweden wissen es besser: Not leert volle Taschen). Jedenfalls ist neuerdings der Wunsch nach mehr Theologie in der Kirche zu hören, allerdings in zwei Lesarten: als notwendige Besinnung[1] oder als notwendige Zumutung. Ich wende mich im Folgenden kritisch der letzteren Lesart zu.
Warum das so aufgespalten wird, dass die Forderung nach theologisch-intellektueller Schärfe nicht für die digitalen Angebote, wohl aber für das Stammpublikum aufgestellt wird, wird nicht deutlich. Es waren doch die digitalen Angebote, die bisher durch theologische Reflexionslosigkeit aufgefallen sind bzw. dann, wenn die Forderung nach mehr Theologie an sie erhoben wurde, dies als Zumutung zurückgewiesen wurde. Aber man basht lieber das „bekannte Publikum“. Zunächst gilt es jedoch ein entschiedenes Wort für die Heidschi-Bumbeidschi-Theologie einzulegen. Sie ist zunächst einmal Volkstheologie, ein religiös-populärkulturelles Plädoyer dafür, dass der Schmerz, das Leid und der Tod nicht das letzte Wort auf dieser Welt haben mögen. Heidschi-Bumbeidschi, das wird der Autor hoffentlich wissen, ist im 19. Jahrhundert ein Dialog mit Kindern in Form eines Wiegenliedes über den Tod in doppelter Variation: den Tod der Mutter und den Tod des Kindes.[3]
Das sollte all jene verstummen lassen, die sich über eine Heidschi-Bumbeidschi-Theologie erheben wollen. Denn es ist meilenweit entfernt von der sanften Paul-Tillich-Theologie eines Peter L. Berger, bei der die kontrafaktische Zusage nur angesichts der Ängste in der Welt geschieht.[4] Die Heidschi-Bumbeidschi-Theologie geht darüber hinaus, sie artikuliert das Gottvertrauen dort, wo es dem modernen Menschen abhandengekommen ist: Und da Heidschi-Bumbeidschi is kumma Und hat ma mei Büaberl mitg’numma ... drum wünsch i mein’ Büaberl a recht guate Nacht. So viel Theologie wie bei der Heidschi-Bumbeidschi-Theologie wagen wir schon lange nicht mehr. Persönlich bin ich kein Vertreter dieser Theologie, aber ich würde auch nie verächtlich über sie reden, ich ehre sie, weil sie von einem Gottvertrauen kündet, das mir verloren gegangen ist. Und dann ist es ein Unterschied, wer das Heidschi-Bumbeidschi in welcher Variante vorträgt. Manche Sänger haben Heidschi-Bumbeidschi in einer schrecklich verharmlosten Form vorgetragen (Peter Alexander, Heintje, Placido Domingo, Andrea Berg). Aber es gibt auch die Variante von Lolita und den Chanson von Esther Ofarim, die auf die Originalversion rekurrieren und den durchlebten Schmerz, der dieser Theologie zugrunde liegt, spüren lassen. Es gehört zu den Schwächen der volkskulturellen Kreise unseres Glaubens, dass sie in den Pandemie-Zeiten, in denen wir leben, Analoges nicht haben erbringen können. Die theo-poetische Kraft ist ihnen seit über 50 Jahren verloren gegangen. Über so etwas wie Pete Seeger, Joan Baez oder Jonny Cash verfügen sie nicht, von solchen Phänomenen wie Billie Eilish (deren Bury a friend eine moderne Variation des Heidschi-Bumbeidschi sein könnte) ganz zu schweigen. Also bitte liebe Kolleg*innen, lasst euch nicht abschrecken, und macht im skizzierten Sinn weiter Heidschi-Bumbeidschi-Andachten, wenn ihr diesen Glauben und dieses Vertrauen teilt, es ist nicht das Schlechteste, was die christliche Theologie zu bieten hat. Was die inkriminierten lebensberatenden Anregungen betrifft, so sind sie zwar nicht das Kerngeschäft der Kirche, aber ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Engagements. Auch sie sollte man nicht schlechtreden oder gegen eine Theologie welcher Prägung auch immer ausspielen. Impulse dagegen sind vielleicht das Wertvollste, was wir bieten können – endlich etwas nicht zu Ende Gedachtes, sondern etwas, was zum Weiterdenken anregt, keine fertigen Entwürfe, sondern Einwürfe, Fragmente, Zwischengedanken. Eine fragmentarische Theologie, die den Menschen Impulse für ihr Leben bietet, wäre ebenfalls nicht das Schlechteste in der Gegenwart. Nun aber zu jenem Satz, der mich eigentlich „zur Feder“ greifen ließ: jene unsägliche Verknüpfung von Schwarzbrot und Theologie, die man immer wieder in den neuen kirchenkritischen Erregungen findet und die doch so undurchdacht ist.
Worum es mir geht, ist, dass diejenigen die so reden, zum einen eine fixierte, ahistorische und aktuell auch unzutreffende Vorstellung von Schwarzbrot haben (harte Kost) und zum anderen eine merkwürdige Vorstellung von Theologie besitzen und nun beides miteinander verbinden. Theologie ist aber ebenfalls keine „harte Kost“, der sich heutige Pfarrer*innen nicht nähern wollen, weil sie die Zumutung scheuen. Sie sind nur mit anderem theologischem Brot großgeworden.
Aber die Antwort kann nun nicht einfach wie bei einer Polit(iker)floskel lauten: Mehr Theologie wagen! Es ist, also würde man aktuell dem Schalke 04 raten: Mehr Fußball wagen! Der strittige Punkt ist doch eher, welche Theologie in welchem Moment welcher Krise. Darüber müssen und können wir streiten. Und da kann dieselbe Theologie in einer Krise Wahrheitsmomente enthalten und in der nächsten nicht. Auch die Heidschi-Bumbeidschi-Theologie ist eine solche Theologie und es gibt Momente, wo sie angebrachter ist als alle intellektuelle Schärfe, die sich an Sentenzen schult. Die Rede von der Theologie als hartem Schwarzbrot, das nun „für das bekannte Publikum“ angesagt sei, ist dagegen eigentlich Kastendenken. Denn sie meint ja letztlich, eine Art Spezialwissen einer Klerikerkaste müsse nun dem Volk und der Kerngemeinde zugemutet werden. Seit der reformatorischen Wende ist von der Gemeinde als Publikum gar nicht mehr zu reden. Wir haben keine theologischen Schaubühnen mehr, auf denen Pastor*innen oder einzelne Hero*innen auftreten oder gar Gladiator*innenkämpfe irgendwelcher theologischer Schulen aufgeführt werden zur Belustigung (oder meinetwegen auch Rettung) des Volkes. Nur Scharlatan*innen arbeiten so. Sie begreifen die Theologie als Showbühne:
Anmerkungen[1] Frisch, Ralf (2020): Eine kurze Geschichte der Gottesvergessenheit. Einige Gedanken zum Zustand der evangelischen Kirche einhundert Jahre nach Karl Barths Revolution der Theologie. In: Theologische Beiträge 51, S. 424–439. [2] Philipp Greifenstein, Mehr Theologie wagen, https://www.zeitzeichen.net/node/8848 [4] Berger, Peter L. (1996): Auf den Spuren der Engel. Die moderne Gesellschaft und die Wiederentdeckung der Transzendenz. 3. Aufl. Freiburg im Breisgau: Herder (Herder-Spektrum, 4001). [5] Steffensky, Fulbert (2010): Schwarzbrot-Spiritualität. Neuausg. Stuttgart: Radius. [6] Harnisch, Wolfgang (1990): Die Gleichniserzählungen Jesu. Eine hermeneutische Einführung. 2. Aufl. Göttingen. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/130/am722.htm |
 Niemand weiß im Augenblick, wie es mit der Kirche, mit den Kirchen in den nächsten Jahrzehnten weitergeht. Aber da wir, ganz im Sinne des Angelus Novus von Paul Klee in der Interpretation von Walter Benjamin, die Zukunft immer im Rücken und die Geschichte vor Augen haben, sind wir geneigt, die Zukunft der Kirche als graue zu imaginieren. Wir neigen zu Extrapolationen aus der Vergangenheit: in den letzten Jahren zumindest scheint es intellektuell und kulturell immer nur schlechter um die Kirche zu stehen, da kann es ja nur so weitergehen. Aber man sagt im Deutschen auch: Wenn die Not am größten, dann ist Gottes Hilfe am nächsten. Oder in den Worten Hölderlins:
Niemand weiß im Augenblick, wie es mit der Kirche, mit den Kirchen in den nächsten Jahrzehnten weitergeht. Aber da wir, ganz im Sinne des Angelus Novus von Paul Klee in der Interpretation von Walter Benjamin, die Zukunft immer im Rücken und die Geschichte vor Augen haben, sind wir geneigt, die Zukunft der Kirche als graue zu imaginieren. Wir neigen zu Extrapolationen aus der Vergangenheit: in den letzten Jahren zumindest scheint es intellektuell und kulturell immer nur schlechter um die Kirche zu stehen, da kann es ja nur so weitergehen. Aber man sagt im Deutschen auch: Wenn die Not am größten, dann ist Gottes Hilfe am nächsten. Oder in den Worten Hölderlins: Ein Kollege von jener Zeitschrift, die ihren Flug erst in der Dämmerung antritt, schrieb kürzlich auf z(w)eitzeichen Ratschläge für eine meiner Ansicht nach nur scheinbar ratlose Kirche (in Wirklichkeit hat sie mehr Lösungen als Probleme anzubieten). Ratschläge, die er programmatisch unter die Überschrift „Mehr Theologie wagen“ setzte.
Ein Kollege von jener Zeitschrift, die ihren Flug erst in der Dämmerung antritt, schrieb kürzlich auf z(w)eitzeichen Ratschläge für eine meiner Ansicht nach nur scheinbar ratlose Kirche (in Wirklichkeit hat sie mehr Lösungen als Probleme anzubieten). Ratschläge, die er programmatisch unter die Überschrift „Mehr Theologie wagen“ setzte.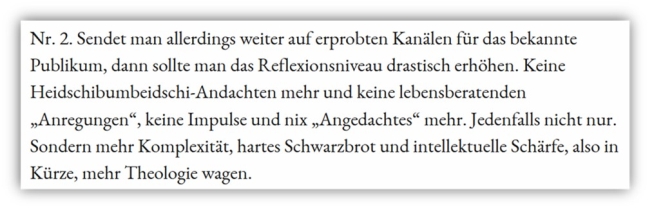
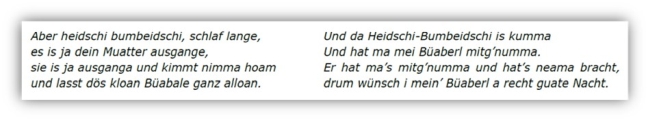
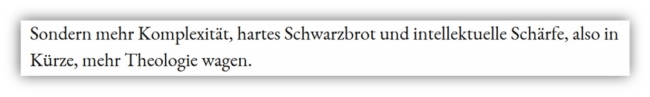
 Mir ist bewusst, dass nicht nur Hüftschuss-Theologen wie Peter Hahne diese Rede vom harten Schwarzbrot Theologie pflegen, sondern auch religiöse Schwergewichte wie Fulbert Steffensky.
Mir ist bewusst, dass nicht nur Hüftschuss-Theologen wie Peter Hahne diese Rede vom harten Schwarzbrot Theologie pflegen, sondern auch religiöse Schwergewichte wie Fulbert Steffensky. In Deutschland freilich pflegen wir – wenn wir aus dem engeren Kreis des Ostwestfälischen heraustreten – das Schwarzbrot beim Buffet zu uns zu nehmen. Es ist heutzutage, anders als es uns einige nahebringen wollen, keine harte, sondern vielmehr angenehme, ja saftige Unterhaltungskost, meist in Form von Häppchen angeboten. Der Rest basiert auf Vorurteilen, die nun freilich schon seit Jahrhunderten kultiviert und kolportiert werden.
In Deutschland freilich pflegen wir – wenn wir aus dem engeren Kreis des Ostwestfälischen heraustreten – das Schwarzbrot beim Buffet zu uns zu nehmen. Es ist heutzutage, anders als es uns einige nahebringen wollen, keine harte, sondern vielmehr angenehme, ja saftige Unterhaltungskost, meist in Form von Häppchen angeboten. Der Rest basiert auf Vorurteilen, die nun freilich schon seit Jahrhunderten kultiviert und kolportiert werden. Näher dürfte man der Wirklichkeit also kommen, wenn man von veränderten
Näher dürfte man der Wirklichkeit also kommen, wenn man von veränderten  Nun also ist es die fehlende Theologie als solche, die für das Übel der kirchlichen Gegenwart verantwortlich ist. Und daran ist ja auch etwas Wahres. Tatsächlich fällt auf, dass in den emphatischen Reden davon, wie die Zukunft der Kirche zu gestalten sei, solide theologische Gedanken äußerst selten anzutreffen sind.
Nun also ist es die fehlende Theologie als solche, die für das Übel der kirchlichen Gegenwart verantwortlich ist. Und daran ist ja auch etwas Wahres. Tatsächlich fällt auf, dass in den emphatischen Reden davon, wie die Zukunft der Kirche zu gestalten sei, solide theologische Gedanken äußerst selten anzutreffen sind. 
 Wirkliche theologische Arbeit dagegen ist nicht „hartes Schwarzbrot“, sondern das immer wieder neue Auslegen des dabei immer wieder neu überraschenden Wortes Gottes in die Gegenwart. Und diese theologische Arbeit können und müssen alle Gemeindeglieder leisten, sie lässt sich nicht abschieben auf eine Kaste von Theolog*innen, die nun die daraus gewonnenen Erkenntnisse dem Kirchenvolk als hartes Brot zu vermitteln hätten. So wie Gerard Dou in der Tradition seines Lehrmeisters Rembrandt van Rijn es zeigt, ist es jedem und jeder aufgegeben, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und dieses Wort ist ein Evangelium: von griechisch εὐαγγέλιον euangélion „Gute Nachricht“ oder „Frohe Botschaft“. Sie kündet von der zuwendenden Gnade Gottes. Jesus hat das so umgesetzt, dass er seinen Zuhörer*innen Geschichten erzählt hat, Gleichnisse, durch die das Himmelreich erfahrbar wurde. Auch das sollte uns vorsichtig sein lassen, allzu selbstverständlich Paulus Jesus vorzuordnen, den theologischen Lehrer höher zu schätzen als den theologischen Erzähler.
Wirkliche theologische Arbeit dagegen ist nicht „hartes Schwarzbrot“, sondern das immer wieder neue Auslegen des dabei immer wieder neu überraschenden Wortes Gottes in die Gegenwart. Und diese theologische Arbeit können und müssen alle Gemeindeglieder leisten, sie lässt sich nicht abschieben auf eine Kaste von Theolog*innen, die nun die daraus gewonnenen Erkenntnisse dem Kirchenvolk als hartes Brot zu vermitteln hätten. So wie Gerard Dou in der Tradition seines Lehrmeisters Rembrandt van Rijn es zeigt, ist es jedem und jeder aufgegeben, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und dieses Wort ist ein Evangelium: von griechisch εὐαγγέλιον euangélion „Gute Nachricht“ oder „Frohe Botschaft“. Sie kündet von der zuwendenden Gnade Gottes. Jesus hat das so umgesetzt, dass er seinen Zuhörer*innen Geschichten erzählt hat, Gleichnisse, durch die das Himmelreich erfahrbar wurde. Auch das sollte uns vorsichtig sein lassen, allzu selbstverständlich Paulus Jesus vorzuordnen, den theologischen Lehrer höher zu schätzen als den theologischen Erzähler.