
Ent-Festung
|
|
Nach der Katastrophe:
|
|
Vorbemerkung der Herausgeber: An dieser Stelle dokumentieren wir den Eingangsvortrag, den der am 5.4. 2019 verstorbene Historiker Axel Schildt am 27.11.1998 bei einer kirchenhistorischen Tagung der Evangelischen Akademie Loccum gehalten hat. Die Tagung fand vom 27.-29.11.1998 an der Akademie statt und trug den Titel „Kann man eine Demokratie christlich betreiben? Politische Neuordnung und Neuorientierung der Hannoverschen Landeskirche in der unmittelbaren Nachkriegszeit“. Der Vortrag wurde ursprünglich wie alle Vorträge und Statements der Tagung in einem Loccumer Protokoll veröffentlicht: Axel Schildt, Nach der Katastrophe: Neuorientierung in Kirche und Gesellschaft, in: Wolfgang Vögele (Hg.), Kann man eine Demokratie christlich betreiben?, Loccumer Protokolle 68/1998, Loccum 1999, 11-23. Die Herausgeber danken herzlich der Ehefrau von Axel Schildt, Frau Gabriele Kandzora und der Evangelischen Akademie Loccum für die Erlaubnis, diesen Artikel nochmals abdrucken zu dürfen. Für diesen Neudruck wurden eine Reihe von offensichtlichen Druckfehlern stillschweigend korrigiert. Die zur Zeit der Erstveröffentlichung noch gültige alte Rechtschreibung wurde beibehalten. |
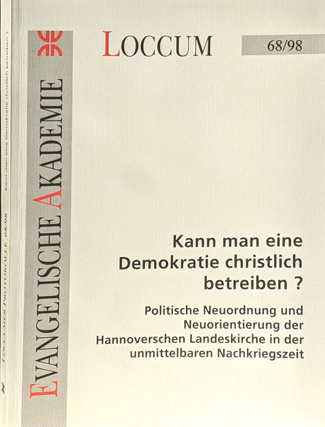 Für das gestellte Thema „Neuorientierung in Kirche und Gesellschaft” nach der – um es mit Friedrich Meinecke zu präzisieren – „deutschen Katastrophe” habe ich eine Perspektive gewählt, die sicherlich einige Aspekte der politisch-kulturellen Landschaft nach 1945 vernachlässigt, aber wohl den Hauptstrom der Entwicklung erfaßt und damit zugleich die Konjunktion „Kirche und Gesellschaft” auflöst[1]. Meine Eingangsthese lautet nämlich, daß die Kirchen selbst – auf dieser Stufe noch allgemein und überkonfessionell aufgefaßt (das hannoversche lutherische sozialmoralische Milieu wäre darin als ein wichtiges Element unter etlichen anderen zu sehen) - in starkem Maße die Neuorientierung nach dem Zweiten Weltkrieg prägten. Das ist nicht mit einer Identität von Kirche und Gesellschaft, Kirche und Welt zu verwechseln, aber der gesellschaftliche Diskurs floß in seinem mainstream im Gleichklang mit der generellen und wiederum majoritären kirchlichen Orientierung. Zu problematisieren hat man als Historiker stets Begriffe wie „Neuorientierung”, weil wir professionell dafür sensibel zu sein haben, in welchen Mischungsverhältnissen Neues mit Altem auftritt, denn natürlich hat es für die Kirchen – ebensowenig wie für die Gesellschaft, wie sich mittlerweile herumgesprochen hat – 1945 eine Stunde Null gegeben. Im Gegenteil: Gerade im Moment der Katastrophe war der Versuch, sich zum wohlbekannten Altvertrauten zurückzutasten, sehr naheliegend, wirkten Kontinuitäten in der pathetischen Hülle des Neuanfangs. Die Schatten nicht allein der NS-Vergangenheit, sondern auch der Traditionen von vor 1933 lagen noch lange über der politischen Kultur und bestimmten das prekäre Verhältnis zur Demokratie und Demokratisierung, die, als von den Siegern auferlegter Zwang empfunden, anfangs mit einiger Skepsis betrachtet wurde. Die letzten Sätze meiner Vorbemerkung beziehen sich auf die zeithistorische Einordnung des Zitats, das der Tagung ihren Titel lieh. Es datiert aus dem Jahr 1959 und lautet vollständig: „Wie man eine westliche Demokratie einigermaßen christlich betreiben kann, ist ja auch ein ziemlich handfestes Problem, und wie sich der Christ in dieser Situation zurechtfinden soll, ist gar nicht so einfach.”[2] Eineinhalb Jahrzehnte nach Kriegsende also, in der stabilisierten bürgerlichen Ordnung der Bundesrepublik, auf der Woge des glückhaften Wirtschaftswunders, ist das Demokratieproblem für den Bischof der Hannoverschen Landeskirche nach wie vor ein „handfestes” gewesen. Und man sollte aufmerksam lesen, der Stachel für sein theologisches Selbstverständnis war explizit die „westliche Demokratie”. Ähnlich lautende Zitate gibt es in großer Zahl von etlichen anderen Kirchenführern, und auch bei Lilje handelt es sich nicht um eine zufällige Stellungnahme. In Loccum führte er bei einer Tagung 1960 aus, die Demokratie habe sich als gutes politisches Ideal, als nützliches Ideal erwiesen, auch wenn sie in einem „verholzten Zustand” zu uns gekommen sei[3]. Das war schon etwas anderes als die Rede von der Demokratie als kleinstem unumgänglichem Übel, die Anfang der 50er Jahre im protestantischen Raum häufig geführt wurde, aber immer noch dominierte in kirchlichen Stellungnahmen die traditionelle bildungsbürgerlich-nationalkonservative Skepsis gegenüber dem westlichen Liberalismus, sozusagen in einer Schwundstufe, aber partiell sogar frisch bekräftigt durch die Angst vor einer säkularistischen Fehlentwicklung, einer Amerikanisierung in der Abenddämmerung der Ära Adenauer. Die Neuorientierung der Kirche hinsichtlich eines positiven Einlassens auf die Demokratie passierte recht eigentlich also erst in den 60er Jahren, mit dem erfolgenden Generationswechsel. Es ergibt sich damit folgende grobe Periodisierung: In den ersten Nachkriegsjahren einige – auch durch äußere Gewalt (Besatzungsmächte) – erzwungene Umstellungen und strategische Veränderungen im Verhältnis von Kirche, Gesellschaft und Politik, dann in den 50er und frühen 60er Jahren eine Art Inkubationszeit, in der die Erfahrungen mit dem neuen demokratischen Staat Bundesrepublik reiften, die dann mit der nächsten Generation zu tiefgreifenden Wertwandlungsschüben führten. Dieses Modell zeigt die Kirche sehr eng mit der Gesellschaft verzahnt, für die grosso modo die gleiche Periodisierung angelegt werden kann. Die Kirche erwies sich in dieser Hinsicht als „ein getreues Spiegelbild der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland”[4].
Für das gestellte Thema „Neuorientierung in Kirche und Gesellschaft” nach der – um es mit Friedrich Meinecke zu präzisieren – „deutschen Katastrophe” habe ich eine Perspektive gewählt, die sicherlich einige Aspekte der politisch-kulturellen Landschaft nach 1945 vernachlässigt, aber wohl den Hauptstrom der Entwicklung erfaßt und damit zugleich die Konjunktion „Kirche und Gesellschaft” auflöst[1]. Meine Eingangsthese lautet nämlich, daß die Kirchen selbst – auf dieser Stufe noch allgemein und überkonfessionell aufgefaßt (das hannoversche lutherische sozialmoralische Milieu wäre darin als ein wichtiges Element unter etlichen anderen zu sehen) - in starkem Maße die Neuorientierung nach dem Zweiten Weltkrieg prägten. Das ist nicht mit einer Identität von Kirche und Gesellschaft, Kirche und Welt zu verwechseln, aber der gesellschaftliche Diskurs floß in seinem mainstream im Gleichklang mit der generellen und wiederum majoritären kirchlichen Orientierung. Zu problematisieren hat man als Historiker stets Begriffe wie „Neuorientierung”, weil wir professionell dafür sensibel zu sein haben, in welchen Mischungsverhältnissen Neues mit Altem auftritt, denn natürlich hat es für die Kirchen – ebensowenig wie für die Gesellschaft, wie sich mittlerweile herumgesprochen hat – 1945 eine Stunde Null gegeben. Im Gegenteil: Gerade im Moment der Katastrophe war der Versuch, sich zum wohlbekannten Altvertrauten zurückzutasten, sehr naheliegend, wirkten Kontinuitäten in der pathetischen Hülle des Neuanfangs. Die Schatten nicht allein der NS-Vergangenheit, sondern auch der Traditionen von vor 1933 lagen noch lange über der politischen Kultur und bestimmten das prekäre Verhältnis zur Demokratie und Demokratisierung, die, als von den Siegern auferlegter Zwang empfunden, anfangs mit einiger Skepsis betrachtet wurde. Die letzten Sätze meiner Vorbemerkung beziehen sich auf die zeithistorische Einordnung des Zitats, das der Tagung ihren Titel lieh. Es datiert aus dem Jahr 1959 und lautet vollständig: „Wie man eine westliche Demokratie einigermaßen christlich betreiben kann, ist ja auch ein ziemlich handfestes Problem, und wie sich der Christ in dieser Situation zurechtfinden soll, ist gar nicht so einfach.”[2] Eineinhalb Jahrzehnte nach Kriegsende also, in der stabilisierten bürgerlichen Ordnung der Bundesrepublik, auf der Woge des glückhaften Wirtschaftswunders, ist das Demokratieproblem für den Bischof der Hannoverschen Landeskirche nach wie vor ein „handfestes” gewesen. Und man sollte aufmerksam lesen, der Stachel für sein theologisches Selbstverständnis war explizit die „westliche Demokratie”. Ähnlich lautende Zitate gibt es in großer Zahl von etlichen anderen Kirchenführern, und auch bei Lilje handelt es sich nicht um eine zufällige Stellungnahme. In Loccum führte er bei einer Tagung 1960 aus, die Demokratie habe sich als gutes politisches Ideal, als nützliches Ideal erwiesen, auch wenn sie in einem „verholzten Zustand” zu uns gekommen sei[3]. Das war schon etwas anderes als die Rede von der Demokratie als kleinstem unumgänglichem Übel, die Anfang der 50er Jahre im protestantischen Raum häufig geführt wurde, aber immer noch dominierte in kirchlichen Stellungnahmen die traditionelle bildungsbürgerlich-nationalkonservative Skepsis gegenüber dem westlichen Liberalismus, sozusagen in einer Schwundstufe, aber partiell sogar frisch bekräftigt durch die Angst vor einer säkularistischen Fehlentwicklung, einer Amerikanisierung in der Abenddämmerung der Ära Adenauer. Die Neuorientierung der Kirche hinsichtlich eines positiven Einlassens auf die Demokratie passierte recht eigentlich also erst in den 60er Jahren, mit dem erfolgenden Generationswechsel. Es ergibt sich damit folgende grobe Periodisierung: In den ersten Nachkriegsjahren einige – auch durch äußere Gewalt (Besatzungsmächte) – erzwungene Umstellungen und strategische Veränderungen im Verhältnis von Kirche, Gesellschaft und Politik, dann in den 50er und frühen 60er Jahren eine Art Inkubationszeit, in der die Erfahrungen mit dem neuen demokratischen Staat Bundesrepublik reiften, die dann mit der nächsten Generation zu tiefgreifenden Wertwandlungsschüben führten. Dieses Modell zeigt die Kirche sehr eng mit der Gesellschaft verzahnt, für die grosso modo die gleiche Periodisierung angelegt werden kann. Die Kirche erwies sich in dieser Hinsicht als „ein getreues Spiegelbild der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland”[4].
Im folgenden möchte ich mich zunächst der Rolle und Bedeutung der Schulddiskussion zuwenden, deren positiv-visionäre Kehrseite die Vorstellung einer Rechristianisierung darstellte, wie anschließend erläutert werden soll. Zum Schluß werde ich eine These formulieren, die auf den Gehalt der zeitgenössisch ubiquitären Parole von der Öffnung der Kirche zur weltlichen Öffentlichkeit zielt.
Jenseits der bei den letzten Jubiläen des Kriegsendes – 1985 und 1995 – heftig diskutierten Frage, ob es sich 1945 um eine Niederlage oder eine Befreiung gehandelt habe (rückblickend betrachtet und im zeitgenössischen Bewußtsein der KZ-Insassen, politischen Gegner und einer Minderheit der Bevölkerung war es eine Befreiung, im Bewußtsein der Bevölkerungsmehrheit wohl nicht), kann zunächst festgestellt werden: Das Nazi-Regime war schmählich zusammengebrochen, für irgendwelche Dolchstoß-Legenden gab es auch später nicht den leisesten Ansatz.
Dies markierte eine wichtige Rahmenbedingung für die Kirchen (besonders die evangelischen), die einen grundsätzlichen Unterschied zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg markiert, als ein verstockter und fast sprichwörtlicher rückwärtsgewandter deutschnationaler Pastorennationalismus zur antidemokratischen Vergiftung der politischen Kultur der Weimarer Republik beitrug und sich als ein Faktor für deren Untergang erwies. 1945 war die Situation für die Kirchen völlig anders, aber als Befreiung wurde das Kriegsende auch von ihnen – mit der Majorität der Bevölkerung – nicht begriffen. Der bayerische Landesbischof Hans Meiser sprach in seinem ersten Rundschreiben vom 7. Mai 1945 nur von der „Tragödie der deutschen Niederlage”, die sich nun vollendet habe[5].
Gleichzeitig aber gab es eine (angesichts der heute in Umrissen ja rekonstruierten Konstellationen des sogenannten Kirchenkampfes während der Zeit des NS-Regimes) seltsame „Hochstimmung”[6], dem „Dritten Reich” widerstanden zu haben, eine allgemeine Aussage, die selbst auf der Linken zeitgenössisch kaum in Zweifel gezogen wurde. Und auch von den westalliierten Besatzungsmächten wurden die Kirchen in besonderer Weise privilegiert. Sie schienen für die Zielvorgabe, Deutschland politisch zu resozialisieren, um es in eine zivilisiert demokratische Völkerfamilie integrieren zu können, die geeigneten Partner. Sie wurden demzufolge in der Phase des Kondominiums, des staatenlosen Zustands zwischen Kriegsende und Gründung der Bundesrepublik, als es ja keinen gleichberechtigten Diskurs mit der dem untergegangenen Regime mehrheitlich verbundenen Bevölkerung geben konnte, zur führenden gesellschaftlichen Kraft erhoben. Die Hoffnungen, die von den Alliierten daran geknüpft wurden, erwiesen sich rasch als haltlos. Im Gegenteil: Die Kirchen – auch und in spezifischer Weise die Hannoversche Landeskirche – erwiesen sich als wichtigster Gegenpol der re-education Bemühungen. Sie verstanden sich als Anwalt des gedemütigten Volkes und seiner Opfer, in Niedersachsen nicht zuletzt der vielen Flüchtlinge und Vertriebenen gegenüber den Siegermächten. Allerdings muß schon hier angemerkt werden, daß die Kontrastierung von westlich-liberalem Gedankengut der Alliierten und volkskirchlichen deutschen Traditionen nur eine idealtypische Setzung ist. Tatsächlich war die alliierte Religionspolitik von den dortigen Kirchen mitbestimmt, im Falle der britischen Besatzungsmacht, die sich im übrigen grundsätzlich an den Richtlinien der Amerikaner orientierte, durch die Church of England[7].
Die erste und heftig umstrittene Erklärung der deutschen Protestanten nach dem Ende des Krieges war das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis vom Oktober 1945, dessen immer wieder zitierte Sätze lauteten: „Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. (...) Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregime seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; aber wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.”[8] Diese Erklärung der Ratsmitglieder der neuen Evangelischen Kirche in Deutschland (unter ihnen der Oberkirchenrat und spätere Landesbischof Hanns Lilje) trug inhaltlich einen Kompromißcharakter. Die Frage nach der verhängnisvollen Verbindung von obrigkeitlichem Denken in der Tradition der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre, hybridem Nationalismus, aggressivem Antiliberalismus und Antimarxismus unter dem Mantel einer angeblich unpolitischen Theologie wurde noch nicht einmal gestellt. Und es fehlte nicht nur jegliche Erwähnung der Opfer des Holocaust, sondern auch der eigenen Anteile an der tiefen Verwurzelung des Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung (bekanntlich erstmals auf der Synode von Berlin-Weißensee 1950 thematisiert). Die Kompromißhaftigkeit des Schuldbekenntnisses lag letztlich in der Tatsache, einerseits überhaupt über Schuld zu sprechen, zum anderen darin, diese metaphysisch weich zu zeichnen. Daß schon das Aussprechen von Schuld selbst unpopulär war – um es vorsichtig auszudrücken – zeigt die Reaktion an der Basis. Ausdrücklich hinter das Schuldbekenntnis stellten sich 1945/46 nur vier von 27 Landeskirchen, eine Kreissynode (Bochum), eine Studentengemeinde (der Pfalz), der Bruderrat der EKD und die kirchlich-theologische Sozietät in Württemberg. Die Distanz und Ablehnung überwog aber in den evangelisch-lutherischen Gebieten weitaus. Nationale Würdelosigkeit, wenn nicht gar Landesverrat – in dieser Anklage gipfelte die Kritik. Auch aus dem Bereich der Hannoverschen Landeskirche sind empörte Briefe an den Rat der EKD überliefert, in denen die Schuld für das ”Dritte Reich” bei den Siegerstaaten gesucht wurde, die Deutschland mit ihrem Haß verfolgt hätten. „Das gesund empfindende Volk”, so hieß es in einem dieser Briefe, lehne jede Entschuldigung gegenüber dem Feind ab, der für den „Terrorangriff” auf Dresden und für die Vertreibungen im Osten verantwortlich sei[9]. Angesichts dieser verbreiteten Ansichten fand sich die Kirche in einer schwierigen Situation. Hanns Lilje schrieb in seinen Lebenserinnerungen, in der Situation eigener Not sei „die innere Ruhe und Überlegenheit zu einer sachlichen Erwägung der Schuldfragen nicht vorhanden“ gewesen. „Die evangelische Kirche hat hier tatsächlich für das Volk gesprochen und ihm eine Aufgabe abgenommen, die das Volk als Ganzes zu leisten noch nicht in der Lage war.”[10] Dies sollte allerdings keinesfalls als politisch-moralische Avantgarderolle mißverstanden werden, wiesen doch die Kirchenleitungen den Kritikern gegenüber immer wieder darauf hin, daß das Stuttgarter Bekenntnis „keine politische, sondern eine kirchliche Erklärung” gewesen sei, die zudem „niemals für die Öffentlichkeit bestimmt war”, wie es Lilje in einem Brief vom November 1945 ausdrückte[11]. Damit ist ein wesentlicher Umstand für das Zustandekommen des Schuldbekenntnisses angesprochen. Ohne den Druck des im Aufbau begriffenen Ökumenischen Rates der Kirchen und namentlich der englischen sowie der Kirchen in den USA hätte es diese Erklärung wohl überhaupt nicht gegeben, sie war nicht zuletzt die unabdingbare Voraussetzung für die Herstellung einer Atmosphäre, in der eine wirksame Auslandshilfe in Gang gesetzt werden konnte, und die Eintrittskarte in die Ökumene. Dort aufgenommen, konnte die Schuld dann gänzlich relativiert werden, wie zwei Monate später im Offenen Brief der EKD an die Christen Englands. „Das deutsche Volk auf noch engerem Raum zusammenzupressen und ihm die Lebensmöglichkeiten möglichst zu beschneiden, ist grundsätzlich nicht anders zu bewerten, als die gegen die jüdische Rasse gerichteten Ausrottungspläne Hitlers.”[12]
Diese Tendenz zu völlig unpassender Aufrechnung von gänzlich Ungleichartigem zeigte sich auch bei den Stellungnahmen zur Entnazifizierung. Die Entnazifizierung führte nicht zufällig zu besonderen Spannungen zwischen den Besatzungsmächten und der Bevölkerung. Die Unpopularität der Entnazifizierung lag weniger an ihrer bürokratischen Handhabung, die eher die kleinen Mitglieder und Mitläufer benachteiligte, während die hohen Funktionäre und Nutznießer oft gelinde davonkamen, sondern insgesamt an der verbreiteten Auffassung, daß es den Siegern, die z.B. den Luftkrieg gegen die deutsche Zivilbevölkerung geführt hatten, gar nicht zukäme, über Deutsche zu Gericht zu sitzen. Insgesamt 3,6 Millionen Verfahren wurden 1945-1949 zunächst vor alliierten, dann mit Deutschen besetzten Spruchkammern und Gerichten verhandelt. 24.000 wurden als Hauptschuldige oder Schuldige zumeist mit Haft- oder hohen Geldstrafen belegt, weitere 150.000 kamen mit geringen Geldstrafen davon, 95% wurden entlastet oder ihre Verfahren wurden eingestellt. Trotz dieser nicht übertrieben harten Bilanz beharrte (ausweislich zahlreicher demoskopischer Erhebungen) die relative Mehrheit der Bevölkerung auf der Ansicht, daß die Entnazifizierung mehr Schaden als Nutzen gebracht hätte, und eine nicht unerhebliche Minorität war sogar der Ansicht, sie sei Siegerjustiz gewesen. Dieser Auffassung schloß sich die Kirche in ihrer überwiegenden Mehrheit unumwunden an. Der Oldenburger Landesbischof Wilhelm Stählin meinte rückblickend, daß „insbesondere emigrierte Juden wegen ihrer Sprachkenntnisse” verwandt wurden, darunter „ungezogene Burschen”, die „uns in einer durchaus unwürdigen Weise behandelten und die friedfertigsten Menschen dazu brachten, den Antisemitismus zu verstehen”. Zweifellos habe die „sogenannte Entnazifizierung eine wesentliche Förderung der antichristlichen Kräfte in unserem Volke bewirkt.”[13] Häufig wurde eine prinzipielle rechtspositivistische Position in den Vordergrund gerückt. Charakteristisch das Protestschreiben, das der Ratspräsident der EKD, Theophil Wurm, im April 1946 an die amerikanische Militärregierung richtete: Die Entnazifizierung verstoße gegen das „natürliche Rechtsempfinden” und „elementare Rechtsgrundsätze”, da es Handlungen und Gesinnungen bestrafe, die „vom damaligen Gesetzgeber als rechtmäßig und gut eingeschätzt” worden seien. Die Kirche, die allein „ernstlichen Widerstand” geleistet habe, könne daher „nicht anerkennen, daß eine menschliche Obrigkeit nunmehr zu strafen unternimmt, was allein nach göttlichem Recht als Unrecht zu gelten habe.”[14] 1948 rief die hessische Kirchenleitung unter der Führung Niemöllers zum Boykott der Entnazifizierung auf, da sie zu Zuständen geführt habe, „die auf Schritt und Tritt an die hinter uns liegenden Schreckensjahre erinnern.”[15] Daß angesichts solcher Stellungnahmen der Empathie, bei der aus NS-Tätern Opfer wurden, während an die wirklichen Opfer des verflossenen Regimes kaum gedacht wurde – die sogenannten Persilscheine für das schadlose Überstehen der Entnazifizierung bereitwillig ausgestellt wurden, verwundert nicht. In seiner Osterbotschaft 1949 mahnte dann der hannoversche Landesbischof das endgültige Ende der Entnazifizierung an: „Der Augenblick ist gekommen, mit der Liquidation einer unglückseligen Vergangenheit Schluß zu machen. Vier Jahre nach dem Ende des Krieges hat es keinen Sinn mehr, nach Vergeltung zu rufen.” Nun sei hohe Zeit für eine „entschlossene und radikale Amnestie”[16]. Die Kirche zeigte sich hier als Speerspitze einer ohnehin erfolgreichen gesellschaftlichen Bewegung, die alle politischen Lager umspannte und dazu führte, daß der neue Bundestag noch im Dezember 1949 – und in der Folge sämtliche Landesparlamente – einen Schlußstrich unter die Entnazifizierung setzten. Diese Maßnahmen sind unter dem Stichwort der „Vergangenheitspolitik” mittlerweile gut recherchiert[17]. In den 50er Jahren konzentrierte sich dann das kirchlich-publizistische Engagement auf die Freilassung der in alliierten Gefängnissen einsitzenden NS-Kriegsverbrecher.
Dieses Engagement ist nicht allein als eine Parteinahme für sündig gewordene Kinder der Volkskirche zu verstehen, sondern es handelte sich um ein politisch begründetes Verständnis für das NS-Engagement, das Bischof Meiser in einem Brief 1947 folgendermaßen ausdrückte: „Ich kann Ihnen nur voll und ganz darin zustimmen, daß gerade die Idealisten, die ursprünglich im Nationalsozialismus eine Bewegung zur inneren und äußeren Gesundung des deutschen Volkes und zur Abwehr des drohenden Bolschewismus erblickten, die Opfer eines Irrtums und eines Betruges geworden sind, und daß man sie heute zu Unrecht zur Verantwortung zieht.”[18] Dies war gleichzeitig die retrospektive kirchliche Rechtfertigung des Tages von Potsdam im März 1933, als Otto Dibelius in der Garnisonskirche die Predigt zur symbolischen Vereinigung des preußisch-konservativen Deutschland in der Person des Feldmarschalls von Hindenburg und der ”jungen nationalen Bewegung” des Gefreiten Hitler hielt. Und in diesem nationalkonservativen Honigmond hatten die nationalsozialistischen Deutschen Christen, aber auch andere Hitleranhänger, nicht zuletzt in den niedersächsischen Landeskirchen überwältigende Erfolge errungen. Daß gerade die Hannoversche Landeskirche nach 1945 besonders kritisch betrachtet wurde, hing wohl damit zusammen, daß hier der Frontverlauf des Kirchenkampfes undeutlicher gewesen war als in benachbarten Kirchen, wo bald nach Kriegsende neue Bischöfe eingesetzt wurden. In Hannover geriet das Verhalten des Landesbischofs im „Dritten Reich” – vor allem die terminologische Anpassung an den Chauvinismus und Antisemitismus des Regimes Ende der 30er Jahre – bald als „Fall Marahrens” zum öffentlich beachteten Symbol für die ausstehende und von der britischen Besatzungsmacht geforderte „Selbstreinigung”[19]. Er selbst hat nie verstanden, warum gerade er als Sündenbock geopfert werden sollte – im Gegenteil: Im ersten Nachkriegsjahr war er noch davon ausgegangen, daß ihm als dienstältestem Landesbischof eine tragende Rolle bei der Reorganisation der evangelischen Kirchen in Deutschland zufallen müsse – er dachte an eine „Deutsche Lutherische Nationalkirche”. Erst unter äußerem Druck – alliierter Stellen, Kreisen der Bekennenden Kirche und schließlich des neugebildeten Rates der EKD seines Rivalen Theophil Wurm – räumte Marahrens schließlich im Frühjahr 1947 sein Amt. Sein Nachfolger Hanns Lilje, von ihm selbst vorgeschlagen und einstimmig gewählt, bemühte sich nach Kräften, diesen Wechsel als „normalen” innerkirchlichen Vorgang erscheinen zu lassen und jegliche Diskussion über Marahrens‘ Aktivität im „Dritten Reich” zu verhindern. Während durch die Neubesetzung des Bischofsamtes ”Selbstreinigung” und zugleich würdige Kontinuität demonstriert werden sollten, zeigte die Bilanz der Entnazifizierung von Geistlichen eine sehr geringe Bereitschaft zu einem Neuanfang, der personelle Konsequenzen einschloß; nur sehr wenige Nazi-Geistliche (weniger als 1% der 1.300 Pastoren) wurden aus dem Amt entfernt[20].
Im Hintergrund des kirchlichen Schulddiskurses bei gleichzeitiger strikter Ablehnung der Entnazifizierung stand die These der „Säkularisierung”. Dieser Schlüsselbegriff für die kirchliche Deutung auch der unmittelbaren Vergangenheit ließ die konkrete Gestalt und deutsche Spezifik des ”Dritten Reiches” im „Nebel allgemeiner Theorien vom Aufstand religiös emanzipierter, ideologisierter Massen”[21] verschwinden. Und er bot eine klare Lösung: Wenn man die Ursache des Unglücks kannte, nämlich den Abfall von Gott, den „großen Abfall”, wie der selbst anfangs vom Nationalsozialismus begeisterte Erlanger Theologe Walter Künneth sein voluminöses Werk 1947 betitelte[22], dann kannte man auch das Heilmittel, die „Rechristianisierung”; Otto Dibelius 1947: „Entweder wird mit dieser Säkularisierung ein Ende gemacht und eine Gegenbewegung mit Ernst und Kraft und Vollmacht setzt ein, oder, da man in einer säkularisierten Welt sittliche Ordnungen nicht aufbauen kann, es wird aus dem, was einmal Volk war, eine triebhafte unruhige Masse”[23]. Vor diesem Hintergrund bedurfte es keiner historisch-konkreten Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus mehr, der dann im übrigen auch kein deutsches Phänomen war; da zumindest alle abendländischen Völker den Weg der „Säkularisierung” gegangen waren, galt für sie die gleiche Bedrohung – nicht des Nationalsozialismus oder Faschismus, sondern des Einbruchs der Dämonen in eine gottlose Welt. Diese ja nicht gänzlich neue geschichtstheologische Deutung erlebte seit dem Ausgang des Zweiten Weltkriegs eine beispiellose Konjunktur. Das christliche Abendland gegen den verbliebenen östlichen Dämonen, den Bolschewismus, zu verteidigen (und im zeitgenössischen Bewußtsein eben nicht die westliche Demokratie), machte im Kern die hegemoniale Integrationsideologie des entstehenden Kalten Krieges und der Gründerzeit der Bundesrepublik aus, eine Feindbestimmung, die jegliche Entnazifizierung erst recht als überflüssig, ja gefährlich erscheinen lassen mußte. In dieser abendländischen Ideologie vereinten sich – mit spezifischen Nuancen – die publizistisch maßgeblichen katholischen und evangelischen Strömungen, wobei zwar wiederum die katholische Ausprägung schon durch die größere Nähe zum Machtzentrum, der CDU/CSU, einen größeren Einfluß ausübte. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den zeitweilig nicht geringen Einfluß katholisierender Lutheraner gerade als evangelische Vertreter der ökumenischen Verbindungen zur katholischen Una sancta (Wilhelm Stählin, Hans Asmussen, die Michaelsbruderschaft)[24]. Aber es gab eben auch eine autochthone evangelische Quelle der Abendlandideologie, und dies nicht zuletzt in der Hannoverschen Landeskirche; gemeint ist der publizistische Diskurs des im Februar 1948 erstmals ausgelieferten Sonntagsblatts, das von Hanns Lilje herausgegeben wurde. Als Chefredakteur hatte er Hans Zehrer gewonnen, der während seiner Zeit dort (bis 1953) auch die meisten einschlägigen Leitartikel beisteuerte. Die kirchliche Zeitgeschichte ist an dieser Zentralfigur protestantisch-konservativer Nachkriegspublizistik bisher souverän vorbeigegangen, wohl deshalb, weil er kein Kirchenmann war. Aber Hans Zehrer war mehr als nur ein beliebiger ghostwriter von Lilje, sondern dieser hegte eine beinahe ehrfürchtige Bewunderung für Zehrers „säkulare Wochenpredigt”, wie er sich in seinen „Memorabilia” ausdrückte[25]. Die Auswahl des Personals erfolgte nicht zufällig: Zehrer war Chefredakteur der meistverbreiteten politisch-kulturellen Zeitschrift vor 1933 gewesen, der legendären „Tat”, eines Zentrums konservativ-revolutionärer Geister, die vage eine national-sozialistische Militärdiktatur als Basis für Deutschlands erneuten Aufstieg konzipierten, in der allerdings die Nationalsozialisten nur die Rolle des Juniorpartners spielen sollten. Fast alle Redakteure dieser Zeitschrift, darunter vor allem Giselher Wirsing, Ferdinand Fried und Klaus Mehnert, setzten nach 1933 ihre publizistische Karriere in Spitzenpositionen fort, entgegen mancher Legenden selbst Zehrer, der sich anfangs ein wenig zurückzog, dann aber 1942 Verlagsleiter bei Stalling in Oldenburg wurde. Für fast alle diese fanatisch antiliberalen konservativen Revolutionäre, die nun christlich geläutert auftraten, bot die evangelische Publizistik nach dem Zweiten Weltkrieg die Chance zur Neuorientierung. Giselher Wirsing führte insgeheim und nach erfolgter Entnazifizierung als Mitläufer seit 1950 offen die vom württembergischen Landesbischof Theophil Wurm herausgegebene Wochenzeitschrift „Christ und Welt”, wo auch Klaus Mehnert seine Heimat fand, während Ferdinand Fried vom Internierungslager, wo er als hoher Amtsträger der SS einsaß, in die Redaktion des Sonntagsblattes wechselte. Es handelte sich hier um eine Liaison der evangelisch-lutherischen Meinungsführer mit den Intellektuellen der vormaligen antidemokratischen Konservativen Revolution, die bisher noch nicht gründlich erforscht worden ist.
Konzeptioneller Ansatzpunkt war zunächst die geschickte Funktionalisierung der Schuldfrage vor dem Hintergrund der Säkularisierungsthese. Das neue christlich-abendländische Zeitalter, das Zehrer unermüdlich propagierte, war durch ein völlig anderes Verständnis der Schuld vom bürgerlichen Zeitalter, das zu Ende gehe, abgesetzt: „Die christliche Lehre kennt den Sündenfall und den gefallenen Adam, die Tatsache der Erbsünde und den Begriff der Schuld (...) Die christliche Lehre aber meint niemals den anderen Menschen, sondern sie meint den Einzelnen mit seiner eigenen Schuld, der allein vor das Gegenüber Gottes gestellt ist und so viel mit sich selber zu tun hat, daß ihm zur Dekonstruktion des anderen Menschen keine Zeit übrig bleibt. Diese christliche Lehre hat nichts mit der Moral zu tun (...) Es ist Zeit, daß wir den Nachlaß sichten, den uns das bürgerliche Zeitalter hinterlassen hat und daß wir uns von einigen Dingen trennen, mit denen wir nicht weiterkommen. Zu ihnen gehört das verstaubte Prunkstück der Moral und die These: ‘Der Mensch ist gut!’”[26] Die verfehlte weltliche Formel von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit”, jedes Denken, das den Menschen und die Menschenrechte zum Ausgangspunkt nahm, wurde von Zehrer in immer neuen Tiraden attackiert, um die Position einer christlich-abendländischen Renovatio als Gegensatz zum Humanismus zu konturieren. Das immer wieder geforderte ”Bewußtsein der eigenen Schuld” war insofern identisch mit dem Wissen um die verderblichen Folgen der Aufklärung und der Frontstellung gegen den Humanismus, und aus diesem Wissen heraus wurde ein elitärer Anspruch erhoben, den Zehrer im Sonntagsblatt Anfang 1950 folgendermaßen formulierte: „Christentum heißt Herrentum (...) Im Verlust der Herrschaft kann sich der Herr als Herr (die männlich chauvinistische Terminologie ist zeitgenössisch symptomatisch) nur behaupten im Bewußtsein seiner eigenen Schuld. Herrenbewußtsein ist in dieser Lage identisch mit Schuldbewußtsein. Man braucht die Erscheinungen der heutigen Lage, in der der abendländische Mensch groggy zu Boden gegangen ist, noch nicht zu überschätzen, weil die Chance gegeben ist, daß er noch einmal auf die Beine kommt. (...) Schuld auf sich zu nehmen und Schuld anzuerkennen, bedeutet: hier wird der Anspruch eines Herrn, der Anspruch auf Führung und Verantwortung aufrecht erhalten. Und die Masse der Menschen ist im allgemeinen viel zu schwach, als daß sie einem Führungsanspruch, der unerschüttert aufrecht erhalten wird, lange standhalten kann.”[27] Der Clou dieser zugleich politischen wie kirchenpolitischen Linie war, daß sich eine antiwestlich-antiliberale konservativ-elitäre Position nicht als Überwindung des Schulddiskurses der unmittelbaren Nachkriegszeit ergab, sondern in diesem bereits logisch angelegt war.
An den Schluß meines Referats möchte ich kein Resümee des bisher Ausgeführten stellen, sondern stattdessen eine These: Es ist nicht zu bestreiten, daß die kirchlicherseits in der Nachkriegszeit immer wieder betonte Notwendigkeit einer „Öffnung zur Welt”, des Gesprächs mit der Welt ein neues, wenngleich nicht traditionsloses Element darstellte, eine Modernisierung der kirchlichen Präsentation, der etwa die evangelischen Akademien ihre Gründung verdanken. Und Hanns Lilje als der sogenannte Pressebischof war für diese Öffnung zur Welt besonders sensibel und sah die Notwendigkeit publizistischer Professionalität sehr deutlich[28]. Aber dies ist nicht einfach mit einer Hinwendung zur Demokratie gleichzusetzen. Das gesellschaftliche Ideal der ersten Nachkriegsjahre war ein ständisch geprägtes Gemeinwesen mit starker christlicher Prägung und ganz gewiß keine pluralistische Demokratie, zu der man sich allerdings pragmatisch zu verhalten hatte, da sie durch die äußeren Umstände unumgänglich war. Daß die antiliberale Vision einer Rechristianisierung des christlichen Abendlandes – in Äquidistanz zum seelenlosen Detroit ebenso wie zum kollektivistischen Moskau – keine Aussicht auf Realisierung hatte, wurde dann im Wiederaufbau immer deutlicher – in den 50er Jahren begann die Anpassung an die westliche Demokratie, die dann nach heftigen Konflikten in den 60er Jahren zur bejahten Selbstverständlichkeit avancierte.
Anmerkungen
[1] Für den Hintergrund der Ausführungen verweise ich auf drei meiner Aufsätze: Axel Schildt, Deutschlands Platz in einem „christlichen Abendland”. Konservative Publizisten aus dem Tat-Kreis in der Kriegs- und Nachkriegszeit, in: Thomas Koebner/Gert Sautermeister/Sigrid Schneider (Hg.), Deutschland nach Hitler. Zukunftspläne im Exil und aus der Besatzungszeit 1939-1949, Opladen 1987, S. 344-369; ders., Solidarisch mit der Schuld des Volkes. Die öffentliche Schulddebatte und das Integrationsangebot der Kirchen in Niedersachsen nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Bernd Weisbrod (Hg.), Rechtsradikalismus in der politischen Kultur der Nachkriegszeit. Die verzögerte Normalisierung in Niedersachsen, Hannover 1995, S. 269-295; ders., Kontinuität und Neuanfang im Zusammenbruch. Zu den politischen, sozialen und kulturellen Ausgangsbedingungen der Nachkriegszeit, in: Monika Estermann/Edgar Lersch (Hg.), Buch, Buchhandel und Rundfunk 1945-1949, Wiesbaden 1997, S. 9-33; ansonsten beschränke ich mich fast ausschließlich auf direkte Zitatnachweise.
[2] Zit. nach dem Vorbereitungspapier der Tagungsleitung.
[3] Hanns Lilje, Die theologische Problematik der politischen Ordnung im Zeitalter der Demokratie, in: Protokoll: Tage des Gesprächs für Journalisten. Demokratie ohne Illusion. Tagung vom 24.-26.6.1960, zit. nach: Axel Schildt, Zwischen Abendland und Amerika. Studien zur westdeutschen Ideenlandschaft der 50er Jahre, München 1998, S. 144.
[4] Clemens Vollnhals, Der deutsche Protestantismus: Spiegelbild der bürgerlichen Gesellschaft, in: Gottfried Niedhart/Dieter Riesenberger (Hg.), Lernen aus dem Krieg? Deutsche Nachkriegszeiten 1918 und 1945. Beiträge zur historischen Friedensforschung, München 1992, S. 158-177.
[5] Zit. ebd., S. 169
[6] Martin Greschat, Zwischen Aufbruch und Bewahrung. Die evangelische Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Victor Conzemius/Martin Greschat/Hermann Kocher (Hg.), Die Zeit nach 1945 als Thema kirchlicher Zeitgeschichte. Referate der internationalen Tagung in Hünigen/Bern (Schweiz) 1985, Göttingen 1988, S. 99-126 (Zitat: S. 104).
[7] Vgl. dazu etwa Gerhard Besier/Jörg Thierfelder/Ralf Tyra (Hg.), Kirche nach der Kapitulation, Bd. 1, Stuttgart u.a. 1989.
[8] Zit. nach Martin Greschat (Hg. in Zusammenarbeit mit Christiane Bastert), Die Schuld der Kirche. Dokumente und Reflexionen zur Stuttgarter Schulderklärung vom 18./19. Oktober 1945, München 1982, S. 102.
[9] Karl D., Hannover, an den Rat der EKD, 3.11.1945, dok. in Harry Noormann, Protestantismus und politisches Mandat 1945-1949, Gütersloh 1985, Bd. 2, S. 46.
[10] Hanns Lilje, Memorabilia. Schwerpunkte eines Lebens, Nürnberg 1973, S. 173 f.
[11] Hanns Lilje an Frau S. in Hannover, November 1945, dok. in Greschat, Schuld der Kirche, S. 227.
[12] Zit. ebd., S. 129.
[13] Wilhelm Stählin, Via Vitae. Lebenserinnerungen, Kassel 1968, S. 489.
[14] Brief des Rates der EKD an die Amerikanische Militärregierung für Deutschland vom 26.4.1946, zit. nach Noormann, Protestantismus, Bd. 2, S. 109-114 (hier S. 110).
[15] Zit. nach Clemens Vollnhals, Entnazifizierung und Selbstreinigung im Urteil der evangelischen Kirche. Dokumente und Reflexionen 1945-1949, München 1989, S. 202f.
[16] Landesbischof Lilje: Mahnung zum inneren Frieden, in: Sonntagsblatt, Jg. 2, 1949, Nr. 16 vom 17.4.1949.
[17] Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergan-genheit, München 1996.
[18] Zit. nach Clemens Vollnhals, Evangelische Kirche und Entnazifizierung 1945-1949. Die Last der nationalsozialistischen Vergangenheit, München 1989, S. 280.
[19] Vgl. für das folgende vor allem Gerhard Besier, ”Selbstreinigung” unter britischer Besatzungsherrschaft. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers und ihr Landesbischof Marahrens 1945-1947, Göttingen 1986.
[20] Vgl. ebd., S. 73 ff.
[21] Hermann Lübbe, Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs, Freiburg / München 1965, S. 113.
[22] Walter Künneth, Der große Abfall. Eine geschichtstheologische Untersuchung der Begegnung zwischen Nationalsozialismus und Christentum, Hamburg 1947.
[23] Rede vom 27. April 1947, in: Kirchliches Jahrbuch 1945-1948, S. 216.
[24] Axel Schildt, Ökumene wider den Liberalismus. Zum politischen Engagement konservativer protestantischer Theologen im Umkreis der Abendländischen Akademie nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Thomas Sauer (Hg.), Katholiken und Protestanten in den Aufbaujahren der Bundesrepublik, Stuttgart 2000, S.187-205.
[25] Lilje, Memorabilia, S. 102.
[26] (Hans Zehrer), Im Treibhaus der Moral, in: Sonntagsblatt, Jg. 1, 1948, Nr. 13 vom 25.4.1948.
[27] Ders., Abendland im Untergang? (V) Schuld, Verantwortung und europäisches Herrenbewußtsein, in: Sonntagsblatt, Jg. 3, 1950, Nr. 15 vom 9.4.1950.
[28] Vgl. Ronald Uden, Kirche und Presse. Die Pressepolitik Liljes, in: Klaus Erich Pollmann (Hg.), Kirche in den fünfziger Jahren. Die Braunschweigische evangelisch-lutherische Landeskirche, Braunschweig 1997, S. 109-132.
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/130/as01.htm
© Axel Schildt, 2021