
Theologisieren
|
Das Volk, Josef und drei Könige in Zeiten der KlimakriseNotizen zur religiösen IkonografieAndreas Mertin Auch 2022 schickte mir die Präses der EKvW und Ratsvorsitzende der EKD Annette Kurschus wieder einen Weihnachtsbrief, worauf und worüber ich mich immer freue. Dieses Mal ist es eine Faltkarte mit zwei Bildtafeln aus dem Wurzacher Altar von Hans Multscher (1400-1467). Aber 2022 ist auch das Jahr, in dem die Bilder ihre Unschuld verloren haben. Deshalb ist jede Bildauswahl knifflig, weil sie unter vielen Aspekten befragt werden muss. Man kann ein Bild unter klassistischen, identitätspolitischen, rassismuskritischen, sozialgeschichtlichen und nicht zuletzt klimapolitischen Perspektiven wahrnehmen. Zu all dem findet sich etwas in beiden Bildtafeln. Kommen wir vor der Erörterung einiger Details der Bilder auf der Faltkarte zunächst zu der Frage, ob auch dieses Jahr wieder ein den Bildinhalt verändernder Bildbeschnitt vorgenommen wurde. Das hatte ich ja schon vor einem Jahr in einem Artikel am Beispiel der Weihnachtskarte von 2021 kritisiert. Und auch dieses Jahr wurde in das Bild eingegriffen, noch massiver als letztes Jahr, aber die Bildaussage wird m.E. etwas weniger verfälscht. Das hängt damit zusammen, dass der Text der Weihnachtsansprache bestimmte Aspekte der Bilder in den Vordergrund stellt, was es rechtfertigt, diese visuell zu pointieren. Schauen wir uns das genauer an: Tafel 1: Die Verkündigung an die Hirten und die Geburt Christi
Bei der Geburtsszene sehen wir, dass dem Beschnitt vor allem der linke Bildteil zum Opfer fällt. Aus dem im Original fast quadratischen Werk (150 × 140 cm), wird nun ein rechteckiges Bild im Hochformat, das dem DIN A 5 Format (14,8 x 21 cm) der Faltkarte entspricht. Im Konflikt zwischen deutscher DIN-Norm und Kunstform gewinnt immer Erstere. Damit muss man rechnen – selbst bei der Kirche. Inhaltlich opfert dieser Beschnitt zum einen die Verkündigung an die Hirten auf dem Felde sowie fast alle Betrachter:innen des Geschehens am linken Bildrand. Das kann man machen, weil es in der Weihnachtskarte um ein spezifisches Bilddetail geht, aber es hat ein ‚Geschmäckle‘, weil, wie wir noch sehen werden, die vornehmen Heiligen drei Könige im Bild belassen werden, die einfachen Leute in Gestalt der Hirten aber nicht. Es ist ja auch beim Christentum allgemein bemerkenswert, dass die Könige zu Heiligen wurden, die Hirten aber nicht. Freilich, wenn man die original quadratische Tafel schon ins Postkartenformat bringen will, hat man wenig Alternativen, man kann ja schlecht auf das Christuskind im Weidenkorb verzichten. Das würden die Adressat:innen des Weihnachtsgrußes einer Präses wohl kaum verstehen und akzeptieren. Dann doch lieber die einfachen Menschen weglassen. Ironie off. Tafel 2: Die Anbetung der Hl. Drei Könige
Bei der Anbetung der Könige musste ebenso viel beschnitten werden, um das Postkartenformat zu erreichen. Auch hier liegt eine fast quadratische Tafel vor, die nun ins vertikale Din A 5 Format gebracht wird. Dabei fällt das Gefolge der Heiligen drei Könige (und damit wieder die niederen Stände) dem Eingriff zum Opfer. Auch bei dieser Tafel geht es der Präses um ein ganz bestimmtes Bilddetail, das durch die Fokussierung leichter in den Blick fällt. Klima-PolitikDie Präses hat sich entschlossen, die Bilder unter klimapolitischen Aspekten zu erörtern, aber auch unter dem kirchlichen Hashtag #wärmeweihnachten. Ersteres ist naheliegend, weil es – neben dem Ukraine-Krieg – das zentrale Thema der Gegenwart ist und sich auch die Herbstsynode 2022 der EKD, deren Ratspräsidentin sie ist, damit beschäftigte und dazu auch die „Letzte Generation“ begrüßte. Dass von dieser im Rahmen ihres Aktivismus auch die großen Gemälde der Kunstgeschichte angegriffen und instrumentalisiert werden, wird nicht unbedingt auf Zustimmung der Präses gestoßen sein, andererseits instrumentalisiert auch sie die Kunst zugunsten bestimmter Botschaften. Und es war im 15. Jahrhundert auch ‚normal‘ für die Kunst, Mittel der Verkündigung zu sein. Nur dass auch hier der Maßstab die Adäquatheit der Werkauslegung ist. Man sollte in die Bilder nichts hineinlesen, was in ihnen nicht drinsteckt. Aber kann natürlich in den Kunstwerken etwas entdecken, was in der Gegenwart eine neue Relevanz bekommt. Was ist dabei der Aufhänger für die Wahl und Auslegung des Bildes? Nun, bei beiden Bildtafeln von Hans Multscher ist es die Figur des Josef, die ins Zentrum der Betrachtung gerückt wird. Die Präses schreibt dazu:
Ja, das mag sein. Ich glaube es freilich nicht. Das scheint mir mehr in das Bild hineingelesen als herausgelesen zu sein. Es könnte zudem, so behaupte ich einmal etwas vorlaut, weil ich selbst kein Experte auf dem Gebiet bin, eine klassische Verwechslung von Wetter und Klima sein. Ich lese, dass die Kleine Eiszeit zumindest in der Kernzeit später datiert wird. Zwischen 1430 und 1440 hat es bei den Temperaturen aber wirklich einen Ausschlag nach unten gegeben, kurz danach gingen die Temperaturen jedoch wieder deutlich nach oben. Und erst 150 Jahre später gab es dann vor allem in Nordeuropa jene kleine Eiszeit, die wir auch an Werken der Bildenden Kunst ablesen können. Ob die Kleine Eiszeit von Menschen verursacht wurde, oder ob sie mit Naturereignissen zusammenhängt, ist unter Klimaforschern bis heute kontrovers. Für den Jahreswechsel 1436/37 verzeichnen Historiker jedenfalls einen extremen Wintereinbruch, der bis in die Fastenzeit anhält. Kalte Winter sind aber nicht notwendig nur ein Phänomen des Klimawandels. Die Erfahrung eines kalten Winters könnte Multscher auf der Geburtstafel verarbeitet haben. Ich schreibe bewusst könnte, denn es ist kaum erkennbar, dass die Handschuhe von Josef tatsächlich wegen der Kälte getragen werden. Multscher lebt und arbeitet in Ulm, welche Informationen er vom Wetterumschwung hatte, ist ungewiss. Hilfreicher wäre, man wüsste etwas Präzises über die Funktion von Handschuhen in dieser Zeit. Sie sind erst spät nach Deutschland gekommen und zumindest in der Kunst eher ein Statussymbol als ein Hilfsmittel gegen Kälte.
Das können wir exemplarisch auf dem nebenstehenden Bild von Wolf Huber aus dem Jahr 1512 sehen. Hier friert man schon beim bloßen Betrachten des Kunstwerkes und fragt sich, wie etwa der ziemlich derangierte König am linken Bildrand, der nicht einmal seinen Körper recht bedecken kann, diese Kälte wohl aushält. Offenbar bietet überhaupt nichts den Beteiligten, ob arm oder reich, Schutz vor der Unbill der Natur. Dabei ist der Boden gefrostet, die verbliebenen Balken des ruinösen Hauses sind mit Reif überzogen. Das ist die Vorstellung, die man sich von Weihnachten in einer Situation wie in der Ukraine machen müsste – nicht aber in der Bundesrepublik Deutschland. Um sich die Weihnachtssituation in vielen Teilen der Ukraine zu vergegenwärtigen, wäre vermutlich Albrecht Altdorfers Weihnachtsbild von 1511 passender:
Wenn man aber ein Kunstwerk einsetzen will, das die Kleine Eiszeit spiegelt, dann vielleicht das Weihnachtsbild von Pieter Brueghel d. J., welches dieser am Ende des 16. Jahrhunderts nach einer Vorlage seines Vaters geschaffen hat. Denn beide dokumentieren tatsächlich die Folgen des Klimawandels in den Niederlanden, die so bis dahin und seitdem auch kaum noch zu beobachten waren. Hier geht es nicht mehr ums Wetter, sondern ums Klima.
Die Menschen sammeln verzweifelt jeden Reisig, den sie finden können, sie mummen sich ein, sie scharen sich um öffentliche Feuer, drängen sich eng aneinander, sie schlagen Löcher in die vereisten Flüsse, um an Wasser zu kommen, denn eine Trinkwasserversorgung gibt es nicht. Das ist ein Bild, das einen temporären Klimawandel dokumentiert und es wird in der Klimaforschung auch dementsprechend zur Illustration eingesetzt. Heute mögen wir es unter dem Stichwort „Weiße Weihnacht“ einordnen, aber damals beschrieb es eine existentielle Not.
Das ändert natürlich nichts an dem Umstand, dass sie dennoch auch als Schutz gegen Kälte dienen könnten. Nur weisen im Bild selbst keine anderen Umstände auf eine besondere Kältesituation hin. Die Schafe auf dem Hügel im Hintergrund weiden ganz normal und liegen sogar gemütlich auf dem Boden, während die Hirten sich mit Musik unterhalten. Für einen extrem kalten Winter wäre das ungewöhnlich, die Tiere wären dann sicher im wärmeren Stall. Josef könnte die Handschuhe eventuell als Zimmermann tragen. Zudem wird uns das heilige Paar als reich dargestellt, davon zeugen die drei Folianten in der Herberge (die auf die Verkündigung an Maria anspielen). Die Handschuhe könnten also durchaus dem Stand des Josef als Handwerker geschuldet sind. Aber das ist vielleicht Auslegungssache. Die Präses schreibt dazu:
Und zwar wird in der kunsthistorischen Fachliteratur darüber spekuliert, ob der alte Josef nicht kurz vorher sein Beinkleid ausgezogen hat, um dem Kind in der Krippe damit noch etwas mehr Wärme zu spenden. Zumindest stimmt die Farbe des Stoffes über dem Weidenkorb mit der der Kleidung des Josef überein. Dagegen spricht, dass das Kind eigentlich schon so gut eingewickelt ist, dass der doch angeblich kälteempfindliche alte Mann Josef nicht auch seine Beinkleider hätte ausziehen müssen, um das Neugeborene durch ein zudem noch ziemlich nachlässig drapiertes Stück Kleidung zusätzlich zu wärmen. Aber als Lokalkolorit wird man dieses Detail wohl deuten dürfen.
Aber es gibt Indizien dafür: 1385, so lerne ich, schreibt ein sog. Werner der Schweizer in seinem Marienleben:
Träfe das zu, wäre auch der frierende Josef mit den Handschuhen aus der von mir betrachteten Tafel des Jahres 1437 zumindest unter seinem Mantel ohne Hose, eine Vorstellung nicht ohne Ironie. Wenn aber bereits 1400 und früher das frierende Christuskind ein Thema der Kunst war, kann es sich nicht auf die klimatischen Veränderungen im 15. Jahrhundert beziehen, sondern ordnet sich in eine ausgearbeitete kunstgeschichtliche Tradition ein.
Die Präses lenkt die Aufmerksamkeit auf die Figur des Josef, der wieder am linken Rand des Bildes zu finden ist. Josef ist etwas anders gekleidet, ihm fehlt der rote Schal bzw. Umhang. In der rechten Hand hat er eine Pfanne, mit der er Nahrung zubereitet hat. Die Präses schreibt:
Das mit der Stärke verstehe ich nicht, Josef ist der Legende nach Zimmermann, da sollte er zupacken können. Dass der alte Mann noch eine Pfanne halten kann, erscheint mir auch normal. Auffällig sind einige Verfärbungen an den Fingern. Was mich aber vor allem überrascht ist die Behauptung, dass er Brei für das Kind zubereitet haben soll. Das glaube ich kaum. Jesus ist noch keine 14 Tage alt und wird ganz sicher keinen Brei zu sich nehmen – als gute Mutter wird Maria ihn zudem sicher selber stillen. Das Essen kann also nur für Maria, für die Gäste oder für Josefs Eigenbedarf sein. Bei aller Liebe für idyllische Szenen, aber Brei für ein Neugeborenes ist extrem unwahrscheinlich und wäre eine Quälerei.
Vermutlich ist das alles so gedacht wie auf dem etwa kurz nach 1440 entstandenen Bild im Stundenbuch des Meisters der Katharina von Kleve. Danach geht es tatsächlich um die Eigenversorgung des „Nährvaters“ Josef, der sich gemütlich mit dem im Kessel über der offenen Flamme zubereiteten Brei den gutgenährten Bauch vollschlägt, während Maria konzentriert damit beschäftigt ist, das Jesuskind zu stillen. Auch das ist durchaus eine idyllische Szene, aber sie ist wesentlich realistischer als ein Josef, der dem Neugeborenen einen Brei kocht. Der katholischen Tradition war die stillende Maria immerhin so wichtig, dass sie ihr mit der Maria lactans eine eigene ikonographische Tradition gewidmet hat.
Ich glaube, dass die Zuweisung zum kalten Winter mehr dem Hashtag #wärmewinter oder #wärmeweihnachten als der Logik der Bilderzählung geschuldet ist. Das sollte man mit Bildender Kunst nicht machen. Wir würden auch mit biblischen Texten nicht so umgehen. Weitere Perspektivierungen
Ich möchte nun einige Aspekte der beiden Bildtafeln von Hans Multscher herausgreifen, die zeigen, warum es sich durchaus lohnt, sich mit ihnen auch außerhalb der engeren Weihnachtszeit zu beschäftigen. Denn auf derartigen Werken wird ja nicht einfach nur die Weihnachtsgeschichte erzählt, es dokumentiert sich auch etwas von der Sozial- und Mentalitätsgeschichte der jeweiligen Zeit und der Gedankenwelt der Auftraggeber des Werkes, die die Arbeit ja abnehmen mussten, bevor sie sie bezahlten. Inkludierende und exkludierende RäumeZunächst ist es ja auffällig, dass beide Tafeln es mit Räumen zu tun haben. Und zwar mit solchen Räumen, die ganz unterschiedlich bestimmt sind. Und das überrascht deshalb, weil es ja derselbe Raum am selben Ort ist, an dem sich die Handlung abspielt. Es geht, das wird im Vergleich schnell deutlich, offenkundig um Zonen der Zugänglichkeit, die hier visualisiert werden. Sie thematisieren die Frage: Wer darf was? Das ist deshalb in diesem Kontext interessant, weil das für die Weihnachtskarte bemühte Hashtag #wärmeweihnacht oder wie es auf der EKD-Synode genannt wurde #wärmewinter ja suggeriert, hier würden allen, vor allem den Marginalisierten und von der Kälte Bedrohten, die Räume (der Kirche) geöffnet. Und das ist ja auch der Selbstanspruch der christlichen Kirchen. Das geben die ausgewählten Tafeln aber gar nicht her, sie grenzen die Architektur und die räumliche Inszenierung die einen aus und laden die anderen ein. Denn würde man die beiden Tafeln mittels Photoshop übereinanderlegen und einen konsistenten Raum konstruieren, dann haben wir eine Örtlichkeit, die auf der linken Seite durch Abgrenzungen gestaltet ist und auf der rechten Seite durch Öffnungen. Das sieht so aus:
Das ist überaus dramatisch und fällt zunächst deshalb nicht auf, weil es eben zwei unterschiedliche Tafeln sind. Am Phänomen selbst ändert das aber nichts. Links finden wir die Armen, die Hirten, die Frauen, das einfache Volk, rechts die Könige und ihren Hofstaat. Links finden wir einen Holzzaun (erste Tafel) bzw. einen Vorhang (zweite Tafel), rechts auf beiden Tafeln einen offenen Zugang. Ist das ein Zufall? Ich glaube es nicht. Man muss das noch nicht zwingend als Klassismus bezeichnen, aber es kommt dem nahe, was die Wikipedia darunter zusammenfasst:
Auf den Tafeln hat das Christentum / haben die Auftraggeber / hat der Künstler das visuell das umgesetzt, was dann 200 Jahre später als gemeinchristliches Advents- und Kirchenlied zumindest in den ersten drei Liedzeilen populär wurde: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; Das folgende „ein Heiland aller Welt zugleich“ wird dann aber sehr differenziert visualisiert. Wo kämen wir auch hin, wenn die einfachen Leute überall unkontrolliert Zutritt hätten. Sie sind und bleiben „Zaungäste“ im wortwörtlichen Sinn. Sie werden durch einen extra eingerichteten Zaun auf Distanz gehalten, während den königlichen Herren mit ihren Gaben der unmittelbare zugang gewährt wird. Das ist schon sehr auffällig. Werfen wir dann einen genaueren Blick auf die Personen, die ja auf der mir übersandten Faltkarte ausgeblendet wurden, die aber gerade unter dem Aspekt des Klassismus durchaus interessant sind. Bedenkt man, dass in der deutschen Malerei derlei realistisch gemalte Menschen erst 40 Jahre später üblich werden, dann haben wir hier ein auffallendes Interesse an der Präsentation konkreter Menschen vor Augen. Die Wikipedia schreibt, im Wurzacher Altar steigere Multscher seinen Realismus zu „betonten Hässlichkeit“. Treffender finde ich die dort ebenfalls zitierte Charakterisierung von Wilhelm Pinder aus dem Jahr 1937: „Die Greifweite seines Gefühlslebens war von fast einmaliger Spannung … Es ist ein faustisches Wesen in ihm“ Zumindest kann man am Anfang im Blick auf die erste Tafel vielleicht so viel sagen: es sind sehr unterschiedliche Leute, die hier in ganz verschiedenen Formen einen Blick auf ein Ereignis werfen, das sich hinter einem Zaun abspielt.
Die linke, hell gekleidete Gruppe scheint aus Frauen zu bestehen, die, betrachtet man ihre Kleidung, wohl aber nicht zu den alleruntersten Schichten der Bevölkerung gehören, aber sie gehören wohl auch nicht zum Adel. Ich spekuliere einmal: da hatte der Künstler vielleicht typische Kirchenbesucherinnen seiner Zeit vor Augen, also eine Gemengelage von Schichten, die am Gottesdienst teilnehmen, aber selbstverständlich als Laien die Räume des Altarbereiches, des ‚Heiligen‘ nicht betreten durften. Der Teint ist bei drei der vier Figuren ostentativ weiß, bei einer Figur ist die Haut dagegen ebenso ostentativ dunkel sonnengegerbt dargestellt. Wer es sich leisten kann, schützt sich vor der Sonne, nur wer arbeiten muss, ist dieser ausgesetzt. Hier werden Schönheitsideale des Mittelalters deutlich. Betont wird bei zwei Figuren durch die ebenso demonstrativ gefalteten Hände ihre persönliche Frömmigkeit bzw. durch die Darstellung ihrer Augen bzw. Augenlider ihre Innerlichkeit und religiöse Konzentration.
Die rechte, dunkler dargestellte Gruppe besteht aus fünf Männern, die in zwei Reihen stehen. Diese Gruppe ist selbst noch einmal zweigeteilt. Die beiden vorderen Figuren scheinen nicht einfache Arbeiter, geschweige denn Hirten zu sein, vielmehr weisen sie sich durch ihre Kleidung als bessergestellt aus. Die eine der beiden vorderen Figuren ist wie ein mittelalterlicher Bürger oder sogar Ratsherr gekleidet (es könnte sich um ein Selbstporträt des Künstlers handeln). Auffällig ist die danebenstehende Figur, die etwas aus der Gruppe herausfällt, weil sie die anderen mit ausgestreckter Hand auf das Geschehen auf der rechten Seite der Tafel hinweist (wobei sich der konkrete Fingerzeig auf eine Stelle knapp oberhalb des Christuskindes richtet). Bei dieser Figur könnte es sich um einen Engel handeln, der die Anderen auf das Geschehen aufmerksam macht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Es sind einfache Menschen mit abgestuften unterschiedlichen Teints, deren Blicke sich nur bedingt auf das angezeigte Geschehen richten. Bestenfalls könnte man ihre Blicke als in sich gekehrt bezeichnen.
Es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Realismus. Einen humanen Realismus finden wir etwa bei Martin Schongauer (rechts), der die Hirten als Persönlichkeiten vorstellt. Herabsetzend ist der Blick bei Francesco di Giorgio Martini (links), der 1490 die Hirten als Wilde darstellt. Aber auch Hans Multscher kann den einfachen Menschen nicht so viel abgewinnen, wie es wünschenswert wäre. Für ihn bleiben es nur Menschen mit geringerem Stand. Identitätspolitik oder Xenophobie?
Der in der Kunst zunächst dunkle, dann schwarze König erscheint, weil die drei Könige nicht nur wie anfangs drei Lebensalter repräsentieren sollen, sondern nun auch drei Weltregionen: Europa, Asien und Afrika. Am Anfang ist man sich noch nicht einig, welcher König der schwarze ist, dann einigt man sich auf Balthasar. Aber der Blick auf den afrikanischen Kontinent ist 1437 kein unbefangener, er ist deutlich von Vor-Urteilen geprägt. Dennoch ist es das Verdienst von Multscher, als einer der ersten Künstler überhaupt den „Mohrenkönig“ auf einem Weihnachtsbild dargestellt zu haben. Als ich seine Darstellung zum ersten Mal genauer betrachtete, stellte sich mir die Frage, ob wir es hier nicht mit so etwas wie einem naiven visuellen Blackfacing zu tun haben. Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, es schien mir nur so, als habe Multscher für seine Darstellung einfach einen konkreten ‚weißen‘ Menschen dunkel eingefärbt – so wie amerikanische Fotojournalisten manchmal Schwarze per Photoshop noch schwärzer machen, um bestimmte Vorurteile zu bedienen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, es war nur ein spontaner Eindruck, der selbst Ausdruck einer Vorurteilskultur sein könnte. Explizite bürgerliche Vorurteilskultur erscheint, wie bereits erwähnt, historisch erst später, so wie wir es etwa bei Adalbert Stifter finden: „Um diese Dinge trieben sich Zigeuner herum: Männer und Weiber so schwarz wie der Mohrenkönig auf alten Bildern der heiligen drei Könige, in Trachten verschiedener Zeiten und Länder gekleidet, feurig an Farbe, ganz oder zerrissen.“ Das sind noch nicht die Vor-Urteile, die Multscher umtreiben. Es könnte also durchaus sein, dass dieser beim dargestellten König Balthasar selbst durchaus respektvoll mit der unterstellten Ethnizität umzugehen versucht.
Mindestens fünf People of Color sehen wir unter den neun Menschen auf der rechten Seite der zweiten Bildtafel. Einen weiteren weißen Bediensteten finden wir noch wie bereits gesehen im Mantel des Balthasar versteckt. Die gesamte Gruppe der herbeigeeilten Könige samt Gefolge umfasst damit 13 Personen. Neben den drei Königen also noch 10 Personen des Hofstaats, von denen die Hälfte als Schwarze dargestellt sind (einer von ihnen ist dabei kaum sichtbar, weil nur Nase und Mund erkennbar sind – das ist ein überaus merkwürdiges Detail, dass noch weiterer Studien bedürfte, wenn man davon ausgeht, dass nichts auf einem Gemälde zufällig ist). Eine derartige Vielzahl schwarzer Akteure ist für ein ja eigentlich neues Motiv in der Kunstgeschichte bemerkenswert und für die damalige Zeit sicher auch außergewöhnlich. Zwei der schwarzen Figuren tragen rote Kopfbedeckungen, eine trägt eine grüne Kopfbedeckung, bei der kaum sichtbaren Figur im Hintergrund kann man nichts genaues erkennen.
Oder es ist ein schwarzer Pantalone, wenn sich diese Figur der Commedia dell‘arte nicht erst später durchgesetzt hätte.
In jedem Fall wird man die Figur nicht als wohlwollende Darstellung charakterisieren können. Es ist eine despektierliche und vorurteilsbefangene Zeichnung, vergleichbar mit dem Pöbelgeschrei in Wilhelm Raabes „Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge“:
Und so ist es vielleicht ganz gut, dass diese Figur auf der Weihnachtskarte ausgeblendet wurde. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/141/am771.htm |




 Ein Künstler des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit würde vermutlich eher Frost oder Schnee auf dem Bild unterbringen und nicht nur ein Paar Handschuhe – so zumindest haben es die Künstler 100 Jahre nach Multscher getan.
Ein Künstler des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit würde vermutlich eher Frost oder Schnee auf dem Bild unterbringen und nicht nur ein Paar Handschuhe – so zumindest haben es die Künstler 100 Jahre nach Multscher getan. 

 Auf dem Bild sehen wir alle Folgen, die ein derartiger dramatische Wintereinbruch hat.
Auf dem Bild sehen wir alle Folgen, die ein derartiger dramatische Wintereinbruch hat.  Kehren wir noch einmal zurück zu den Handschuhen des Josef. Ich finde, es ist gar nicht so einfach, deren konkrete Funktion zu bestimmen. Selbst bei der Suche nach vergleichbaren historischen Exemplaren kommt man nicht viel weiter. Es sind zunächst einmal keine Fingerhandschuhe, auch wenn man beim rechten Handschuh die Finger noch gut erkennen kann, so dass man entweder von sehr dünnem Material ausgehen muss oder von einem sehr anschmiegsamen Stoff. Der linke Handschuh zeigt uns, dass es sich um lederne Fäustlinge handelt. Gibt man bei den in der Regel englisch-sprachigen Kunstdatenbanken das Stichwort „
Kehren wir noch einmal zurück zu den Handschuhen des Josef. Ich finde, es ist gar nicht so einfach, deren konkrete Funktion zu bestimmen. Selbst bei der Suche nach vergleichbaren historischen Exemplaren kommt man nicht viel weiter. Es sind zunächst einmal keine Fingerhandschuhe, auch wenn man beim rechten Handschuh die Finger noch gut erkennen kann, so dass man entweder von sehr dünnem Material ausgehen muss oder von einem sehr anschmiegsamen Stoff. Der linke Handschuh zeigt uns, dass es sich um lederne Fäustlinge handelt. Gibt man bei den in der Regel englisch-sprachigen Kunstdatenbanken das Stichwort „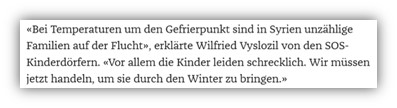 In Deutschland wohl kaum, in der Ukraine sehr wahrscheinlich. Aber das ist natürlich in vielen Ländern so, die nicht zum Speckgürtel bzw. zu den Industrienationen dieser Welt gehören. Das übersehen wir oft, wenn wir über die aktuellen Ereignisse klagen. Für Syrien meldeten die Agenturen schon 2012 und 2013 derartig katastrophale Verhältnisse für die Kinder zu Weihnachten, ohne dass es bei uns größere Debatten gegeben hätte. Auch damals hätte man sich einen Hashtag #wärmeweihnachten und einen diakonischen #wärmewinter gewünscht. Insofern ist das mit den frierenden Eltern an Kinderbetten nicht ein vergangenes oder neues Problem, sondern ein dauerhaftes. Nur rückt es uns zum ersten Mal seit Jahrzehnten näher und ist nicht nur ein abstraktes Bild eines uns fernen Geschehens.
In Deutschland wohl kaum, in der Ukraine sehr wahrscheinlich. Aber das ist natürlich in vielen Ländern so, die nicht zum Speckgürtel bzw. zu den Industrienationen dieser Welt gehören. Das übersehen wir oft, wenn wir über die aktuellen Ereignisse klagen. Für Syrien meldeten die Agenturen schon 2012 und 2013 derartig katastrophale Verhältnisse für die Kinder zu Weihnachten, ohne dass es bei uns größere Debatten gegeben hätte. Auch damals hätte man sich einen Hashtag #wärmeweihnachten und einen diakonischen #wärmewinter gewünscht. Insofern ist das mit den frierenden Eltern an Kinderbetten nicht ein vergangenes oder neues Problem, sondern ein dauerhaftes. Nur rückt es uns zum ersten Mal seit Jahrzehnten näher und ist nicht nur ein abstraktes Bild eines uns fernen Geschehens. Ein Detail des Bildes ist noch nicht ins Blickfeld geraten, obwohl es auch im Sinne einer Kältesituation bei der Geburt gedeutet werden könnte.
Ein Detail des Bildes ist noch nicht ins Blickfeld geraten, obwohl es auch im Sinne einer Kältesituation bei der Geburt gedeutet werden könnte.  Dafür spricht der Umstand, dass es einen ikonographischen Beleg für dieses Motiv gibt, der zudem auch noch aus Multschers Werkstatt stammt und der zeigt, wie Josef seine Schuhe ablegt, ein Hosenkleid bereits ausgezogen hat und nun das zweite auszieht. Und da auf diesem Bild das Kind nackt ist, hat diese Aktion auch ihre Logik. Ob das abgelegt Beinstück aber für das nackte Kind gedacht ist, lässt sich aus diesem Bild nicht direkt erschließen.
Dafür spricht der Umstand, dass es einen ikonographischen Beleg für dieses Motiv gibt, der zudem auch noch aus Multschers Werkstatt stammt und der zeigt, wie Josef seine Schuhe ablegt, ein Hosenkleid bereits ausgezogen hat und nun das zweite auszieht. Und da auf diesem Bild das Kind nackt ist, hat diese Aktion auch ihre Logik. Ob das abgelegt Beinstück aber für das nackte Kind gedacht ist, lässt sich aus diesem Bild nicht direkt erschließen. Dementsprechend gibt es von einem unbekannten rheinischen Meister ein Bild, bei dem Josef sein Beinkleid zu Kleidungsstücken umarbeitet. Die Web Gallery of Art schreibt dazu:
Dementsprechend gibt es von einem unbekannten rheinischen Meister ein Bild, bei dem Josef sein Beinkleid zu Kleidungsstücken umarbeitet. Die Web Gallery of Art schreibt dazu: Aber es gibt ja noch ein zweites Bild, das bei dieser Weihnachtsbetrachtung eine Rolle spielt: die Anbetung durch die Heiligen Drei Könige. Diese ereignet sich nach der biblischen Überlieferung einige Tage nach der Geburt. Folgt man der Logik unserer Fest- und Feiertage, kommt erst die Beschneidung (die wir am 1. Januar feiern) und dann erst die Anbetung der drei Weisen oder Könige (die wir am 6. Januar feiern). Jesus, das ist für das Folgende wichtig, ist aber auch da noch keine 14 Tage alt.
Aber es gibt ja noch ein zweites Bild, das bei dieser Weihnachtsbetrachtung eine Rolle spielt: die Anbetung durch die Heiligen Drei Könige. Diese ereignet sich nach der biblischen Überlieferung einige Tage nach der Geburt. Folgt man der Logik unserer Fest- und Feiertage, kommt erst die Beschneidung (die wir am 1. Januar feiern) und dann erst die Anbetung der drei Weisen oder Könige (die wir am 6. Januar feiern). Jesus, das ist für das Folgende wichtig, ist aber auch da noch keine 14 Tage alt. Auch bei der
Auch bei der  Das Thema des frierenden Vaters auf der ersten Tafel spielt auf der zweiten Tafel offenbar gar keine Rolle mehr, der knapp 14 Tage alte Jesus wird den fremden Gästen ziemlich nackt präsentiert. Es wäre überraschend, wenn das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gemacht würde.
Das Thema des frierenden Vaters auf der ersten Tafel spielt auf der zweiten Tafel offenbar gar keine Rolle mehr, der knapp 14 Tage alte Jesus wird den fremden Gästen ziemlich nackt präsentiert. Es wäre überraschend, wenn das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gemacht würde. 

 Man kann die Gruppe anhand der dominanten Farben in zwei Hälften teilen.
Man kann die Gruppe anhand der dominanten Farben in zwei Hälften teilen. Die hintere Reihe der rechten Gruppe ist – so viel kann man doch wohl sagen – als ziemlich derb gezeichnet.
Die hintere Reihe der rechten Gruppe ist – so viel kann man doch wohl sagen – als ziemlich derb gezeichnet. 
 Ich finde nun nicht, dass man sagen kann, so sind die Menschen realistisch betrachtet einfach.
Ich finde nun nicht, dass man sagen kann, so sind die Menschen realistisch betrachtet einfach.  Kommen wir nun zu einem Hauptmotiv der zweiten Bildtafel. Es ist vor allem identitätspolitisch interessant. Von Rassismus lässt sich in der Mitte des 16. Jahrhunderts ja noch nicht sprechen, entsprechende Theorien kommen erst Jahrhunderte später auf.
Kommen wir nun zu einem Hauptmotiv der zweiten Bildtafel. Es ist vor allem identitätspolitisch interessant. Von Rassismus lässt sich in der Mitte des 16. Jahrhunderts ja noch nicht sprechen, entsprechende Theorien kommen erst Jahrhunderte später auf.
 Eine Figur aber sticht heraus und der müssen wir uns nun abschließend kurz zuwenden. Es ist die neben dem ‚Mohrenkönig‘ zentrale Figur auf der rechten Seite (die freilich auf der Weihnachtskarte ausgeblendet wurde) und diese ist überaus ambivalent dargestellt und das muss eine bewusste Akzentuierung von Multscher sein. Man weiß zunächst gar nicht, wie man diese Figur beschreiben soll, aus heutiger sich wirkt sie geradezu karnevalesk und dieser Eindruck ist vielleicht nicht einmal falsch. Wir könnten hier eine übertragene Figur des höfischen Narren vor uns haben. Zumindest könnte seine schwarz-rote Kappe darauf hindeuten.
Eine Figur aber sticht heraus und der müssen wir uns nun abschließend kurz zuwenden. Es ist die neben dem ‚Mohrenkönig‘ zentrale Figur auf der rechten Seite (die freilich auf der Weihnachtskarte ausgeblendet wurde) und diese ist überaus ambivalent dargestellt und das muss eine bewusste Akzentuierung von Multscher sein. Man weiß zunächst gar nicht, wie man diese Figur beschreiben soll, aus heutiger sich wirkt sie geradezu karnevalesk und dieser Eindruck ist vielleicht nicht einmal falsch. Wir könnten hier eine übertragene Figur des höfischen Narren vor uns haben. Zumindest könnte seine schwarz-rote Kappe darauf hindeuten.