Ein Rundblick
Andreas Mertin
 Kunstforum International
Kunstforum International
Beginnen wir mit der „alten“ Zeitschrift. Nicht einer wirklich alten, die wir irgendwelchen Archiven entringen können, sondern einer, die älter als dieses Magazin ist. Das 50jährige Jubiläum feiert gerade das Kunstforum International und ist damit doppelt so alt wie dieses Magazin. Das Kunstforum ist die mit Abstand wichtigste Kunstzeitschrift in Deutschland (und nebenbei bemerkt, die einzige Zeitschrift, die ich überhaupt noch im Abonnement habe).
Eine größere, breite Öffentlichkeit nimmt das Kunstforum vermutlich nur zur Kenntnis, wenn wieder eine Ausgabe zur Biennale in Venedig oder zur Documenta in Kassel erscheint. Zur Begehung dieser Ausstellungen ist das Kunstforum inzwischen unentbehrlich.
Für das Fachpublikum, also für Künstler:innen, Kurator:innen, Galerist:innen, Kunst-Journalist:innen und viele andere ist das Kunstforum International aber die Pflichtlektüre schlechthin. Stolze 288 Bände hat es bisher gegeben, also etwa 6 Hefte im Jahr. Jede Ausgabe ist text- und bildgesättigt, immer anregungsreich und nachdenkenswert.
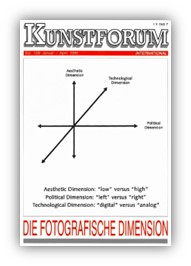 Auch meine eigene Kuratorentätigkeit wurde vom Kunstforum International beeinflusst. 1995 begann ich meine Arbeit als Kurator mit der Mitarbeit an der Kunstausstellung des deutschen Evangelischen Kirchentages in Hamburg. Dort war der Künstler Thom Barth mit einer Arbeit vertreten. Im gleichen Jahr las ich dann einen Text von Stephan Berg im Kunstforum International Band 129 mit dem Titel »Die Ornamente Kommen nie zum Schluss«. Vorgestellt wurde eine Arbeit von Thom Barth im Kunstraum Wuppertal. Und ich fragte mich nach der Lektüre, wie eine derartige Inszenierung wohl in einer Kirche mit ihrem riesigen Raumvolumen aussehen würde. Drei Jahre später hatte ich dann die Gelegenheit, Thom Barth persönlich zu fragen, ob er sich so etwas vorstellen könnte und das Ergebnis ist den Leser:innen des Magazins bekannt.
Auch meine eigene Kuratorentätigkeit wurde vom Kunstforum International beeinflusst. 1995 begann ich meine Arbeit als Kurator mit der Mitarbeit an der Kunstausstellung des deutschen Evangelischen Kirchentages in Hamburg. Dort war der Künstler Thom Barth mit einer Arbeit vertreten. Im gleichen Jahr las ich dann einen Text von Stephan Berg im Kunstforum International Band 129 mit dem Titel »Die Ornamente Kommen nie zum Schluss«. Vorgestellt wurde eine Arbeit von Thom Barth im Kunstraum Wuppertal. Und ich fragte mich nach der Lektüre, wie eine derartige Inszenierung wohl in einer Kirche mit ihrem riesigen Raumvolumen aussehen würde. Drei Jahre später hatte ich dann die Gelegenheit, Thom Barth persönlich zu fragen, ob er sich so etwas vorstellen könnte und das Ergebnis ist den Leser:innen des Magazins bekannt.

 Im Jahr 2002 rezensierte dann Marcus Lütkemeyer die von Karin Wendt und mir in der Kasseler Martinskirche kuratierte Ausstellung „Der freie Blick“ mit Thom Barth und zwei weiteren Künstler:innen im Kunstforum International Band 162: „Dagegen betreibt der ‚Freie Blick‘ keine betuliche Verschleifung der unterschiedlichen Betriebssysteme, sondern eröffnet einen subtilen Dialog, ohne das jeweils andere in Frage stellen oder gar kolonialisieren zu wollen.“ So schloss sich der Kreis.
Im Jahr 2002 rezensierte dann Marcus Lütkemeyer die von Karin Wendt und mir in der Kasseler Martinskirche kuratierte Ausstellung „Der freie Blick“ mit Thom Barth und zwei weiteren Künstler:innen im Kunstforum International Band 162: „Dagegen betreibt der ‚Freie Blick‘ keine betuliche Verschleifung der unterschiedlichen Betriebssysteme, sondern eröffnet einen subtilen Dialog, ohne das jeweils andere in Frage stellen oder gar kolonialisieren zu wollen.“ So schloss sich der Kreis.
Insofern freue ich mich auf jede neue Ausgabe des Kunstforum International, weil sie so viele Anregungen enthält. Ich besitze leider nicht alle Bände der Zeitschrift, aber dank einer großzügigen Spende eines Freundes ist die Sammlung ab Band 75 lückenlos und füllt ein Regal in meinem Arbeitszimmer. Damit ich nicht immer aufstehen und blättern muss, erleichtert mir der Online-Zugang, der allen Abonnenten zur Verfügung steht und alle Hefte seit dem allerersten im digitalen Volltext enthält, die Arbeit. Wer sich in der Kirche auf einem fachlich angemessenen Niveau mit Kunst beschäftigen will, kommt am Kunstforum International und damit auch an einem Abonnement dieser Zeitschrift nicht vorbei.
Streit-KULTUR
 Im Geburtsjahr seiner Geschichte steht dagegen Streit-KULTUR, ein Journal für Theologie, also eine nagelneue Zeitschrift. Die erste Ausgabe trägt den Titel „Wer braucht Theologie?“ Das Heft erscheint den Leser:innen in der Erstausgabe – zum Lob und zur Kritik gesagt – als überaus protestantisch geformt. Rein sinnlich ist es eine erschreckend asketische Bleiwüste, außer einigen Personenfotos und dem Titelbild verzichtet man auf jedes visuelle Argument. Es ist, als ob es den iconic turn des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht gegeben hätte – zumindest nicht in der protestantischen Theologie. Das ist ein grundlegendes Problem, weil offenbar führende Theolog:innen nicht begriffen haben, wie sich die Welt in den letzten 50 Jahren gewandelt hat – auch und gerade in der Vermittlung grundlegender Gedanken. Persönlich glaube ich, dass diese Form des reinen Buchstaben-Glasperlenspiels endgültig überholt ist, die Antwort aber auch keine visuelle Symbolpolitik sein kann, sondern eine konzise Verknüpfung von visueller Kultur und theoretischer Argumentation.
Im Geburtsjahr seiner Geschichte steht dagegen Streit-KULTUR, ein Journal für Theologie, also eine nagelneue Zeitschrift. Die erste Ausgabe trägt den Titel „Wer braucht Theologie?“ Das Heft erscheint den Leser:innen in der Erstausgabe – zum Lob und zur Kritik gesagt – als überaus protestantisch geformt. Rein sinnlich ist es eine erschreckend asketische Bleiwüste, außer einigen Personenfotos und dem Titelbild verzichtet man auf jedes visuelle Argument. Es ist, als ob es den iconic turn des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht gegeben hätte – zumindest nicht in der protestantischen Theologie. Das ist ein grundlegendes Problem, weil offenbar führende Theolog:innen nicht begriffen haben, wie sich die Welt in den letzten 50 Jahren gewandelt hat – auch und gerade in der Vermittlung grundlegender Gedanken. Persönlich glaube ich, dass diese Form des reinen Buchstaben-Glasperlenspiels endgültig überholt ist, die Antwort aber auch keine visuelle Symbolpolitik sein kann, sondern eine konzise Verknüpfung von visueller Kultur und theoretischer Argumentation.
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass man nur dankbar sein kann, wenn jenseits der Hau-Drauf-Argumentation wie bei manchen Beiträgen auf z(w)eitzeichen im Protestantismus überhaupt eine Streit-Kultur eingeübt wird. Ob es wirklich eine Kultur ist, die hier entwickelt wird, vermag ich noch nicht zu sagen, dazu müsste man noch einige Jahre abwarten. Nur ein paar Annotationen seien gestattet:
Open Access
Die Zeitschrift Streit-KULTUR erscheint im Open-Access-Verfahren. Darin, das darf an dieser Stelle einmal ganz uneitel gesagt werden, ist sie ein Vierteljahrhundert hinter der Zeit zurück.
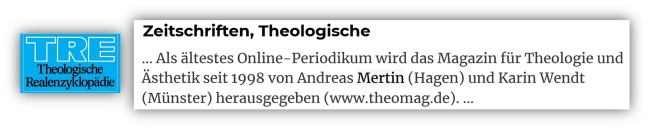
Waren es Ende des letzten Jahrtausends nur wenige theologisch Interessierte, die mit theologischen Texten im Open Access Verfahren an die Öffentlichkeit gingen (meist mit zu wenig Durchhaltevermögen), so sind in der Zwischenzeit doch einige diesem Beispiel gefolgt. Open Access im Jahr 2023 kann aber nicht heißen, Texte, die man ansonsten hinter Bezahlschranken vor dem gemeinen Kirchenvolk versteckt hatte, nun diesem im Internet als PDF zugänglich zu machen, ohne sonst irgendwie in die Form einzugreifen. Vielmehr gilt es, angemessen darüber zu reflektieren, was die Hypertext-Struktur des Internets für die theologische Vermittlung bedeuten kann. Es ist sicher kein Zufall, dass die Herausgeber:innen von Streit-KULTUR lieber auf das eher katholisch anmutende PDF-Format gesetzt haben, das die Texte autoritär so fixiert, wie sie von den Urheber:innen fixiert wurden. Zwar ist das PDF-Format heute flexibler als noch vor 25 Jahren, aber es hat immer noch den Gestus des festgelegten Textes.
Apologetik
Man könnte mit einigen Gründen Streit-KULTUR als apologetisches Unternehmen bezeichnen. Es sucht eingestandenermaßen einer größeren Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass die Systematische Theologie auch heute noch und dabei durchaus im Zwiegespräch etwas zu sagen hat. Dass sie dabei in der Erstausgabe über sich selbst redet – geschenkt. Es dokumentiert die Verunsicherung der Theologie über ihre eigene Rolle. Emphatisch ist die nun gewählte Form nicht.
Als emphatische Rede über Theologie empfinde ich die bildgesättigte Sprache Karl Barths, mit der er 1934 seine Zunft einsichtig machen will:
 Unter allen Wissenschaften ist die Theologie die schönste, die den Kopf und das Herz am reichsten bewegende, am nächsten kommend der menschlichen Wirklichkeit und den klarsten Ausblick gebend auf die Wahrheit, nach der alle Wissenschaft fragt, am nächsten kommend dem, was der ehrwürdige und tiefsinnige Name einer „Fakultät“ besagen will, eine Landschaft mit fernsten und doch immer noch hellen Perspektiven wie die von Umbrien oder Toskana und ein Kunstwerk, so wohl überlegt und so bizarr wie der Dom von Köln oder Mailand. Arme Theologen und arme Zeiten in der Theologie, die das etwa noch nicht gemerkt haben sollten!
Unter allen Wissenschaften ist die Theologie die schönste, die den Kopf und das Herz am reichsten bewegende, am nächsten kommend der menschlichen Wirklichkeit und den klarsten Ausblick gebend auf die Wahrheit, nach der alle Wissenschaft fragt, am nächsten kommend dem, was der ehrwürdige und tiefsinnige Name einer „Fakultät“ besagen will, eine Landschaft mit fernsten und doch immer noch hellen Perspektiven wie die von Umbrien oder Toskana und ein Kunstwerk, so wohl überlegt und so bizarr wie der Dom von Köln oder Mailand. Arme Theologen und arme Zeiten in der Theologie, die das etwa noch nicht gemerkt haben sollten!
„Offenbarung, Kirche, Theologie“ ist ein nun knapp 90 Jahre alter theologischer Text, der aber zumindest auch visuell zu argumentieren vermag. Das naheliegendste Bild, das mir die Zeitschrift „Streit-Kultur“ dagegen zumindest assoziativ vermittelt, ist das vom überaus steilen Turmbau zu Babel, das wir beim Meister der Weltenchronik finden, ein Bild, bei dem einige ganz weit oben an ihrem Donum Superadditum basteln und sich schon weit vom Volk unten auf der Erde entfernt haben – auch wenn sie durchaus glauben, noch am selben Projekt zu arbeiten.
 In der katholischen Theologie wird regelmäßig über Apologetik reflektiert und hier finde ich eine Bemerkung des späteren Papstes Benedikt interessant, auch wenn sie im Protestantismus kaum nachvollzogen werden kann:
In der katholischen Theologie wird regelmäßig über Apologetik reflektiert und hier finde ich eine Bemerkung des späteren Papstes Benedikt interessant, auch wenn sie im Protestantismus kaum nachvollzogen werden kann:
„Die einzig wirkliche Apologie des Christentums kann sich auf zwei Argumente beschränken: die Heiligen, die die Kirche hervorgebracht hat, und die Kunst, die in ihrem Schoß gewachsen ist. Der Herr ist durch die Großartigkeit der Heiligkeit und der Kunst, die in der gläubigen Gemeinde entstanden sind, eher beglaubigt als durch die gescheiten Ausflüchte, die die Apologetik zur Rechtfertigung der dunklen Seiten erarbeitet hat, an denen die menschliche Geschichte der Kirche leider so reich ist.“
Kunst und Kultur
Und damit komme ich zur Kunst und zur KULTUR, die in der Zeitschrift ja zumindest formal großgeschrieben wird. Zur Kultur gehört aber für mich auch, dass das Wort „Kunst“ nicht im Sinn von Können (a là „Kunst des Zuhörens“, „Kunst des Hinhörens“) gebraucht wird. Das ist unterkomplex. Ja, es ist Alltagssprache, aber wie ein kurzer Blick in die Datenbanken zeigt, vor allem Werbesprache. Sie ist inzwischen vollständig sinnentleert. Zugleich zerstört diese Rede jede positive Bestimmung von Kunst. Ebenso problematisch finde ich in einer Zeitschrift, die sich unter dem Wort KULTUR rubriziert, die despektierliche, weil im trivialen Sinn verwendete Formulierung „Ist das Kunst oder kann das weg?“ So etwas finde ich peinlich. Ich sage und schreibe auch nicht in unserer Kultur-Zeitschrift: „Ist das Theologie oder lässt es sich belegen?“ Derlei Stammtisch-Feuilleton sollte man sich ersparen. Der betreffende Autor schreibt:
„Wer so fragt, gibt bereits zu verstehen, dass die erwähnte Kunst genaugenommen nicht von Abfall zu unterscheiden ist, dass es aber dennoch offensichtlich Menschen gibt, die es durchsetzen können, das dem Abfalleimer zu Überantwortende als wertvoll auszugeben.“
Das ist die kleinbürgerliche Interpretation der Formulierung. Im Betriebssystem Kunst selbst hat sie aber eine völlig andere Bedeutung. Die Frage „Ist das Kunst oder kann das weg? ist seit dem 20. Jahrhundert eine zutiefst kunstphilosophische, die etwas mit der von Arthur C. Danto beschriebenen „Verklärung des Gewöhnlichen“ (The transfiguration (sic!) of the commonplace) zu tun hat. Es ist eben nicht so, dass damit gesagt wird, dass die Kunst eigentlich Abfall ist, sondern, dass es der Kunst gelingt, selbst im Abfall noch Bedeutung zu generieren, dass, um eine Formulierung von Danto aufzugreifen, bei zwei Gegenständen, die genau gleich aussehen, eines ein Kunstwerk und das andere keines sein konnte, exemplifizierbar an den Readymades von Marcel Duchamp. Das ist eine der großen menschlichen Einsichten, die im Verlauf von 700 Jahren Kunstgeschichte entwickelt und gewonnen wurden und die man nicht unter Verweis auf eine Ermächtigungs- oder Durchsetzungselite ins Gegenteil kehren sollte.
 Dass die Theologie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – es nicht geschafft hat, überhaupt auf dieses Niveau zu kommen, spricht gegen sie. Wenn die akademische Theologie zu dem fähig wäre, was die Bildende Kunst seit 1300 und kulminierend im 20. Jahrhundert geleistet hat, das Gewöhnliche, das Übersehene, das Marginale und Fragmentarische in einer neuen Perspektive zu betrachten und bedeutsam erscheinen zu lassen – dann stünden wir theologisch heute besser da. So aber redet sie von oben, von sehr weit oben herab, sie beugt sich herunter zur Lebenswirklichkeit der einfachen Menschen. Abwertende Formulierungen gegenüber der Abfall-Kunst erinnern mich ein wenig an den Kampf der Theologen des 19. Jahrhunderts gegen den Realismus von Gustave Courbet und Jean-François Millet.
Dass die Theologie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – es nicht geschafft hat, überhaupt auf dieses Niveau zu kommen, spricht gegen sie. Wenn die akademische Theologie zu dem fähig wäre, was die Bildende Kunst seit 1300 und kulminierend im 20. Jahrhundert geleistet hat, das Gewöhnliche, das Übersehene, das Marginale und Fragmentarische in einer neuen Perspektive zu betrachten und bedeutsam erscheinen zu lassen – dann stünden wir theologisch heute besser da. So aber redet sie von oben, von sehr weit oben herab, sie beugt sich herunter zur Lebenswirklichkeit der einfachen Menschen. Abwertende Formulierungen gegenüber der Abfall-Kunst erinnern mich ein wenig an den Kampf der Theologen des 19. Jahrhunderts gegen den Realismus von Gustave Courbet und Jean-François Millet.
Gender
Sprachlich verwendet das Journal verschiedene Formen zur Benennung der Geschlechter, häufig die Form „Theologinnen und Theologen“, begleitet vom Genderstern. Die Reduktion auf das generische Maskulinum findet sich nicht. Das ist begrüßenswert und löst sich von der Praxis mancher evangelischen Verlage.
Theologie auf der Höhe der Zeit
Die Forderung danach, aus dem inneruniversitären Ghetto auszubrechen, die ein Text in der Erstausgabe von Streit-KULTUR erhebt, und sich einer Populartheologie zu öffnen, kann aber nicht darin bestehen, die Theologie, also das je schon Gedachte nun publikumsorientierter zu verbreiten. Ich fürchte, das interessiert die Menschen nicht (mehr). Ich glaube, der Bewährungsfall der Theologie der Gegenwart besteht darin, den Menschen beim Begreifen der Gegenwart selbst zu helfen. Das fatale Schweigen der Theologie in meinem eigenen Fachbereich – der Bildenden Kunst – ist beredt. Wenn sie sich einmal äußert, artikuliert sie moralinsaure Kunstkritik, die sich der Unkenntnis des Betriebssystems Kunst schnell überführt. Und ich fürchte, das gilt für viele Kulturbereiche – vom Film vielleicht abgesehen. Wenn wir aber immer nur Vor-Urteile abgeben und uns nicht durch Fachkompetenz auszeichnen, sind wir überflüssig geworden. Da hilft dann auch keine Streit-KULTUR, die so tut, als gäbe es da etwas, über das sich zu streiten lohnt. Auf dem Spiel steht aber die Theologie als Ganze, ihre Kraft, die Gegenwart zu erhellen, Gespräche zu führen, die nicht nur Gespräche unter Funktionären sind, sondern mit Betroffenen und Suchenden.
Wenn es Streit-KULTUR gelänge, dahin zu kommen, wäre es gut. Wir sprechen uns in 25 Jahren wieder und bilanzieren dann 75 Jahre Kunstforum International, 50 Jahre tà katoptrizómena und 25 Jahre Streit-KULTUR. Schaun mer mal.

