
Verstehst Du das?
|
Betriebsunfall Antijudaismus?Oder: Wer im Glashaus sitzt ...Andreas Mertin
Was mich im Folgenden aber mehr beschäftigt, sind die Konsequenzen, die wir aus dem Verhalten gegenüber der Documenta, ihren Kurator:innen und den Künstler:innen in der Zukunft ziehen, und zwar gerade im Blick auf die Kirche selbst. Die deutsche Gesellschaft hat gegenüber den indonesischen Kurator:innen und Künstler:innen sehr hohe ethische Standards angelegt, höhere, als sie sich selbst – etwa in der Frage der sog. Wittenberger Judensau – anlegen wollte. Während es in Wittenberg ausreichen sollte, wenn die Kirche die fortdauernd die Juden beleidigende Skulptur nicht entfernt, sondern nur kommentiert, reichte die analoge Haltung der Documenta nicht. Als diese zusagte, sie wolle das inkriminierte Objekt kommentieren, verlangte man ultimativ dessen Entfernung. Meines Erachtens ein klarer Fall von Doppelstandards. Um diese Form von Doppelstandards geht es mir im Folgenden. Wenn wir an dem ethischen Standard festhalten, den wir gegenüber Ruangrupa und der Gruppe Taring Padi vor den Augen der Weltöffentlichkeit aufgestellt haben, was bedeutet das für all die antijudaistischen, antisemitischen Kunstwerke an und in den deutschen Kirchen? Und was bedeutet es für die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit, die auch in der Gegenwart keine Probleme damit zu haben scheint, antijudaistische Kunstwerke zur Illustration heutiger Texte und Pressemeldungen einzusetzen? Müssten wir nicht auch hier neue Standards anwenden, eine neue Ethik des Umgangs mit Kunst – wie eben in Kassel? Ich will an drei relativ aktuellen Beispielen erläutern, was ich damit meine. Beispiel 1
Der Redaktion, die das Bild auswählte, war das ganz sicher nicht bewusst (so wie den Kurator:innen von Ruangrupa, als sie die Künstlergruppe Taring Padi einluden). Aber sie haben auch nicht hingeschaut, was sie da eigentlich präsentieren. Dass sie damit gegen die Synagoge und die Juden hetzen, war so gesehen ein Betriebsunfall. Aber es kann nicht so stehen bleiben. Wir müssen eine Ethik aufmerksamer Theologie entwickeln, damit Derartiges nicht mehr passiert. Beispiel 2
Dabei gibt es in der Zwischenzeit durchaus explizite Arbeitshilfen zu dem Thema, sogar solche, die die Ev. Kirche selbst herausgegeben hat – nur bleiben sie folgenlos. Als Hochglanzbroschüre machen sie sich gut, entfalten aber keine Breitenwirksamkeit. Im Lutherjahr 2017 hat die Ev. Kirche im Rheinland ein Heft „Der Jude als Verräter. Antijüdische Polemik und christliche Kunst“ herausgebracht, welches frei im Internet herunterladbar ist. Was aber hilft das, wenn es keine Folgen hat? Wenn nicht kirchenweit ein Gespür dafür entwickelt wird, warum derartige Bilder problematisch sein können? Und das gilt selbst dann, wenn es sich um Inkunabeln der Kunstgeschichte handelt. Beispiel 3Eines der frühesten antijudaistischen / antisemitischen Motive in der christlichen Ikonographie erfreut sich bis in die Gegenwart höchster Beliebtheit in den christlichen Gemeinden, vor allem aber auch in christlichen Kinderbüchern. Selbst die antirassistische Alle-Welt-Bibel hat offenbar kein Problem damit, dieses antijudaistische Motiv aufzugreifen. In der Regel wird das damit erklärt, dass heutzutage niemand mehr weiß, dass es überhaupt ein das Judentum herabsetzenden und entwürdigendes Motiv ist. Und selbst da, wo man um den Kontext weiß, findet sich bis heute die Bemerkung, in der Sache treffe das Motiv ja auch zu, denn das Judentum wende sich schließlich vom Herrn ab. Es ist verstörend, wenn man derartiges heute immer noch lesen muss. Wovon spreche ich? Als das Christentum begann, seine Ikonographie auszuarbeiten, war vieles noch ungeklärt. Konnte/durfte man die Kreuzigung darstellen? Das erfolgte bekanntlich erst nach 420 n.Chr. Welche Rolle hatte Maria im Blick auf das Heilsgeschehen? Das wurde erst in den mariologischen Beschlüssen des Konzils von Nizäa 431 näher bestimmt. Bis dahin war Maria auf einigen Szenen der Geburt Christi gar nicht zu sehen.
Dabei gibt es zwei antijudaistische Auslegungstraditionen. In der einen repräsentieren die beiden Tiere Judentum und Heidentum. So sieht es Origenes in seiner Auslegung: „Die Hirten fanden Jesus in der Krippe liegen. So hatte bereits der Prophet geweissagt: Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn … Der Ochse ist ein reines Tier, der Esel dagegen ein unreines; der Ochs versinnbildlicht das Volk der Juden, der Esel das Volk der Heiden. Nicht das Volk Israel erkennt seinen Herrn, sondern das unreine Tier, nämlich die Heiden.“
Und dieses mit der Geburtserzählung neu verknüpfte „Weh dem sündigen Volk …“ sollte dann eine fatale Wirkungsgeschichte haben. So oder so markierte die Darstellung von Ochs und Esel die Abgrenzung vom Judentum – obwohl es vom biblischen Erzähltext gar nicht vorgegeben ist. Diese Tradition setzt sich über Jahrhunderte, ja Jahrtausende vor, bekommt volkstümlichen Charakter – gerade auch weil man in Schauspielen echte Tiere verwenden konnte. Dabei tritt der ursprünglich antijudaistische / antisemitische Gehalt in den Hintergrund, das Folkloristische tritt in den Vordergrund. Es ist aber nicht so, als ob die antijudaistische Bedeutung ganz verloren gegangen wäre, der Bezug auf Jesaja 1, 3 ist durchaus noch bei manchen Theologen präsent. Nach 1945 – so hätte man meinen können – reflektiert das Christentum jene Strukturen in seiner Theologie und seiner Kunstgeschichte, die Auschwitz ermöglicht haben. Aber dem ist nicht so. Auch wenn in der fachtheologischen Literatur immer wieder darauf hingewiesen wird, dass wir es hier „mit einer nicht zu rechtfertigenden antijüdischen Polemik“ (Ulrich Berges) zu tun haben, auch wenn Pinchas Lapide darauf hinweist, dass durch Ochs und Esel der Abfall Israels markiert werde, es ändert sich nichts.
Vielleicht haben die frühen Christen dieses Bild herangezogen, um sich über das jüdische Volk lustig zu machen, wenn sie sagen, dass eher Ochse und Esel den Herrn erkennen, bis das Volk Israel so weit ist. Diesem christlichen Antijudaismus müssen wir uns nicht anschließen. Aber dieses Bild hat trotzdem eine Bedeutung für uns. Ochse und Esel wissen, was los ist, sie haben verstanden, auch wenn sie als Tiere nicht des Nachdenkens mächtig sind. Sie wissen sich am rechten Ort. Wenn schon Ochse und Esel so verständig sind und das Kind in der Krippe als den Messias erkennen, dann ist es für uns ein leichtes, dies ebenso sehen. Sehenden Auges nimmt man den Antijudaismus in Kauf, um Ochs und Esel zu retten. FazitBedenkt man, dass alle Beispiele nun seit Jahren rund um die Uhr auf Webseiten der Kirchen präsent sind und sich kirchenintern offenkundig niemand daran gestoßen und dagegen protestiert hat, dann stehen wir wirklich vor einem Problem. Was Not täte, wäre eine Qualifizierung kirchlicher Mitarbeiter in Sachen sensibler Wahrnehmung von christlicher Ikonographie – gerade auch in Sachen Antijudaismus und Antisemitismus. Seit eineinhalb Jahrtausenden haben wir uns in der christlichen Kunst vom Judentum abgesetzt und tun in der Gegenwart so, als ginge uns das alles nichts an. Aber so ist es nicht. Als Julius Streicher 1945 wegen seiner herabsetzenden Bilder und Texte vor dem Nürnberger Gericht stand, sagte er zu seiner Verteidigung: aber die Kirchen machen das in ihrer Kultur und in ihren Texten doch auch. Die christlichen Bild- und Textwelten haben Auschwitz mit vorbereitet – beginnend mit der nahezu beiläufigen Darstellung von Ochs und Esel, über eine der frühesten Kreuzigungsdarstellungen des Christentums, die neben die Kreuzigung den Suizid des Judas platziert. Um dann hundert Jahre später zu entdecken, dass das Abendmahl eine viel bessere Folie bietet, sich von den Juden in Gestalt des Judas‘ abzusetzen. Dass sich palästinensische Künstler:innen auf der Documenta in ihrer antiisraelischen Polemik christlicher Bildmotive bedienten, spricht für sich. Sie haben es von uns gelernt. Gerade in der Frage des Umgangs mit derart belasteter Kunst könnten die Kirchen vorbildlich sein. Die Zivilgesellschaft hört ja auf die Kirche, wenn die qualifiziert und kompetent auf Probleme aufmerksam macht. Das galt auch für die Documenta fifteen, in deren Abschlussbewertung durch das Expertengremium ja durchaus theologische Stellungnahmen eingeflossen sind, weil sie sich an der Sache abarbeiteten und zeigen konnten, inwiefern Kunstwerke der Documenta sich der antijudaistischen Bildsprache bedienten. Es geht bei all dem nicht um die Kontrolle oder die Zensur der Kunst, sondern darum, mit der Kunst, mit den Kurator:innen und den Künstler:innen zu Ergebnissen zu kommen, die einer avancierten Gesellschaft angemessen sind. Die Künstlerin Hito Steyerl hat das auf und während der documenta exemplarisch gezeigt. An derartiges Problembewusstsein sollten wir anknüpfen und auch in Sachen Kunst und Kirche auf Augenhöhe ankommen. Nachweisehttps://www.sonntagsblatt.de/artikel/glaube/predigt-zum-karfreitag-schmerzhafte-verluste https://www.ekd.de/wechselseitige-abendmahlsteilnahme-evangelisch-katholisch-49580.htm |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/143/am796.htm |
 Das Kunstjahr 2022 war in der an Skandalen nicht armen Kunstgeschichte doch ein besonderes Jahr. Beinahe wäre die bis dato bedeutendste Kunstausstellung geplatzt, weil man sich nicht auf kulturpolitische Standards einigen konnte, nach denen man verfahren sollte. Während die einen auf die im Grundgesetz verankerte Kunstfreiheit setzten, meinten andere, die Kunstfreiheit fände ihre Grenzen beim Thema Antisemitismus und Rassismus. Offenkundig wurde, dass zentrale Einsichten derjenigen, die unsere Verfassung entworfen haben, nicht mehr im Bewusstsein der Debattierenden verankert waren. Zwei zentrale Motive bestimmten die Verfasser:innen des Grundgesetzes in diesen strittigen Fragen: zum einen, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, dass nie wieder in Deutschland Juden um ihr Leben fürchten müssten. Zum anderen, dass nie wieder der Staat, so wie es der Nationalsozialistische Staat getan hatte, sich kulturpolitisch in die Kunst einmischt und ihr vorgibt, was sie zu zeigen und zu sagen hat und was nicht. Beide Motive sind grundlegend für das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland, beide Motive können aber auch – und das zeigte nun die documenta fifteen deutlich – in einen Konflikt geraten. Die von der Politik vertretene Position, man könne der Kunst Grenzen setzen, hat sich letztlich nicht durchsetzen können. Zwar wurde unter dem Druck der Öffentlichkeit ein Kunstwerk abgehängt, aber die Documenta konnte bis zum Schluss besucht werden. Was nicht gelang, war ein gesellschaftliches Gespräch über die strittigen Fragestellungen, ein Gespräch, das eigentlich für alle Beteiligten essentiell gewesen wäre. Auch die Kirchen haben sich in dieser Sache nicht mit Ruhm bekleckert. Sie waren verurteilender Part eine der am Konflikt beteiligten Seiten und nicht einmal ansatzweise an der Abwägung von Grundrechten interessiert.
Das Kunstjahr 2022 war in der an Skandalen nicht armen Kunstgeschichte doch ein besonderes Jahr. Beinahe wäre die bis dato bedeutendste Kunstausstellung geplatzt, weil man sich nicht auf kulturpolitische Standards einigen konnte, nach denen man verfahren sollte. Während die einen auf die im Grundgesetz verankerte Kunstfreiheit setzten, meinten andere, die Kunstfreiheit fände ihre Grenzen beim Thema Antisemitismus und Rassismus. Offenkundig wurde, dass zentrale Einsichten derjenigen, die unsere Verfassung entworfen haben, nicht mehr im Bewusstsein der Debattierenden verankert waren. Zwei zentrale Motive bestimmten die Verfasser:innen des Grundgesetzes in diesen strittigen Fragen: zum einen, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, dass nie wieder in Deutschland Juden um ihr Leben fürchten müssten. Zum anderen, dass nie wieder der Staat, so wie es der Nationalsozialistische Staat getan hatte, sich kulturpolitisch in die Kunst einmischt und ihr vorgibt, was sie zu zeigen und zu sagen hat und was nicht. Beide Motive sind grundlegend für das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland, beide Motive können aber auch – und das zeigte nun die documenta fifteen deutlich – in einen Konflikt geraten. Die von der Politik vertretene Position, man könne der Kunst Grenzen setzen, hat sich letztlich nicht durchsetzen können. Zwar wurde unter dem Druck der Öffentlichkeit ein Kunstwerk abgehängt, aber die Documenta konnte bis zum Schluss besucht werden. Was nicht gelang, war ein gesellschaftliches Gespräch über die strittigen Fragestellungen, ein Gespräch, das eigentlich für alle Beteiligten essentiell gewesen wäre. Auch die Kirchen haben sich in dieser Sache nicht mit Ruhm bekleckert. Sie waren verurteilender Part eine der am Konflikt beteiligten Seiten und nicht einmal ansatzweise an der Abwägung von Grundrechten interessiert.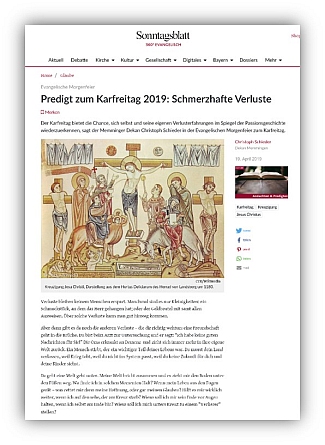 Karfreitag 2019 veröffentlicht das Evangelische Sonntagsblatt der Ev. Luth. Landeskirche in Bayern einen Text zu Karfreitag – so wie vermutlich jedes Jahr. Und wie immer ist die Redaktion herausgefordert, dazu eine passende „Illustration“ auszuwählen. Und wie man das heute so macht, schaut man in eine kommerzielle Bilddatenbank, gibt das Stichwort „Karfreitag“ oder „Kreuzigung“ ein und wählt dann ein Bild aus, was einem ansprechend erscheint und stellt es neben den Text. Kommentiert oder erläutert wird das Bild nicht, es soll ja nur eine optische Dekoration sein. In diesem Fall hat man nun ein zutiefst antijudaistisches Kunstwerk des 12. Jahrhunderts gewählt, die Kreuzigungsdarstellung aus dem Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg aus dem Jahr 1175. Sie stellt der heilsvermittelnden Ecclesia auf der einen Seite, die todbringende, blinde und gebeugte Synagoge auf der anderen Seite gegenüber. Umgesetzt wird damit u.a. die Polemik des Augustinus gegen die Juden als Gottesmörder. Im Text der Evangelischen Sonntagszeitung gibt es dazu – wie bereits gesagt – keinen Kommentar, nicht einmal eine Erläuterung. Im gleichen Hortus Deliciarum wird übrigens auch visuell behauptet, dass Juden qua Geburt der Hölle überantwortet sind. Während andere gesellschaftliche Gruppen für ihre Handlungen bestraft werden, werden Juden für ihr Existenz bestraft.
Karfreitag 2019 veröffentlicht das Evangelische Sonntagsblatt der Ev. Luth. Landeskirche in Bayern einen Text zu Karfreitag – so wie vermutlich jedes Jahr. Und wie immer ist die Redaktion herausgefordert, dazu eine passende „Illustration“ auszuwählen. Und wie man das heute so macht, schaut man in eine kommerzielle Bilddatenbank, gibt das Stichwort „Karfreitag“ oder „Kreuzigung“ ein und wählt dann ein Bild aus, was einem ansprechend erscheint und stellt es neben den Text. Kommentiert oder erläutert wird das Bild nicht, es soll ja nur eine optische Dekoration sein. In diesem Fall hat man nun ein zutiefst antijudaistisches Kunstwerk des 12. Jahrhunderts gewählt, die Kreuzigungsdarstellung aus dem Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg aus dem Jahr 1175. Sie stellt der heilsvermittelnden Ecclesia auf der einen Seite, die todbringende, blinde und gebeugte Synagoge auf der anderen Seite gegenüber. Umgesetzt wird damit u.a. die Polemik des Augustinus gegen die Juden als Gottesmörder. Im Text der Evangelischen Sonntagszeitung gibt es dazu – wie bereits gesagt – keinen Kommentar, nicht einmal eine Erläuterung. Im gleichen Hortus Deliciarum wird übrigens auch visuell behauptet, dass Juden qua Geburt der Hölle überantwortet sind. Während andere gesellschaftliche Gruppen für ihre Handlungen bestraft werden, werden Juden für ihr Existenz bestraft. Ebenfalls im Jahr 2019 diskutieren evangelische und katholische Theologen darüber, welche Wege es geben könnte, zu einem gemeinsamen Abendmahl zu kommen und plädieren für eine Teilnahme an der Abendmahlsfeier der anderen Konfession spätestens im Jahr 2021. Soweit die an sich harmlose Meldung. Dieses Mal sucht die Presseabteilung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nach einem Eye-Catcher, mit dem sie die Meldung unterfüttern will. Und findet ein aussagekräftiges antijudaistisches Bild, das Judas mit vereindeutigender Physiognomie und bezeichnender Kleidung als jüdischen Verräter charakterisiert und betont herausstellt. Mit dem eigentlichen Thema der Meldung hat dieses Kunstwerk aus der Werkstatt von Hans Holbein überhaupt nichts zu tun. Dafür gäbe es einen eigenen ikonographischen Bildtyp, die sog. Glaubensküche, in der der Friede die Konfessionen zur Toleranz aufruft. Das weiß die Presseabteilung der EKD aber nicht und wählt lieber ein antijudaistisches Bild – wieder nicht mit Absicht, sondern weil man sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, was überhaupt auf dem Bild zu sehen ist, Hauptsache etwas mit Abendmahl. Auch hier findet sich keine Erläuterung und kein Kommentar.
Ebenfalls im Jahr 2019 diskutieren evangelische und katholische Theologen darüber, welche Wege es geben könnte, zu einem gemeinsamen Abendmahl zu kommen und plädieren für eine Teilnahme an der Abendmahlsfeier der anderen Konfession spätestens im Jahr 2021. Soweit die an sich harmlose Meldung. Dieses Mal sucht die Presseabteilung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nach einem Eye-Catcher, mit dem sie die Meldung unterfüttern will. Und findet ein aussagekräftiges antijudaistisches Bild, das Judas mit vereindeutigender Physiognomie und bezeichnender Kleidung als jüdischen Verräter charakterisiert und betont herausstellt. Mit dem eigentlichen Thema der Meldung hat dieses Kunstwerk aus der Werkstatt von Hans Holbein überhaupt nichts zu tun. Dafür gäbe es einen eigenen ikonographischen Bildtyp, die sog. Glaubensküche, in der der Friede die Konfessionen zur Toleranz aufruft. Das weiß die Presseabteilung der EKD aber nicht und wählt lieber ein antijudaistisches Bild – wieder nicht mit Absicht, sondern weil man sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, was überhaupt auf dem Bild zu sehen ist, Hauptsache etwas mit Abendmahl. Auch hier findet sich keine Erläuterung und kein Kommentar.
 Aber etwas anderes war von Anfang an dabei: auf einem römischen Marmor-Sarkophag aus der Zeit um 330 n.Chr. sehen wir die Geburt Jesu, es fehlen aber Maria und Josef. Dargestellt ist ein Hirte mit Stab, der zur Geburt von Jesus herbeigeeilt ist. Hauptzeugen der Geburt des Herrn sind aber Ochs und Esel. Und diese sehr frühe Tradition, die in der Literatur der Kirchenväter schon im 2. Jahrhundert benannt wird, obwohl sie in den Evangelien gar nicht vorkommen, haben hier eine klar antijudaistische Funktion: sie markieren die Unbelehrbarkeit des Judentums.
Aber etwas anderes war von Anfang an dabei: auf einem römischen Marmor-Sarkophag aus der Zeit um 330 n.Chr. sehen wir die Geburt Jesu, es fehlen aber Maria und Josef. Dargestellt ist ein Hirte mit Stab, der zur Geburt von Jesus herbeigeeilt ist. Hauptzeugen der Geburt des Herrn sind aber Ochs und Esel. Und diese sehr frühe Tradition, die in der Literatur der Kirchenväter schon im 2. Jahrhundert benannt wird, obwohl sie in den Evangelien gar nicht vorkommen, haben hier eine klar antijudaistische Funktion: sie markieren die Unbelehrbarkeit des Judentums. Hier deutet sich eine Absetzung vom Judentum an, die dann mit der zweiten antijudaistischen Auslegungstradition verschärft wird. Nun bezieht man sich explizit auf Jesaja 1,3f.: „Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn; Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Weh dem sündigen Volk …“
Hier deutet sich eine Absetzung vom Judentum an, die dann mit der zweiten antijudaistischen Auslegungstradition verschärft wird. Nun bezieht man sich explizit auf Jesaja 1,3f.: „Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn; Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Weh dem sündigen Volk …“
 In der Zwischenzeit hat die religiöse Kulturindustrie von dem Motiv Besitz ergriffen. Eine Fülle von Gemeindebüchern mit Ochs und Esel als Titelbildern ergießen sich auf den Buchmarkt – mit vielen Auflagen von den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Hinzu kommen die Abertausenden von Krippenfiguren mit diesem Motiv. Man kann und will auf dieses kommerziell erfolgreiche Motiv nicht mehr verzichten. Und selbst dort in den Gemeinden, wo man um die ursprüngliche Bedeutung weiß, findet man das nicht so schlimm. In einer
In der Zwischenzeit hat die religiöse Kulturindustrie von dem Motiv Besitz ergriffen. Eine Fülle von Gemeindebüchern mit Ochs und Esel als Titelbildern ergießen sich auf den Buchmarkt – mit vielen Auflagen von den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Hinzu kommen die Abertausenden von Krippenfiguren mit diesem Motiv. Man kann und will auf dieses kommerziell erfolgreiche Motiv nicht mehr verzichten. Und selbst dort in den Gemeinden, wo man um die ursprüngliche Bedeutung weiß, findet man das nicht so schlimm. In einer