
Vision | Audition |
Embodying Art
Sigalit LandauKarin Wendt Choreographien der Kultur
Der „Phoenician Sand Dance“ ist eine Hommage an eine fremde und gleichwohl vertraut lebendige Kultur, von der wir heute hauptsächlich durch Inschriften auf Phönizisch wissen, eine der ältesten kanaanitischen Schriften und zudem die erste Alphabetschrift. Man kann bei dieser Arbeit auch an die „Silueta-works“ und im besonderen an die Serie der „Sand Woman“ einer der Pioniere der Performance-Kunst, Ana Mendieta (1948 Kuba – 1985 New York) denken. Mendieta arbeitete ihre Körpersilhouette in die verschiedensten Hintergründe ein, in Schlamm, Sand, Stein oder Feuer und schuf so eine Art Suggorat ihrer An- wie Abwesenheit, wie Blake Gopnik schreibt: “Mendieta developed a kind of surrogate for her own presence, which she called a ‚silueta’. It was a generic sign or icon of the supine female form, just legible as marking the contours of a human body. It was a shape Mendieta could cut into mud, or outline in wet sand, or carve into a cave wall." [1] Wie bei den “Sand Women” wird auch im „Phoenician Sand Dance“ eine vergängliche Spur des Menschlichen gelegt, die den fremden Blick auf das Eigene erlaubt. Fremdheitserfahrungen gehören zu den kulturell übergreifenden Erfahrungen von Menschen, erst durch sie können wir begreifen, welche Bedeutung kulturelle oder religiöse Verbindungen für uns haben (können). Erst der fremde Blick auf die eigene Kultur, so könnte man mit der Kunst von Sigalit Landau sagen, erlaubt es uns, deren Bewegungsmuster zu erkennen und ihre Dynamik sozusagen aus einer anderen Perspektive zu beschreiben. Noch vor allen Fragen nach Zugehörigkeit und Identifikation geht es dabei darum, Momente der Orientierungslosigkeit auszuhalten, die im Haltungswechsel entstehen. „All my work relates – in one way or another – to the loss of orientation.“ (Sigalit Landau) Wie kann er aber aussehen, der fremde Blick auf die eigene Wirklichkeit? Wie deutlich kann er und wie schonungslos muss er sein? Welchen Verletzungen begegnen wir? Das Video einer anderen Tanzperformance mit dem Titel „Barbed Hula“, ebenfalls gedreht an einem der Strände in Israels Süden, thematisiert eine schmerzvolle Dimension der kulturellen Prägung. Man sieht die Künstlerin zunächst von weitem, wie sie nackt mit einem Hula-Hoop-Reifen tanzt. Dann fährt die Kamera näher heran, und man erkennt, dass der Reifen aus Stacheldraht besteht und mit jeder Drehung den Körper mehr und mehr verletzt. Das Betrachten dieses „grausamen Ornaments“, der (auto-)erotischen Hüftbewegung eines Frauentorsos, entfaltet eine hypnotische Wirkung, und je näher die Kamera dem Körper kommt, desto „klinischer“ diagnostiziert der Blick die verschiedenen Verletzungen, wie es Robert Nelson beschreibt: „This gruesome ornament is almost hypnotic, as the rhythms of the dance tense and relax the stomach. As the camera concentrates on the torso, your gaze becomes disturbingly clinical, for you notice that the hula hoop is made from barbed wire and etches nasty weals into the flesh.”[2] Das Video hält die selbstzerstörerische Dynamik fest, die jenseits des Täter-Opfer-Schemas an uns persönlich appelliert. Es ist ein kaum zu ertragendes Bild für die Permanenz der Selbst-Verletzungen, der immer Verletzungen durch andere vorausgegangen sind.
Es gibt auch eine unmittelbar religiöse Assoziation, wie Guillaume Désanges bemerkt: „The immediate reference that marks the viewer is to religion. The powerful image of a naked Sigalit Landau doing the hula-hoop with a piece of barbed wire on an Israeli beach refers to the sacrificial practices dating back to the origins of religions: rituals, stigmata, propitiations, indelible markings.”[3] Die Performance verweist uns aber nicht nur in eine lange religiöse sondern auch in eine ästhetische Tradition der Darstellung körperlicher Malträtierung. So kontrastieren Künstler der Renaissance in ihren Märtyrer-Bildern und in Darstellungen der Geißelung Christi die Schönheit des unversehrten Körpers mit der Brachialität von Folterwerkzeugen. „Barbed Hula“ erscheint fast wie ein herausgeschnittenes Detail, wenn man sich etwa die Geißelungsszene aus dem Bronzerelief in der Tür des Baptisteriums in Florenz von Lorenzo Ghiberti (1403-24) anschaut oder die gleiche Szene von Albrecht Altdorfer, gemalt gut hundert Jahre später für den Sebastiansaltar (1518). Immer posiert der Gequälte ‚gekonnt’ vor dem Auge des Betrachters wie der Heilige Sebastian von Antonio da Messina (1576), und beweist nicht zuletzt die Virtuosität des Künstlers. Die Darstellungen werden bestimmt durch einen ornamentalen Gesamtrahmen, eine architektonische Binnenkulisse, durch detailliert gezeigte Verletzungen und den subtilen Einsatz von Symmetrien und Asymmetrien. Alles ‚dient’ dazu, die erotische Ausstrahlung des Körpers zu steigern. Landaus Arbeit ist auch ein Beispiel, diese Prozesse der In-Szenierung so zeitgenössisch zu reformulieren, dass sie der Erfahrung wieder zugänglich werden. Obwohl Landau die Szene nicht erzählerisch einbindet, setzt sie doch auch einen neuen –säkularen – Akzent, indem sie die Opferthematik auf die Bewegung eines Spiels herunterbricht, das schon im Altertum als Mittel zur Förderung der Geschicklichkeit erwähnt wird. So lenkt sie unseren Blick auf die grenzgängerische Haltung selbst, auf den Moment, in dem unser kulturelles „Spiel“ in Gewalt umschlägt. Sie beharrt darauf, dass wir diese Grenze betrachten. Indem in ihrem Video jeder Bezug auf eine Opfer ‚begründende’ Instanz fehlt, zeigt es, wie sich der (moderne) Mensch in einer Art schmerzinduzierten Trance bewegt. Vor dem Hintergrund der politischen Gegenwart im Nahen Osten wird die Performance zu einem schmerzvollen Statement gegen die nicht enden wollenden Verletzungen zwischen Israelis und Palästinensern. Der Stacheldraht steht symbolisch für jede Form der kulturellen Demarkation, der aus- und einschließenden Grenzziehungen, die Schutz und Unterdrückung gleichermaßen bedeuten, und er ist ein Metonym der militärischen wie zivilen Inbesitznahme von Land, wie Désanges schreibt: „ ... the barbed wire is symbolic of the two-way movement (or even the two-edged sword) produced by any setting of geographical boundaries: a figure of both protection and repression (the meadow, the asylum, but also the check-point or the concentration camp). Barbed wire is a metonymy for territorial appropriation, rallying the military and civilians, protect and surrounds while also injuring.”[4] Dabei kontrastiert Landau die von Menschen gezogene Markierung, den Stacheldraht, mit der natürlichen Grenze des Wassers. „Shot in a desert area south of Tel-Aviv, Sigalit Landau’s film thus contrasts the degrading violence of the cultural demarcation line (the one artificially modelled by man) with the natural frontier represented by the sea.”[5] „Barbed Hula“ ist, so Désanges weiter, die Demonstration eines gefährlichen Tanzes des Widerstands in einem immer enger werdenden Spiel-Raum des politischen und sozialen Miteinanders. „In a dangerous dance that leaves its marks, Sigalit Landau demonstrates a moving resistance to oppression, contriving to play with the last vital perimeter left by an astringent political and social space that is a direct threat to the physical integrity of its subjects.”[6] The CountrySigalit Landau wurde 1969 in Jerusalem geboren und lebt heute in Tel Aviv. Sie gehört zu den international erfolgreichsten Künstlerinnen Israels. Mit Yossi Breger und Miriam Cabessa vertrat sie 1997 ihr Land auf der Biennale in Venedig. Ihre Arbeiten waren unter anderem bei Contemporary Fine Art in Berlin, in der Armory Show in New York und im Museum der Reina Sofia in Madrid zu sehen. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien, darunter den Israeli Art Prize der Nathan Gottesdiener Foundation (2004) und das von Anselm Kiefer initiierte Ingeborg Bachmann Stipendium (1998). Die Kunst von Landau besteht darin, dass sie Schmerzvolles und Erhabenes, Elend und Grazie, Naturalismus und das Chaos der Moderne auf lustvolle Art und Weise mischt, wie es Désanges ausdrückt: „Sigalit Landau enjoys mixing the painful and the sublime, the graceful and the sordid, naturalism and modernist chaos.” So werden Schnittstellen sichtbar, die jede Form des Dualismus souverän unterlaufen. International bekannt wurde sie durch ihre Arbeit “The Country”, die zuletzt 2004 im Rahmen der Ausstellung "Attack" in der Kunsthalle Wien gezeigt wurde. Es ist eine hochkomplexe metaphorische Installation über das Leben nach einer Katastrophe. Sie zeigt die beklemmende Szenerie einer gehäuteten und traumatisierten Gesellschaft, die in einer mutierten Umwelt gleichwohl versucht, zivilisiert dem Alltag nachzugehen. Philip Leider spricht “The Country” eine ähnliche Bedeutung wie Picassos "Guernica" zu. Es sei „a work of endless lamentation“, "summing up the nation's pervasively bleak mood”.[7] „The Country“ zeichnet vielleicht auch das Bild einer postzivilisatorischen Gesellschaft, in der sich die Frage nach einer kulturellen oder religiösen Begründung von Solidarität erübrigt. Die solidarische Praxis wird dort umgekehrt zur Frage nach der Bedeutung von Kultur. Re-InkarnationDie Kunst von Sigalit Landau ist eine Form der ästhetischen Einfühlung in das Wesen menschlicher Strukturen und deren Dynamik. Es ist eine Kunst der Verkörperung oder besser der Einkörperung – in einem unmittelbaren Sinne: indem sie ihren eigenen Körper einsetzt und in einem übertragenen Sinne, indem sie den Körper als das Nichtverfügbare thematisiert. In ihren Perfomances und Installationen geht es um das Aufzeigen elementarer Gesten unseres In-derWelt-Seins, um unsere Aus-Richtungen. In dieser Suche nach Halt und dem permanenten Verlust an Orientierung, bilden sich nach Landau bestimmte Haltungen aus. “A female body (mine) struggles softly to balance and remain vertical on top of a watermelon a few metres lower than the lowest place on earth…in the salt-saturated waters of the Dead Sea. The Dead Sea has never been filmed from under its waters. Preserved in this substance … the watermelon gravitates upwards to overthrow the figure and bounce to the surface of the water. Sinking is impossible due to the density of the waters…” So beschreibt Sigalit Landau ihre Performance mit dem Titel “Standing on a water melon in the Dead Sea” aus dem Jahr 2005. Die professionelle Tänzerin balanciert im Toten Meer auf einer Wassermelone. Es ist aber keine gewöhnliche Melone, sondern eine Züchtung, die mit extrem salzgesättigten Wasser wächst. Ein Effekt des Salzes ist der, dass die Früchte roter und süßer als gewöhnliche Melonen sind.
Impaired VisionIn nahezu jedem Versuch, die (begrenzte) menschliche Erkenntnisfähigkeit religiös, philosophisch, naturwissenschaftlich oder kulturell zu beschreiben, spielt Licht und damit die Sehfähigkeit des Auges eine zentrale Rolle. In der ägyptischen Mythologie symbolisiert das Falken-Auge die Sonnengottheit Re, die Philosophie der Antike setzt Licht mit Wahrheit gleich, und in der Darstellung der christlichen Trinität repräsentiert das in ein Dreieck eingefügte Auge die Person Gottvaters, um nur einige Beispiele aufzuzählen. Dieser transkulturellen Lichtmetaphorik korrespondiert eine Geschichte des Zweifelns an der Wahr-Nehmungsfähigkeit des Auges – ist nicht gerade das Sehen für unsere „falsche“ Sicht der Wirklichkeit verantwortlich? An einer der Schnittstellen dieser Perspektiven steht der berühmte Kommentar, den Heinrich von Kleist zu Caspar David Friedrichs Bild „Der Mönch am Meer“ 1810 in den Berliner Abendblättern veröffentlichte:
Kleist beschreibt hier, wie die Wahrnehmung der Unbegrenztheit von Natur durch die ästhetische Erfahrung der Souveränität des Bildes gebrochen wird. Die darin erfahrene Freiheit wirft ihn auf sich selbst zurück – genauer auf seinen eigenen, durch nichts mehr eingeschränkten freien Blick – und wird so von Kleist als „unbehaglich“ und „traurig“, ja grausam schmerzhaft und doch unmittelbar wahrhaftig empfunden. Christian Begemann schreibt: „Dieser unzugängliche, in vielem rätselhafte Text ist von erheblicher Signifikanz für eine Geschichte der Wahrnehmung. Friedrichs Gemälde nämlich hat seine Betrachter offenbar dazu herausgefordert, die Stellung des Subjekts in der Weite des Raums sowie deren künstlerische Darstellung zu reflektieren [...]“. [9] In Kleists Reflexionen geht es nicht zuletzt um die Ambivalenzen des Sehens. Was beinhaltet die ‚menschlich’ gebrochene Sicht der Wirklichkeit? Was bedeutet es, den Blick auf etwas zu richten oder die Augen vor etwas zu verschließen? Was sehen wir mit unserem äußeren und was mit unserem ‚inneren’ Auge? Was unterscheidet Empfindung und Erfahrung? Das Video „Eye Drum“ von Sigalit Landau und Daniel Landau aus dem Jahr 2003 zeigt nahe herangezoomt ein rechtes Auge. Geblendet von rhythmisch aufflackerndem Neonröhrenlicht beginnt es zu blinzeln und den Blick zu wenden. In Abständen dreht sich an Stelle des Augapfels eine Stiftwalze im Augenlid, während Töne einer Spieluhr zu hören sind. Auch wenn das Auge in diesen Momenten sichtlich erblindet, ist es, als lägen die eigentlichen Verletzungen in den vorab wahrgenommenen Blendungen oder Erschütterungen. Es ist, als würde die sich im Auge drehende Walze das Gesehene ‚verarbeiten’ und so lediglich das äußere Erleben, nicht aber die innere Wahrnehmung ‚ausblenden’. In diesen Momenten der Introspektion ‚hören’ wir eine ‚Melodie’. Das Auge ‚klingt’. Nach Landau hat unser Sehen also eine natürliche reflexartige, eine mechanische und eine Neues generierende, wenn man so will zwischen den Sinnen übersetzende Seite. Für die Verbindung aus Mechanik und Kreativität steht die Technik der Stiftwalze, zu der es im Lexikon heißt: „Angefangen von Spieldosen über Flötenuhren bis hin zu komplexen Musikautomaten werden langsam drehende, mit Stiften versehen Walzen verwendet, um die abzuspielenden Töne im zeitlichen Ablauf festzulegen. Die Stiftwalze stellt somit einen Informationsträger dar, eine Programmrepräsentation.“ Die Tätigkeit des Sehens wird so im Sinne einer antiken „téchne“ dargestellt, als Fähigkeit, Kunstfertigkeit und Handwerk in einem. Landau findet ein komplexes Bild dafür, dass das Sehen für unser (Über-)Leben und für die Art uns zu sehen, d.h. zu verwirklichen, von Bedeutung ist. Sehend strukturieren und rhythmisieren wir Wirklichkeit, und umgekehrt prägt – wenn man will – „programmiert“ das Gesehene unsere „Lebensmelodie“. Wie sich die Übersetzungen von Außen nach Innen, von Gesehenem in Empfundenes vollziehen und was die Sinne untereinander verbindet, bleibt dabei offen. Sehen und Hören erscheinen als geheimnisvoll zusammen-spielende Sinne. Im Video gibt es drei Perspektiven: Die Sicht auf das blinzelnde Auge, auf das von der Walze bewegte Auge und auf die Deckenröhren, man nimmt also abwechselnd die Sicht der Kamera, den Blick des Auges oder die dazwischen geschobene ästhetisch reflektierende Sicht ein. Ein Vor-Bild des Videos könnte man in dem Stummfilm „Film“ (1965) von Samuel Beckett sehen, der die existentielle Dimension des Blicks zum Thema hat und den man sicher auch als Reflexion zu Jean-Paul Sartres Nachdenken über den Blick verstehen kann. Sartre beschreibt in seinem Buch „Das Sein und das Nichts“, wie die Erfahrung des Gesehen-Werdens uns mit der Freiheit des Anderen konfrontiert: „Jeder auf mich gerichtete Blick manifestiert sich in Verbindung mit dem Erscheinen einer sinnlichen Gestalt in unserem Wahrnehmungsfeld. Aber im Gegensatz zu dem, was man glauben könnte, ist er an keine bestimmte Gestalt gebunden. Was am häufigsten einen Blick manifestiert, ist sicher das Sich-richten zweier Augäpfel auf mich. Aber er ist eben so gut anlässlich eines Raschelns von Zweigen, eines von Stille gefolgten Geräuschs von Schritten, eines halboffenen Fensterladens, der leichten Bewegung eines Vorhangs gegeben [...] Wir können nicht die Welt wahrnehmen und gleichzeitig einen auf uns fixierten Blick erfassen; es muss entweder das eine oder das andere sein. [...] Der Blick, den die Augen manifestieren, von welcher Art sie auch sein mögen, ist reiner Verweis auf mich selbst. Was ich unmittelbar erfasse, wenn ich die Zweige hinter mir knacken höre, ist nicht, dass jemand da ist, sondern, dass ich verletzt bin, dass ich einen Körper habe, der verwundet werden kann, dass ich einen Platz einnehme und dass ich in keinem Fall aus dem Raum entkommen kann, wo ich wehrlos bin, kurz, dass ich gesehen werde.“[10] Der Stummfilm „Film“ beginnt und endet wie „Eye Drum“ mit der Großaufnahme eines Auges. Es erweist sich im Laufe des Films als das Auge eines Mannes, der versucht, dem Blick durch andere zu entfliehen. Die Kamera folgt dem Mann in eine Straße, in ein Haus, schließlich in ein Zimmer. Aber selbst dort sieht sich der Mann den Blicken – denen einer Katze, eines Goldfisches, dem eigenen Spiegelbild und einem Porträt an der Wand ausgeliefert. Nachdem er alles aus dem Zimmer entfernt bzw. verhängt hat und Fotos seines vergangenen Lebens zerrissen hat, kommt er im Sessel zur Ruhe. Doch er findet keinen Schlaf und schreckt auf, als an der leeren Wand sein Alter Ego erscheint, das ihn – wie man nun versteht – während des ganzen Films verfolgt hat. Während Beckett eine Parabel des Blicks erzählt, entfaltet Landau eine Phänomenologie des Sehens. Anders als in “Film” von Beckett verzichtet sie auf eine Erzählung und konzentriert sich auf eine rein formale Darstellung. So geht es in „Eye Drum“ weniger um die Frage nach dem Sinn unserer Existenz als eher um die Verletzbarkeit unserer Sinne. Das Auge ist dort keine Metapher für den schmerzhaften Prozess der Selbstbegegnung, sondern das hochempfindliche Organ unserer Sehfähigkeit. Nicht nur was, sondern ebenso wie wir sehen, ist für unsere Sicht der Dinge von Bedeutung. Das Auge steht für die Aktion und das ‚Erleiden’ von Wahrnehmung. Es ist dabei zweierlei: der reale Ort dieses Geschehens und der Ort, wo das Geschehen Erfahrungen zeitigt. Die Arbeit Eye Drum von Sigalit und Daniel Landau wird im Rahmen der Ausstellung VISION | AUDITION vom 17. Juni bis zum 23. September 2007 in der Martinskirche in Kassel gezeigt. Anmerkungen[1] Blake Gopnik, "Silueta” of A Woman: Sizing Up Ana Mendieta, Washington Post 17.10.2004. [2] Robert Nelson, Don't try this at home, The Age 15.10.2003 [3] Guillaume Désanges, Sigalit Landau. Barbed Hula, 2003. [4] Ebd. [5] Ebd. [6] Ebd. [7] Philip Leider, Israel's "Guernica": a complex, metaphorical installation by Sigalit Landau, Art in America, May, 2003. [8] Heinrich von Kleist/Clemens Brentano, Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft, Berliner Abendblätter 13. Oktober 1810, zitiert nach: Christian Begemann: Brentano und Kleist vor Friedrichs Mönch am Meer. Aspekte eines Umbruchs in der Geschichte der Wahrnehmung. In: Goethezeitportal 17.02.2006. [9] Ebd. [10] Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nicht, 1943. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/47/kw54.htm |
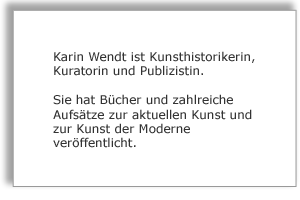 An einem verlassenen Strand schreiben zwei Frauen in purpurnen Gewändern Tanzbewegungen in den nassen Sand. In der Performance „Phoenician Sand Dance“ (2004) nähert sich die israelische Künstlerin Sigalit Landau der eigenen Kultur-Landschaft an der östlichen Mittelmeerküste im Süden von Tel Aviv, indem sie in einem rituellen Tanz das alte Phönizien intuiert. Noch heute findet man dort Schalenreste der Purpurschnecken, die dem Land, das seine Bewohner selbst Kanaan nannten, seinen griechischen Namen „Phoinike“ („Purpurland“) gaben. Poietisch vergegenwärtigt Landau das Sammeln der Schnecken, die Vielfalt der Farbabstufungen der leuchtenden Purpurfärbung, die phönizische (Färber-)Kultur. Mit den von Händen und Füßen gezogenen Linien, die das Meer immer wieder wegspült, entsteht ein bewegtes Bild für das Entstehen und Verschwinden dieser Kultur, die 63 v. Chr. zur römischen Provinz Syrien erklärt wurde. Die Gegenläufigkeit der Tanzbewegungen verweist indirekt auf den nachfolgenden imperalen Gebrauch der Kulturtechnik durch die neuen Herrscher. Allein der König durfte eine ganz in Purpur getönte Toga tragen.
An einem verlassenen Strand schreiben zwei Frauen in purpurnen Gewändern Tanzbewegungen in den nassen Sand. In der Performance „Phoenician Sand Dance“ (2004) nähert sich die israelische Künstlerin Sigalit Landau der eigenen Kultur-Landschaft an der östlichen Mittelmeerküste im Süden von Tel Aviv, indem sie in einem rituellen Tanz das alte Phönizien intuiert. Noch heute findet man dort Schalenreste der Purpurschnecken, die dem Land, das seine Bewohner selbst Kanaan nannten, seinen griechischen Namen „Phoinike“ („Purpurland“) gaben. Poietisch vergegenwärtigt Landau das Sammeln der Schnecken, die Vielfalt der Farbabstufungen der leuchtenden Purpurfärbung, die phönizische (Färber-)Kultur. Mit den von Händen und Füßen gezogenen Linien, die das Meer immer wieder wegspült, entsteht ein bewegtes Bild für das Entstehen und Verschwinden dieser Kultur, die 63 v. Chr. zur römischen Provinz Syrien erklärt wurde. Die Gegenläufigkeit der Tanzbewegungen verweist indirekt auf den nachfolgenden imperalen Gebrauch der Kulturtechnik durch die neuen Herrscher. Allein der König durfte eine ganz in Purpur getönte Toga tragen.
 Die frühe Kreuzes-Ikonographie zeigt Christus aufrecht mit geöffneten Augen als jemanden, der über den Tod ‚triumphiert’. Eines der ältesten italienischen Beispiele ist der Christus Triumphans auf einer sienesischen Holztafel von 1190, die sich heute in der Pinakothek in Pisa befindet. Die Umkehrung der zeitlichen Logik entgegen der natürlichen Gesetzmäßigkeit kommt zum Ausdruck in der scheinbar außer Kraft gesetzten Schwerkraft des Körpers. Landaus Video re-inkarniert diese Haltung der Schwerelosigkeit – allerdings ist es ein temporäres Experiment und basiert auf wissenschaftlichen Voraussetzungen.
Die frühe Kreuzes-Ikonographie zeigt Christus aufrecht mit geöffneten Augen als jemanden, der über den Tod ‚triumphiert’. Eines der ältesten italienischen Beispiele ist der Christus Triumphans auf einer sienesischen Holztafel von 1190, die sich heute in der Pinakothek in Pisa befindet. Die Umkehrung der zeitlichen Logik entgegen der natürlichen Gesetzmäßigkeit kommt zum Ausdruck in der scheinbar außer Kraft gesetzten Schwerkraft des Körpers. Landaus Video re-inkarniert diese Haltung der Schwerelosigkeit – allerdings ist es ein temporäres Experiment und basiert auf wissenschaftlichen Voraussetzungen. „Herrlich ist es, in einer unendlichen Einsamkeit am Meeresufer, unter trübem Himmel, auf eine unbegrenzte Wasserwüste, hinauszuschauen. Dazu gehört gleichwohl, dass man dahin gegangen sei, dass man zurück muss, dass man hinüber möchte, dass man es nicht kann, dass man alles zum Leben vermisst, und die Stimme des Lebens dennoch im Rauschen der Flut, im Wehen der Luft, im Ziehen der Wolken, dem einsamen Geschrei der Vögel, vernimmt. Dazu gehört ein Anspruch, den das Herz macht, und ein Abbruch, um mich so auszudrücken, den einem die Natur tut. Dies aber ist vor dem Bilde unmöglich, und das, was ich in dem Bilde selbst finden sollte, fand ich erst zwischen mir und dem Bilde, nämlich einen Anspruch, den mein Herz an das Bild machte, und einen Abbruch, den mir das Bild tat; und so ward ich selbst der Kapuziner, das Bild ward die Düne, das aber, wo hinaus ich mit Sehnsucht blicken sollte, die See, fehlte ganz. Nichts kann trauriger und unbehaglicher sein, als diese Stellung in der Welt: der einzige Lebensfunke im weiten Reiche des Todes, der einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis. Das Bild liegt, mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen, wie die Apokalypse da, […] und da es, in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit, nichts als den Rahm zum Vordergrund hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als obEinem die Augenlider weggeschnitten wären.“[8]
„Herrlich ist es, in einer unendlichen Einsamkeit am Meeresufer, unter trübem Himmel, auf eine unbegrenzte Wasserwüste, hinauszuschauen. Dazu gehört gleichwohl, dass man dahin gegangen sei, dass man zurück muss, dass man hinüber möchte, dass man es nicht kann, dass man alles zum Leben vermisst, und die Stimme des Lebens dennoch im Rauschen der Flut, im Wehen der Luft, im Ziehen der Wolken, dem einsamen Geschrei der Vögel, vernimmt. Dazu gehört ein Anspruch, den das Herz macht, und ein Abbruch, um mich so auszudrücken, den einem die Natur tut. Dies aber ist vor dem Bilde unmöglich, und das, was ich in dem Bilde selbst finden sollte, fand ich erst zwischen mir und dem Bilde, nämlich einen Anspruch, den mein Herz an das Bild machte, und einen Abbruch, den mir das Bild tat; und so ward ich selbst der Kapuziner, das Bild ward die Düne, das aber, wo hinaus ich mit Sehnsucht blicken sollte, die See, fehlte ganz. Nichts kann trauriger und unbehaglicher sein, als diese Stellung in der Welt: der einzige Lebensfunke im weiten Reiche des Todes, der einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis. Das Bild liegt, mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen, wie die Apokalypse da, […] und da es, in seiner Einförmigkeit und Uferlosigkeit, nichts als den Rahm zum Vordergrund hat, so ist es, wenn man es betrachtet, als obEinem die Augenlider weggeschnitten wären.“[8]