
Film-Lektüren |
Die Wahrheit der KunstKünstler fragen nach dem Ort der LügeKarin Wendt
 In der Ausstellung "Lügen.nirgends – Zwischen Fiktion, Wirklichkeit und Dokumentation", die noch bis zum 30. März 2008 in der AZKM in Münster zu sehen ist, zeigen Gail Kirkpatrick und zwei Gastkuratorinnen, Susanne Düchting und Julia Wirxel, Arbeiten von Künstlern, die sich in unterschiedlichen Medien mit dem Thema auseinandersetzen. Entstanden ist eine Zusammenschau, die weit mehr ist als eine medienkritische Zwischenbilanz. Im Text zur Ausstellung heißt es: "Wie keinem anderen Medium ist es der Kunst möglich, Ambivalenzen ästhetisch greifbar zu machen und reflexive Schwebezustände zu erzeugen, die den Erkenntnisprozess immer wieder neu befruchten. Am Ende stellt sich der Besucher die Frage: Was heißt es eigentlich, eine wahre Geschichte zu erzählen? Welche Rolle spielen Fakten und Fiktionen, Wahrheit und Täuschung? Welche Aufgabe hat die erzählte Geschichte innerhalb dieser rhetorischen Versuche? Die Künstler warnen davor, Augenscheinliches für wahr zu halten und sensibilisieren für die emotionalen, fiktionalen und dokumentarischen Strategien, die bei der Konstruktion von Wirklichkeit zum Einsatz kommen." ErinnerungDas Video „Spielberg’s List“ (2003) von Omer Fast (*1972) zeigt Aufnahmen des für den Film „Schindlers Liste“ nachgebauten und bis heute touristisch genutzten Konzentrationslagers Plazow und verknüpft diese mit Bildern vom tatsächlichen Lager in der Nähe von Krakau. Dazwischen sind Interviews in der Art von historischen Dokumentationen mit Zeitzeugen geblendet. Fast hat jedoch nicht Überlebende des Holocaust interviewt, sondern Laiendarsteller, die als Statisten in dem Film mitgewirkt haben. „Während die Laiendarsteller von ihren Erlebnissen erzählen, beginnt man sich zu fragen, ob sie ihre Erinnerungen an die Filmaufnahmen schildern oder ob ihre Berichte nicht doch die Ereignisse widerspiegeln, die vor über 60 Jahren stattgefunden haben.“ Unsere Erinnerung ist nie nur nach hinten gerichtet. Sie greift auch in einem konstruierenden Sinn nach vorne aus. Doch wie hängen unsere persönliche Erinnerung mit der historischen Erinnerung zusammen? Können wir zwischen dem, was wir selbst erfahren haben und dem, was unsere historische Erfahrung ausmacht, unterscheiden? Wie geht eine Kultur mit ihren negativen Erfahrungen um? Jörn Rüsen schreibt zur Geschichtskultur im Umgang mit negativen Erfahrungen: „Es gibt historische Erfahrungen, deren Bewältigung ungeheure Schwierigkeiten bereitet. Das ist immer dann der Fall, wenn diese Erfahrungen Elemente des Traumatischen aufweisen. [...] Wenn man den Charakter des Traumatischen mit der Eigenschaft identifiziert, dass das, was geschehen ist und erfahren wird, jeden Sinn, der über es gebildet werden muss, zerstört, dann liegt es im Wesen des Traumatischen, sich einer deutenden Bewältigung grundsätzlich zu entziehen. Das ist aber im Bereich der historischen Erfahrungen letztlich nicht möglich. Denn es sind ja eben solche sperrigen Inhalte der historischen Erfahrung, die nach Deutung geradezu schreien. Eine mögliche Antwort auf diese Herausforderung besteht darin, Trauern als kognitive Strategie des Umgangs mit negativer historischer Erfahrung zu thematisieren.“[1] Die Arbeit von Omar Fast lässt Zweifel daran, ob historische Trauerarbeit jenseits der Moralität, eine „Geschichtskultur der Vergebung“ (J. Rüsen) also, gelingen kann. Sie zeigt dagegen sehr präzise, wie wir uns der negativen Erfahrung unaufhörlich so entziehen, dass an ihrer Stelle etwas anderes erscheint und uns bewegt. AufklärungDie Installation „Demmin“ (2007) des Journalisten und künstlerischen Fotografen Sven Johne (*1976) zeigt fünf in Hellgrau auf weißen Grund gedruckte Landkarten. Unzählige kleine Stecknadeln markieren die Ufer eines Flusses. Was ist das für eine Landschaft? Um welches Gebiet handelt es sich? Was wird dort markiert und warum? Der historische Hintergrund der Arbeit erschließt sich, wenn man die den Landkarten hinzugefügten Texte liest: eine sachliche Schilderung und ein Augenzeugenbericht. Über sie erfährt man, dass die „Die Stadt Demmin [...] am Ende des Zweiten Weltkriegs der Roten Armee kampflos übergeben [wurde]. Dennoch ereignete sich hier die größte bekannte Massenselbsttötung der deutschen Geschichte. Ihren Höhepunkt erreichte die Suizidwelle nach den Feierlichkeiten der Soldaten am 1. Mai 1945. 1.200 Menschen kamen in den Flüssen Peene, Trebel und Tollense ums Leben.“ Johnes Arbeit ist der Versuch, gegen Tabuisierungen und Vergessen (neue) Spuren zu legen. Die Installation, die hier erstmals in einem Rahmen einer Museumsausstellung gezeigt wird, entfaltet weiter reichende Überlegungen zur Beweislast der Bilder. Dass die Dokumentation von Katastrophen längst eine eigene Ästhetik entwickelt hat, die für die Authentizität des gezeigten Materials einsteht, zeigt die Arbeit „Ship Cancellation“ (2007) Nur auf den ersten Blick illustriert die Fotografie die beigefügten Texte. Johne behandelt die Beschreibung des Schiffs, die Schilderung der Katastrophe, den Bericht eines Augenzeugen und die Aufnahme vom Schiff wie Fundstücke einer Dokumentationspraxis, die er einer erneuten eigenen Gestaltung unterwirft. So entsteht eine grafisch durchstrukturierte Foto-Text-Collage aus den für eine Dokumentation verwendeten ‚Bestandteilen’, bei denen Johne offen lässt, ob sie nicht vielleicht sämtlich frei erfunden oder doch Teile einer „echten Story“ sind. Unsere Aufmerksamkeit wird auf die Mittel der Gestaltung und die Beliebigkeit des Gegenstandes gelenkt. Worin besteht unser Interesse an Darstellungen historischer Gewalt und Katastrophen? Nach Johne ist es das Moment der ästhetischen Distanzierung, die Beherrschung der Mittel, nicht zuletzt die Wiederholung des Geschehens in der Darstellung, die als Bewältigungsstrategien fungieren, während das Interesse an einer tatsächlichen Aufklärung zweitrangig ist. AutobiografieBarbara Steiner und Jun Yang schreiben zum Begriff der Autobiografie: „Das Genre der Autobiografie war immer ein Schmelztiegel für unterschiedliche Formen und Modi des Erzählens über das eigene Leben, selbst wenn das Subjektverständnis sich im Laufe der Jahre verändert hat. [...] ‚Autobiografie’ ist als variabler und anpassungsfähiger Terminus zu begreifen, der die Gattung sowohl umfasst als auch überschreitet [...].“[2] Die Kunst von Sophie Calle zeigt, was es heißt, dass das Leben mehr ist als die Lebensgeschichte eines Menschen, dass wir aber unser Verstehen und Urteilen von eben dieser Geschichte abhängig machen. Indem Calle ihr „Leben“ zur Kunst erklärt, eigene Erlebnisse und Ereignisse Geschichten einbindet, die sie über verschiedene Medien dokumentiert, „fungiert ihre Biografie als eine Schnittstelle, an der die ihr Leben betreffenden Vorstellungen und Projektionen verschiedener Menschen zusammenlaufen.“[3] Die Ausstellung zeigt von Calle drei s/w-Fotografien, kombiniert mit Texten, aus ihrem 1988 begonnenen Werkkomplex „Wahre Geschichten“: La Dispute (1992), das Zeugnis einer gescheiterten Beziehung, „Saw Nobody-Nothing“ (2001), ein Porträt von zwei älteren Personen, die eine gemeinsame Geschichte teilen, und „Torero“ (2003), ‚Beweismittel’ für den Tod eines Toreros, mit dem die Künstlerin angeblich eine Affaire verband. Barbara Heinrich erläutert die Besonderheit der Kunst von Sophie Calle so: „Die Qualität ihrer Arbeiten besteht in der direkten Art der formalen Ansätze, in ihren erzählerischen Fähigkeiten, in der begrifflichen Bereicherung, die das Werk im Laufe seiner Entstehung erfährt und in der Kraft der Projekte, den Betrachter mit seinen Möglichkeiten und Erfahrungen mit einzubeziehen. Die Arbeiten sind kraftvoll und überzeugend gerade aufgrund der Ungewissheit, die in ihnen zum Ausdruck kommt. Ungewissheit ist fast immer störend; sie ist ineffizient, unproduktiv und oft sogar gefährlich. Der hybride Charakter dieser Werke widersetzt sich jeder Klassifizierung, wie das Leben selbst.“[4] „Ne me quitte pas“ (2001) von Mathilde ter Heijne (*1969) ist eine andere Form der künstlerischen Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Hier geht es stärker um das Moment der Wiedererkennbarkeit, um die Fiktionalität des Ich, um Grenzen und Durchlässigkeit. Die Installation zeigt das Double der Künstlerin in Gestalt einer lebensgroßen Puppe auf einem Stuhl am Fenster in der Ausstellungshalle sitzend, neben sich ein Radio, aus dem ein Liebeslied zu hören ist. Die gleiche Puppe ist in dem Video „Mathilde, Mathilde, Mathilde“ zu sehen, das auf das Schicksal dreier Heldinnen in französischen Liebesfilmen Bezug nimmt. Alle enden mit dem Selbstmord der Protagonistinnen. Ter Heijnes Video stellt die letzte Szene mit ihrem Dummy nach. Anstelle des Freitods wirft die Künstlerin jedoch die Puppe über die Brücke. Ter Heijnes Arbeit zeigt die Schwierigkeit, sich selbst und sein Leben zu beschreiben. Das Bild, das ich von mir habe, ist zusammengesetzt aus Bildern, die (sich) andere von mir machen, aus Bildern, in denen ich mich wiederkenne und Bildern, mit denen ich mich (nicht) identifizieren will. Die Installation „ne me quitte pas“ ist eine Form der spielerischen Autobiografie, in der das Spiel mit den Rollen als Gewalt von außen und als willentlicher Prozess der Suche nach sich selbst erkennbar wird, mithin als Mittel zur Selbsterforschung wie -verstellung. Das Kunstwerk lässt offen, wer wen nicht verlassen soll – der Geliebte die tragische Heldin oder umgekehrt? Die Puppe die Künstlerin oder umgekehrt? In dem Langzeit-Projekt „Fake Female Artist Life (F.F.A.L.)“ (seit 2006) ist das Leben von Künstlerinnen der Ausgangspunkt für die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Leben. Indem die Künstlerin Ter Heijne jeder Nachbildung einer Künstlerin auch die eigene Physiognomie einprägt, beginnt auch hier die Trennung zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, zwischen autobiografischer und künstlerischer Darstellung, unscharf zu werden. SchönheitDas Video „Living a Beautiful Life“ (2003) von Corinna Schnitt (*1964) zeichnet das Porträt einer erfolgreichen amerikanischen Familie. Mann und Frau haben Karriere gemacht, zwei ‚gelungene’ Kinder, einen Hund und viele Freunde. Es dauert eine Weile, bis man an der Authentizität zweifelt. Bald wird aber klar, die Künstlerin hat Schauspieler engagiert und im Rückgriff eine US-Umfrage unter Jugendlichen Monologe geschrieben, die das wiedergeben, was wir uns unter einem schönen Leben vorstellen. Kolja Barbara Kunt schreibt über die Arbeit von Corinna Schnitt: „In ihren Filmen und Fotografien erzählt Corinna Schnitt mit scharfer Ironie Geschichten, die um banale, bisweilen ins Absurde gesteigerte Alltagssituationen kreisen. Klischee- und Wertevorstellungen von Familie, Privatheit und individuellem Glück werden dabei gleichermaßen bedient wie hinterfragt. Ordnung, Überschaubarkeit, Sauberkeit einerseits. Beklemmung und Zwanghaftigkeit andererseits. Mit sicherem Gespür für Bildkonstruktion und Wirkung arrangiert Corinna Schnitt ihre Bildwelten: beiläufig und banal, komisch und absurd, distanzierend und zugleich vertraut.“[6] WahrheitenDie Arbeit „Olim, eine Krankheitsgeschichte in Briefen – der Leiden erster Teil“ (2005) ist das Zeugnis eines zeitgenössischen Künstlers, in dem man eine Art Spiegelbild des Künstlers Milo Köpp (*1962) vermuten kann. Die Installation besteht aus zehn Briefen, die in einem schmalen Buch abgedruckt sind, und eine Audio-CD, auf der die Briefe vorgelesen werden. Die Briefe sind bis 11 durchnummeriert, ein Brief fehlt also. In den Briefen wendet sich der Schreiber, Olim, an einen Arzt. Er wünsche sich krank zu werden, um künstlerisch produktiv sein zu können. Köpp spielt hier auf das romantische Klischee des Genies an, dessen Leiden zu einer Sensibilität und künstlerischen Klarheit befähigen soll, die dem Gesunden fehle. Anstatt jedoch Beispiele von Künstlern oder Kunstbeschreibungen vorzustellen, die Kunst in dieser Art herleiten oder legitimieren, legt Köpp im Sinne eines Geständnisses die Selbstermächtigungsstruktur als solche offen. Die feine Ironie der Arbeit besteht nicht zuletzt darin, dass sie eine andere Erklärung künstlerischer Kreativität schuldig bleibt. Was Justus Jonas Edel in einem anderen Kontext für die Kunst von Köpp festhält, gilt auch für seine Arbeit „Olim“: „Auf hintersinnige Weise ist ... [die] rein sachliche Information Entmystifizierung und Mystifizierung des künstlerischen Tuns zugleich.“[6] Vielleicht bezieht sich Köpp mit der Umkehrung seines Vornamens „Olim“ auch auf die lateinische Bedeutung des Wortes: „einst“ und der nachfolgenden Personifizierung in der Redewendung „Seit Olims Zeiten“. So wie der Anfang nur ein Begriff dafür ist, dass etwas begonnen hat, ist etwas erst und nur im Rück-Blick ein Kunst-Werk. RealitätIm Ausstellungstext zur Arbeit ‚We Can Make Rain But No One Came To Ask’ heißt es: „Der Titel [...] klingt wie ein verschlüsselter Code. Unklar, von wem er stammt. Unklar auch, ob nicht auch der Bomben-Regen gemeint sein könnte.“ Liest man sich den begleitenden Text an der Wand durch, erfährt man von einer angeblichen Kollaboration zwischen dem staatlichen Chef-Untersucher von Autobomben-Detonationen Yussef Bitar und Georges Semerdijan, einem 1990 ermordeten Fotojournalisten und Videofilmer. Das Video zeigt Aufnahmen, Diagramme und Aufzeichnungen, die sich auf die Explosion einer Autobombe in der am 21. Januar 1986 in Beirut beziehen. Andreas Mertin schreibt über die Kunst der Atlas Group: „Die von Walid Ra'ad gegründete Stiftung [...] zur Erforschung libanesischer Gegenwartsgeschichte jongliert mit Fiktionalität und Realität, deren jeweilige Schrecken ununterscheidbar werden. [...] Populärkulturell könnte man an diverse Fernsehserien denken, die sich der scheinbaren Aufklärung mysteriöser Ereignisse gewidmet haben. Das Faszinierende der Arbeiten der Atlas Group ist es, dass Fiktionalität eine Gedächtnisspur zu legen vermag, die auch noch das reale Geschehen im Libanon inkorporiert.“[7] BilderDer Künstler Marcel van Eeden (*1965) begreift seine Kunst als Prozess einer fortwährenden Archivierung des Lebens vor dem Zeitpunkt seiner Geburt. Seit fünfzehn Jahren trägt er Bilder aus unterschiedlichsten Medien von vor 1965 zusammen, die er zum Teil mit typografischen Elementen oder Textzitaten aus literarischen Vorlagen versieht – Bildmaterial aus historischer Reiseliteratur, Atlanten, Kunstbüchern und Zeitschriften wie Life, Wereldkroniek, Paris Match, De Spiegel oder De Katholike Illustratie. „Alle Bilder sind wahr“, sagt van Eeden, „sie sind wie Lego-Bausteine, die man zu immer neuen Gebäuden zusammenfügt.“ Van Edens Kunst reflektiert auf die Ahistorizität von Bildern. Jedes Bild hat mit jedem anderen Bild zu tun und hat zugleich nichts damit zu tun. So wird die Simultaneität der Bilder zum Ausgangspunkt für eine neue, subjektive Chronologie. Besonders eindrucksvoll finde ich die Zeichnungen von Van Eeden, die unterschiedliche Kontexte, in denen uns Bilder begegnen, greifbar werden lassen, ohne dass sie einen Bild-Sinn, einen klaren Bezugsrahmen oder eine bestimmte Botschaft, ergeben. MytheDie Installation „Held Saga – Die Berghütte“ (2005) von Hans Winkler (*1955) zeigt den Nachbau einer Holzhütte, wie sie in den Bergen typisch ist, an der Wand die Fotografie eines Alpenpanoramas. Dahinter verbirgt sich jedoch eine lange Geschichte, in deren Zusammenhang die Rekonstruktion einer Berghütte auftaucht. Wir erfahren also, dass die Rekonstruktion lediglich die Rekonstruktion einer Rekonstruktion ist ...Winklers „‚Held Saga’ führt uns in die teils belegte, teils fiktive Welt des Vaters und anarchistischen Schriftstellers Franz Held, der seine Kinder in einer Berghütte bei Salzburg zurückließ. Die Replik des Kinderhauses vom Heartfield-Grundstück in Waldsieversdorf bei Berlin, das an die österreichische Berghütte erinnert, in der die Familie lebte, konfrontiert uns in der Installation ‚Die Berghütte im Wald’ mit einem realen Element der fiktionalen Familiengeschichte.“[8] [1] Jörn Rüsen: Über einige Bewegungen in der Geschichtskultur – Moral, Trauer, Verzeihung. In: F. Kurbacher/K. Novotný/K. Wendt: Aufklärungen durch Erinnerung, Würzburg 2007, S. 71. [2] Barbara Steiner/Jun Yang: Identität schreiben: Über die Autobiografie in der Kunst. In: Dies., Art Works. Zeitgenössische Kunst. Autobiografie, Hildesheim 2004, S. 15. [3] Vgl. Anm. 2, S. 90. [4] Barbara Heinrich: Die wahren Geschichten der Sophie Calle. Rituale, Text zur Ausstellung, Fridericianum, Kassel 2000 (http://www.fridericianum-kassel.de/ausst/katext.html). [5] http://www.k2film.de/heimat/?page_id=6 [6] Justus Jonas Edel: 8004,3 Millimeter Text. In: www.arche2000.net/milo : texte. [7] Andreas Mertin: Documenta11. Kunstkommentare, In: Magazin für Theologie und Ästhetik (18), https://www.theomag.de/18/ |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/52/kw60.htm |
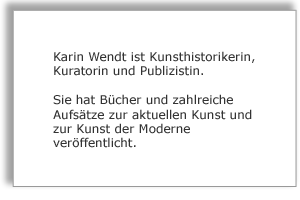 Zu lügen, würde man wohl zunächst sagen, bedeutet, die Wahrheit bewusst zu verschweigen und an ihrer Stelle etwas Unwahres zu sagen. Die Weisen, in denen wir lügen (können), sind jedoch vielfältiger; nicht erst der Begriff des Rhetorischen zeigt Wege der sprachlichen Verwirklichung auf, die Unterschiede zwischen dem, was tatsächlich gemeint ist und dem, was lediglich in diesem Sinne gesagt wird, bereits so verwischen, dass eine Entscheidung über den Wahrheitsgehalt unserer Absichten schwer fiele. Lügen, so kann man vermuten, haben sowohl an unserer Gestaltung als auch an unserer Erschließung von Wirklichkeit einen weitaus größeren Anteil als ihr Gegenteil. So wie wir unser Leben re-konstruieren, er-finden wir das, was uns im Nachhinein auf unserem Weg wie in einem Spiegel begegnet – als Wahrheit und als Lüge: Geschichte und Vergangenheit, Gewalt und Gefühle, Bilder und Mythen, das Leben.
Zu lügen, würde man wohl zunächst sagen, bedeutet, die Wahrheit bewusst zu verschweigen und an ihrer Stelle etwas Unwahres zu sagen. Die Weisen, in denen wir lügen (können), sind jedoch vielfältiger; nicht erst der Begriff des Rhetorischen zeigt Wege der sprachlichen Verwirklichung auf, die Unterschiede zwischen dem, was tatsächlich gemeint ist und dem, was lediglich in diesem Sinne gesagt wird, bereits so verwischen, dass eine Entscheidung über den Wahrheitsgehalt unserer Absichten schwer fiele. Lügen, so kann man vermuten, haben sowohl an unserer Gestaltung als auch an unserer Erschließung von Wirklichkeit einen weitaus größeren Anteil als ihr Gegenteil. So wie wir unser Leben re-konstruieren, er-finden wir das, was uns im Nachhinein auf unserem Weg wie in einem Spiegel begegnet – als Wahrheit und als Lüge: Geschichte und Vergangenheit, Gewalt und Gefühle, Bilder und Mythen, das Leben.