
Intimität |
Intimität des Abwesenden
- oder warum das Selbst nur leer und als lebendiges Verhältnis gedacht werden kann -Frauke A. Kurbacher
Sondierungen zum vieldeutigen Phänomen von Intimität
Dieses Persönlichste ist also formal gesprochen zunächst einmal leer, d.h. hier muss in einer Weise Freiheit – oder es müssen mindestens Rahmenbedingungen für eine Freiheit – gegeben sein, die eine solche individuelle Bestimmung innerhalb der kulturellen Codierungen ermöglichen. Intimität als Persönlichstes einer Person ist – in Reflexion auf diesen eingangs genannten Superlativ – eine Möglichkeit von Selbstbestimmung, und zwar eine, die darauf basiert und versucht zu fassen, was eine Person in besonderem Maße, nämlich als ‚bloß‘ eigene Kennzeichnung der eigenen Person versteht. Intimität würde so eine Art exklusiver Selbstbestimmung ausdrücken und ebenso den Anspruch auf eine solche Weise bloß eigenen Selbstverständnisses und Zugriffs. Es ist zu fragen, wofür eine solche auf Einzigartigkeit bauende und beharrende Bestimmung, die von interindividueller Bestimmung absieht, taugen könnte oder sollte und, ob solche Ausschließlichkeit Menschen überhaupt möglich ist. Hieran anschließend wäre nun einiges Andere weiter zu fragen, vor allem aber wohl die eine Frage: Es ist die zentrale Frage, ob eine solche Bestimmung des Intimen Personen konstitutiv im Sinne des Verbürgens eigener Individualität und damit Spezifität ist? Hängt eigene Individualität an Intimität, und was heißt das? Oder anders herum gefragt, was verbürgt Intimität von Individualität? Diese Fragen zeigen eine mögliche grundlegende Relevanz von Intimität im Sinne einer Individualitätsfundierung an. Es gilt im Weiteren zu prüfen, ob dies anzunehmen ist, und wenn ja, inwiefern. Wenn Intimität das Persönlichste einer Person ist, das sie sich selbst zuschreibt, dann ist zu fragen, inwieweit sich eine Person selbst kennt, kennen kann oder muss, um dies überhaupt bestimmen zu können. Oder plastischer gefragt: Wieviel Individualität oder sogar Intimität benötige ich zur eigenen Selbstbestimmung? – Und weiter gefragt: Inwiefern und wodurch habe ich Zugang zu mir, mit welchen Eröffnungen, Schwierigkeiten und Gefahren ist dabei zu rechnen? Dies alles ist nicht zuletzt auch eine von Kant und seinen Reflexionen zur Möglichkeit von „Selbsttransparenz“ bedachte Frage, die sich darüber hinaus bis hinein in freudsche Betrachtungen verfolgen lässt. Vor diesem Hintergrund des Versuchs einer formalen Bestimmung von Intimität und deren Relevanz für eine Personen konstituierende Individualität habe ich drei Zugänge gewählt. Alle drei versuchen, Intimität als Verhältnishaftigkeit kritisch zu erschließen. 1. ZugangEinen ersten Zugang zur Verhältnishaftigkeit der intimen Selbstfrage bieten in der Antike nicht zwei Antworten, sondern zwei getarnte Fragen – die eine als Imperativ, die andere als Aussage: Das delphische „Erkenne Dich selbst“ und die eigenartige Kontrastierung im Mythos des Narziß, dessen Mutter auf die Frage, ob ihr Sohn lange lebe, eigenartig erwidert bekommt, „solange er sich nicht selber sehe“ oder – je nach Übertragung des „si se non noverit“ – noch schärfer: „Wenn er sich fremd bleibt“.[1] Ein möglicher Selbstzugang ist hier offenbar in denkwürdiger Polarität zwischen Selbstsuche und Selbstmeidung ausgespannt. Caravaggio hat Narziß in enger Anlehnung an die ovidsche Überlieferung des Mythos ins Bild gebannt.
2. ZugangEigentümlich scheint dem Intimen zugleich jedoch auch eine Art der Abgeschlossenheit. Es ist die Hermetik einer zu wahrenden und zu schützenden Grenze, vor sich selbst und anderen, die eben jenen Bereich umgrenzt und umzäunt, der als das Persönlichste gelten kann, und derer in der Regel eine Person oft nur dann gewahr wird, wenn dessen Grenze überschritten ist. In dieser Hinsicht hat das Intime Ähnlichkeit mit der ganz bildlichen Vorstellung eines heiligen Bereichs wie er zum Beispiel im „hortus conclusus“, dem abgeschlossenen Garten bildnerischen oder auch gartenarchitektonischen Ausdruck findet. Wiederum in einer sprechenden Übertragung eines Liebeszusammenhangs, in diesem Fall zunächst profaner Liebesszenerien und -metaphorik, die Eingang in Salomos Hohes Lied der Liebe finden und von dort auf Marienvorstellungen als traute Zwiesprache von Braut und Bräutigam als eine zwischen Maria und Christus appliziert wiederum in der ikonologischen Tradition auch besonderen Einfluss auf das spirituelle Leben vor allem in Frauenklöstern gewinnt.
In freier Reflexion auf eine mögliche umfassende aktuelle Auffassung des Intimen kann an dieser Stelle überlegt werden, inwiefern das Intime einer Person nicht vielleicht sogar vor ihr selbst verschlossen ist, und gerade auch die Negativbestimmungen darauf hindeuten, dass es keine positive Bestimmung dieses Bereichs geben darf. Wichtig aber ist gleichwohl, dass auch der intime Bereich, der nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, und aus dieser Exklusivität seine Bestimmung erhält, gleichwohl kein einsamer Ort ist, sondern angefüllt mit all jenen paradiesischen Freuden, wie es sozusagen aus dem Ur-garten bekannt ist.[4] Der hortus conclusus als Darstellung des Intimen gelesen, ist genauso – wie es Narziß eben nicht wirklich war – verhältnishaft. In jedem dargestellten Garten aber schwingt noch jener Urgarten mit, den bereits Kant in seiner Abhandlung über den „Mutmaßliche[n] Anfang der Menschengeschichte“ als Beginn von menschlicher Kulturgeschichte gedeutet hatte.[5] Und die beginnt (bei dem Ur-Paar aller Liebespaare) mit einer Entdeckung von Intimität (als Nacktheit), einer dadurch ermöglichten Differenzierung (von Geschlechtlichkeit) und damit Sexualität und Liebe (als Beziehung und Verhältnishaftigkeit) – und dem Biss in jene Frucht, die einen überhaupt zur Erkenntnis – einem göttlichen Vermögen – befähigt. Durch die Vertreibung aus jenem Paradies kommt es leider – oder zum Glück – nicht zum zweiten Biss in die Frucht des anderen Baumes, die als zweite göttliche Gabe ‚Ewigkeit‘ und damit nicht nur langes, sondern immerwährendes Leben verheißen hätte. Der eine Baum hätte in Delphi stehen können, der andere am dunklen Quell des ovidischen Narziß. Sie befinden sich hingegen aber beide, der eine gekostet, der andere unangetastet im geschlossenen Paradiesgarten des Intimen, der den Sündenfall kennt, aber nicht beheimatet. 3. ZugangMit den letzten aufgeführten Überlegungen hat die Frage nach dem Intimen eine andere Wendung genommen. Die Frage nach möglicher eigener Selbstdurchsichtigkeit ist unversehens auch eine danach geworden, inwiefern und wo wir Zuhause sind, in die die zugleich psychologische wie alltägliche Rede vom ‚bei-sich-sein‘ ebenso inbegriffen ist wie eine philosophische von Verantwortlichkeit und ‚Selbstvergessenheit‘. Können wir in uns beheimatet sein, und wenn ja, wie – und wenn nicht, wo dann?! Eine Denkerin, die die Frage nach dem eigenen Beheimatetsein immer wieder aufgegriffen, und zugleich die nach Intimität, besonders in der Spielart von ‚Innerlichkeit‘ immer wieder scharf kritisiert hat, ist Hannah Arendt. Auch sie erörtert beides das Beheimatet-sein und Innerlichkeit u.a. im Liebeskontext. Bezüglich des Liebeskonzepts tritt eine weitere Eigenart des Intimen hervor und zugleich aber auch eine Widersprüchlichkeit in Arendts eigener Liebeskonzeption. Zunächst aber sind es zwei kritisierenswerte Eigentümlichkeiten, die in ihrer Diskussion der Paarbeziehung hervortreten und benannt werden müssen. Ihre Personenkonzeption, der es konstitutiv angehört, nicht ausdrücklich ausgeführt zu sein, impliziert eine Blindheit der eigenen Person gegenüber sich selbst. Aus ihr heraus gibt es letztlich für sie nur zwei Wege. Der eine erfolgt durch Handeln, Sprechen, Urteilen – also alle menschlichen sozialen Tätigkeiten, die wir vollziehen können. Darin zeigt sich eine Person, wird sichtbar, erscheint. Dies geschieht jedoch zunächst nicht für und vor sich selbst, sondern vor anderen, vor einer sozialen Gemeinschaft; - ein Gedanke, der Arendt in ihrer philosophisch-politischen Prägnanz des antiken polis-Gedankens sehr wichtig ist. In diesen ergriffenen Fähigkeiten drückt sich für sie Welthaftigkeit aus, die ein zentrales Moment ihres gesamten Denkens darstellt, ein konkretes in der Welt und zur Welt hin sein. Person-Sein, im individuellen Sinn eines ‚Wer-einer-ist‘, wird hingegen – und dies ist der andere Weg – in ausdrücklicher Weise nur vom Anderen in der Paarbeziehung der Liebe gesehen, der Arendt zugleich, ob dieser hervorragenden Qualität, Ausschluss von der restlichen Welt, Zweier-Isolation und damit Weltlosigkeit bescheinigt.[6] Diese scharfe Kritik gilt nicht für alle Teile ihres Werks, wie auch ihr Liebesbegriff kein eindeutiger, sondern teilweise sogar ein widersprüchlicher ist. Wie aber lässt sich dieses harsche Urteil verstehen, und wird es dem darin Erläuterten, dem Phänomen von Liebe, Welt und Innerlichkeit gerecht? Ein Blick auf Arendts Frühwerk, ihre Dissertation zum Liebesbegriff bei Augustinus, dem sie sich dezidiert philosophisch zuwendet, ist hier aufschlussreich. Verständlich wird dies vor der augustinischen Anlage von Liebe. – Liebe in der Grundauffassung von Begehren (appetitus) ist bestimmt durch das Ziel, auf das sie sich richtet. Dies ist zunächst für alle Menschen gleich, nämlich das Leben und zwar ein möglichst beständiges, ruhiges – letztlich hat jedoch kein weltliches Leben Dauer und Bestand, denn wahrhafte Dauer und wahrhafter Bestand eignen nur göttlichem ewigen Sein. Insofern kann Augustinus wahres Leben und wahres Lieben gleichsetzen. Von hier aus erfolgt eine Aufteilung der Liebe in zwei Weisen, eine Gott zugewandte Liebe, die caritas, wird zur richtigen Liebe, weil sie allein im Jenseits Bestand hat. Entsprechend wird hingegen eine weltzugewandte Liebe, die cupiditas, vor der Frage nach Dauer, Bestand und Gottesausrichtung zur unbeständigen, unruhigen, ‚falschen‘ Liebe, die bloß in die Zerstreuung führt. Aufgrund dieses Verständnisses wird alles, was an mir und auch dem Anderen dem Weltlichen zugehört, abgewehrt, abgelehnt, erfolgt eine Abwendung, die ihren prägnantesten Ausdruck in einer geforderten Selbstverleugnung findet. Die Zweiteilung von Liebe bei Augustinus in eine richtige und falsche bedeutet nun eine moralische Aufladung in eine gute und schlechte, die durchgängig als Vorstellung einer Liebesordnung, der caritas ordinata, das Liebesverständnis bis in die Neuzeit und darüber hinaus bestimmt. Liebe in ihrer Grundbestimmung als Streben verstanden, fasst Augustinus als Suchen, Selbstsuchen auf, wodurch der Liebesdiskurs mit dem Selbst- und Personendiskurs verflochten wird. Dieses Selbst aber ist nur bei Gott zu finden und wird gemäß der caritas-cupiditas-Aufteilung der Liebe in einen Dualismus von wahrem und verfehltem Selbst überführt, der seine Entsprechung in einer positiv konnotierten Weltlosigkeit und einer negativ konnotierten Welthaftigkeit findet. Dabei wird die Liebesthematik zugleich in einer Weise aufgerufen, in der ein Bestreben deutlich ist, nach Möglichkeiten zu suchen, wie das faktisch gegebene Aufeinanderangewiesensein von Menschen untereinander, sei es durch natürliche Ordnungen oder getroffene Vereinbarungen, anders zu denken ist als in Zweck-Mittel-Relationen oder Weisen des Gebrauchs. Es ist eine auch z.B. von Roland Barthes in den 70er Jahren gestellte und reflektierte Frage: „Comment vivre ensemble?“[7] Liebe scheint in diesem Kontext jene Möglichkeit aufzuzeigen, diese Relationen fern aller vorgegebenen und hierarchischen Verhältnismuster als freie Hinwendung zum Anderen zu begreifen. Vor diesem Ansatz wird Arendts eigene so drängende wie kritische Frage laut: ‚Wie’ lässt sich vor einem Hintergrund von Selbstverleugnung und von der Absehung von der Welt und allem Weltlichen überhaupt noch das zentrale christliche Gebot der Nächstenliebe verstehen? Wenn es mir – nach dieser Anlage – in der Welt gar nicht mehr um die Welt geht, welches Interesse kann oder soll ich dann überhaupt noch am weltlich Anderen als Nächstem haben? ‚Wie‘ soll dieser weltliche Andere geliebt werden, wenn es doch heißt, ihn zu lieben ‚wie sich selbst‘, wenn aber dieser Selbstbezug als Selbstverleugnung definiert und gefordert ist?![8] Das verblüffende wie bedenkliche Ergebnis der arendtschen Untersuchung von Augustinus‘ Liebeskonzept ist, dass der Andere nur Mittel zur erhofften Gottesliebe ist, und nicht in seiner Individualität und Eigenheit geliebt wird, sondern gerade unter Absehung und Absonderung davon. Eine ‚vita socialis‘, ein gemeinschaftliches Leben, dessen Reflexion Arendts Interesse gilt, scheint von Augustinus her bedacht, geradezu verunmöglicht. Arendt erhebt vor diesen Analyse-Befunden dann ihren schwerwiegenden Vorwurf an Augustinus, „pseudo-christlich“ zu sein – sozusagen und polemisch gesprochen ein ‚Initiator von Weltignoranz‘ – gleichzeitig lässt ihre Kritik auf eine Philosophie der Interindividualität hoffen. Was aber bedeutet nunmehr ‚Lieben‘ für die Gestaltung des zwischenmenschlichen Raumes, um den es Arendt geht? – Gerade dann erscheint die Frage nach dem liebenden zwischenmenschlichen Verhältnis um so dringlicher, wenn Augustinus‘ Position sogar eine Legitimierung der Selbstverleugnung und damit auch eine legitimierte Leugnung des Anderen oder Fremden enthält. In dieser Perspektive leistet Arendts Liebesbegriffsanalyse einen anthropologischen Beitrag zur Subjekt- und Personenphilosophie. Von diesem Standpunkt aus sind die Problematisierungen des leeren Selbst und des Zwischenmenschlichen, des leeren Liebesbegriffs zu betrachten. Arendt interessiert sich schon hier für Augustinus im Hinblick auf die Bedingungen der Möglichkeiten des ‚modernen Menschen‘. Im augustinischen: ‚ich bin mir selbst zur Frage geworden‘ („quaestio mihi factus sum“), das vor dem Hintergrund der hier vorangestellten Fragen und Anforderungen in der Spannung eines ‚Erkenne Dich selbst‘ und ‚bleibe Dir fremd‘ sehr deutlich wird, nimmt sie offenbar in der konstitutiven Widersprüchlichkeit dieser Theorie selbst eine Modernität wahr. In ihr sieht sie einen Beginn der Problematik des ‚modernen Menschen‘, dessen Überforderung, Orientierungslosigkeit und potentielle ‚Weltlosigkeit‘ sie über ihr gesamtes Werk hin beschäftigt und von ihr immer wieder neu bedacht wird. Es ist jene Situation des modernen Menschen, der sich gerade nicht gehalten weiß, durch keinen Kosmos, keinen Gott, sondern der ‚selbst-verantwortlich‘ seinen Weg in der Welt suchen und suchend gehen muss. Von hierher sind noch einmal die Charakteristika zu bedenken, die Arendt dem ‚modernen Menschen‘ zuschreibt, und diejenigen, die sie bei Augustinus vorgeprägt findet. Ihr Kritikpunkt an seiner außerweltlich orientierten Konzeption ist die zwangsläufig fehlende Konkretion, die sowohl inhaltliche wie praktische diesseitige Bindungen unterläuft und sogar zusammen mit der Negation des Weltlichen ebenso die der Individualität des Einzelnen fordert. Auf diese Weise werden in der Welt alle gleich, weil auf ihre Unterschiede letztlich nicht mehr geachtet werden soll – vor Gott sind sie es ohnehin. Diese von Augustinus beschriebene und auch erstrebte fehlende Differenz stimmt Arendt skeptisch. So könnte – mit aller Vorsicht – eine Linie angedeutet werden, die sich von der Thematisierung eines unmöglichen, leeren Subjekts bis hin zur „Banalität des Bösen“ in einer Entinnerlichung, Entpersönlichung des modernen menschlichen Prototyps als problematisch erweist. Bleibt die als formal notwendig erzeigte Leere auch praktisch leer, zieht dies offenbar Probleme nach sich. Wie lässt sich also das Gebot der Nächstenliebe auf der Basis einer Selbstverleugnung verstehen? Erschwert wird das Verstehen einer gegenseitigen Liebe, weil letztlich in ihr die Liebe selbst, nämlich Gott, geliebt wird, und nicht der Andere, während alles Weltliche – auch das Weltlich-Kontingente am Anderen wie am Liebenden selbst – negiert wird. Von hier aus gerät der mit Augustinus vorgestellte Liebesbegriff mit dem Weltbegriff in Konflikt. Zudem gibt es unter dieser Maßgabe von Selbstabsage auch kaum mehr Möglichkeiten, einen anderen um seiner selbst Willen zu lieben, wenn dieses Selbst des Liebenden zugunsten Gottes aufgegeben wird. Vor dem Hintergrund dieser Zweiteilung hatte Arendt zurecht auf das virulente Problem verwiesen, welches Interesse ich dann in der Welt noch am Nächsten haben soll. Unter der Voraussetzung einer moralischen Weltabwertung ist eine positive Verbindung von Menschen kaum herstellbar. Im Einzelnen müßte dagegen schon Verweis, Anlage auf und für die Anderen gedacht und angelegt sein, um nicht von vorneherein immer als Konflikt von Einzelnem und Gemeinschaft aufzutauchen. Oder anders gesagt: es braucht die Vorstellung einer Struktur, unter deren Voraussetzung es auch möglich ist, gelingendes Miteinander zu denken und zu entwerfen. Der Zug des Weltabgewandten bei Augustinus liegt genau konträr zu Arendts Akzentuierung des Welthaften, ihrer Konzentration auf das Leben, und was in ihm zufällig und eigen ist. Gegenüber einer Weltabwertung müsste es also mit und nach Arendt hingegen eine Weltaufwertung geben, um ein positives Miteinander entwerfen zu können, in dem Einzelne als Besondere in ihrer Eigenheit begriffen werden, und damit einen positiven und nach Arendt auch christlichen, aber nicht augustinischen (!) Begriff der Nächstenliebe, sinnvoll zu füllen und aufrecht erhalten zu können. Die Eigenheit des Einzelnen geht – wortwörtlich – im Besonderen verloren, weil der von Augustinus positiv verstandene Weg der Gottessuche zwingend an die Selbstverleugnung in der Welt, alles Weltliche am Einzelnen, an mir, geknüpft ist. Der Einzelne bringt kein Selbst, was verantwortlich sein könnte, keine Eigenheit mehr (die kontingent und weltlich wäre) mit, und damit auch nichts, was ihn konkret an andere knüpfen könnte, und ebenso keinen Gemeinsinn (sensus communis). Zugleich tritt das zuvor in der Antike teilweise noch weltlich verortete Selbstzweckhafte (im Geschehen der Freundschaft und Liebe) bei Augustinus in eklatant veränderter Weise zu Tage. Es ist dem Weltlichen enthoben und kommt nurmehr Gott zu. Gott allein ist Selbstzweck und kann um seiner selbst willen geliebt werden. Damit aber wird die alleinige Verbindungsmöglichkeit in der Welt die der Funktionalisierung, und auch der Liebesbegriff als Nächstenliebebegriff wird mit dieser Hypothek belastet. Arendt ist bei aller kritischen Befragung von Augustinus‘ Liebeskonzept durch dasselbe aber auf ihr eigenes theoretisches Interesse und weiterführende Fragen gestoßen, die sie dauerhaft beschäftigen, und für die sie nach philosophischen Begründungen bzw. mehr noch nach deren kritischer Diskussion sucht. Es ist eben jene Frage, wie sich menschliches Miteinander, eine Bezogenheit aufeinander, anders als Funktionalisierung und als Zweck-Mittel-Relation zum Anderen denken und aufzeigen lässt. – Kurz: Wie ist Interpersonalität möglich? Da aber implizit auch eine fehlende Wertschätzung des Eigenen, Persönlichen, Individuellen in Arendts Augustinus-Kritik hervortritt, scheinen hier geradezu theoretische Weichen zur Erfassung von Interindividualität gestellt. In ihrer mittleren Schaffensphase wird Arendt in „Vita activa“ auf das „Zwischen“ der Menschen zu sprechen kommen, um das es ihr geht, und hier vor allem „Sprechen“ und „Handeln“ als die uns zu Menschen machenden Tätigkeiten, die uns in unserer Pluralität, der Tatsache, Welt immer mit anderen zu teilen, ausweisen, herausstellen. In den in den 70er Jahren gehaltenen Vorlesungen über Kant wird sie im „Urteilen“ und im Besonderen im sensus communis den Gemeinsinn entdecken, der schon alle im Einzelnen angelegten Fähigkeiten als solche erweist, die uns als Mensch unter Menschen, als Urteilende in Gemeinschaft bezeugen. Wie aber steht es um den ‚Liebesbegriff‘ bei Arendt selbst? Vermag er Zwischenmenschlichkeit, die bei ihr immer Welthaftigkeit bedeutet, zu verbürgen oder zu begründen?! Auch Arendts eigener Liebesbegriff, der vielfältigen Wandlungen unterliegt, ist im Zusammenhang mit ihrem Personenverständnis zu sehen, in dem sich ebenso auf komplexe und nicht widerspruchslose Weise Liebes- und Personendiskurs verschränken. Für das Denken Arendts, das den Einzelnen als Glied der Gemeinschaft theoretisch einfordert, bleibt eigenartiger Weise der Einzelne selbst ein blinder Fleck in der Liebeskonzeption. Anlass dafür ist vielleicht auch in der von ihr selbst dargestellten und kritisierten Konzeption zu suchen und zu finden. Das gravierende Problem, das sie prägnant bei Augustinus herausarbeitet, warum der all seiner Weltlichkeit entledigte Einzelne überhaupt noch ein Interesse am Nächsten, am Anderen haben könne, lässt sie selbst unbeantwortet. In dieser Unbestimmtheit zeigt sie sich letztlich aber selbst noch in der Tradition stehend, deren Kritik sie so scharfsinnig auf den Punkt bringt. Hier zeigt sich, dass Arendt, die Augustinus‘ Dualismus von zwei Welten, der jenseitigen und der diesseitigen, einst so scharf kritisierte, in einer chiastischen Figur, einer Überkreuzung selbst davon etwas auf problematische wie produktive Weise übernimmt, transponiert und weiterführt. Nach der in ihrer Dissertation ausgeführten Kritik stand nur ex negativo im (Denk-)Raum, durch welche Überlegungen und Elemente ein neues und von Augustinus abweichendes Denken des Interpersonellen, des ‚Zwischen den Menschen‘ und damit auch eine andere Vorstellung von ‚Liebe‘ bestimmt sein müsste. Wenn ein gelingender Bezug zum Anderen möglich sein soll, dann müsste Welt positiv angenommen sein. Das Weltlich-Sein dürfte nicht gegenüber einem angenommenen jenseitigen Leben entwertet werden, um nicht zugleich Wert und Ziel des diesseitigen Lebens aus dieser Welt – wie Arendt sagt – ‚hinauszuprojizieren‘. Ganz im Gegenteil müsste Welthaftigkeit, und damit auch das, was sie kennzeichnet: Kontingenz und Konkretion und Endlichkeit, gerade Auszeichnung derselben sein. Von hier her wäre u.U. zu erwarten, dass auch in der Liebe – anders als im augustinischen Entwurf – die Eigenheit des Einzelnen, seine Individualität grundlegenden und bestimmenden Eingang in Arendts Theorie nehmen müssten. Dies ist so einfach und einmütig jedoch nicht der Fall. Hatte sie in ihrer Frühschrift die augustinische Weltenspaltung noch so kritisch zu recht auseinandergepflückt, kommt es in „Vita activa“ selbst zu einer eigenartigen geradezu dualistischen Verschränkung von Liebe und Person, die anders gelagert, aber ebenfalls nicht ohne Probleme ist.
Das Personenhafte einer Person kann dieselbe nicht sehen, es ist ihr nicht zugänglich. Aber in der persönlichen Liebe sieht der Andere das „Wer-ich-bin“, hat Zugang dazu. Infolgedessen kommt es zu einer Art der Zweisamkeit, die im Grunde nur ein Pendant zur isolierenden Weltlosigkeit des Einzelnen in Zweierform darstellt und eben von Arendt nicht nur als Weltlosigkeit, sondern sogar als potentiell ‚weltzerstörend‘ bestimmt wird, da die Liebenden offensichtlich außerhalb des Gemeinschaftswesen gedacht werden, sich selbst zu genügen scheinen und damit gemeinschaftlich negierend wirken. D.h. dass bei Arendt in ähnlicher Weise wie bei Augustinus Welthaftigkeit und Weltlosigkeit moralisch aufgeladen sind – oder noch problematischer: Zweisamkeit grundsätzlich, genuin Weltlosigkeit anhaftet. Dies bedeutet aber wiederum, dass der zuvor den Theorien des Einzelnen vorgeworfene vereinzelnde Zug sich nun einfach auf Zweisamkeit verlagert hat, verschoben wurde. Es bleibt zu fragen, welche Verschiebung sich überdies dadurch ergibt, dass Arendt den Lebensbegriff in ihrer Ausdeutung von Augustinus‘ Konzept mit dem Liebesbegriff gleichsetzt. Während es Augustinus um eine Liebe zum Sein geht, wird dieselbe von Arendt als Liebe zum Leben verstanden, in der jede Liebe zum Sein nur konkretisiert erscheinen kann. Gleichwohl bleibt auch bei ihr eine Verzahnung von Personen- und Liebesdiskurs bestehen, der sich ebenso auf der problematischen Basis eines Dualismus‘ – nun mit umgekehrten Vorzeichen im Vergleich zum Kirchenvater: von falscher Weltlosigkeit und richtiger Welthaftigkeit – vollzieht. Als dessen Folge bleibt ein Vorbehalt gegenüber dem Individuellen, der in eine Überblendung desselben als potentiell Exemplarisches und Gemeinsinniges mündet. Insofern muss auch hier gefragt werden, ob der Einzelne als individuierter Einzelner wirklich Eingang in die Theorie bei Arendt gefunden hat, finden kann oder überhaupt soll. Arendt hat Vorbehalte gegenüber Innerlichkeit, Selbstsuche und Introspektion, da diese Daseinsformen latent von Gemeinschaft absehen, zugleich dienen ihr aber auch viele der in der Dissertation erarbeiteten Termini zur eigenen konkreten Selbstwahrnehmung. „Rastlosigkeit“, „Heimat“ und „Zugehörigkeit“ sind ihr eigene Verstehenskategorien für das persönliche Verhältnis zu anderen, denn Heimat und Zugehörigkeit sind für sie im Besonderen bei einem Menschen zu finden. Bei diesem eigenartigen Zusammentreffen von Entinnerlichung und Individualisierung in ihrem Werk – denn theoretisch ist von ihr selbst gefordert, was sie offenbar vor allem der privaten Korrespondenz vorbehält – könnte es sich um einen jener Widersprüche handeln, der nach Arendt gar nicht aufzulösen ist, sondern in seiner Doppeldeutigkeit philosophische Reflexion auf seine Begründung provoziert. In „Vita activa“ stellt Arendt so einerseits Liebe tatsächlich als die Verbindung heraus, in der es allein dem Liebenden möglich ist, das ‚Wer-einer-ist‘ beim Anderen zu erkennen, während sich der Person selbst ihr ‚Personenhaftes‘, also das, was sie zu dieser einzigartigen macht, immerzu entzieht. Darin liegt im Vergleich zu Augustinus eine Wertschätzung und Anerkennung gegenüber der weltlichen Liebe. Gleichzeitig aber markiert und stigmatisiert sie andererseits ‚Liebe‘, die zuvor als ‚sehend‘ und ‚erkennend‘ beschrieben wurde, im selben Atemzug als blindmachend, ‚weltlos‘, ja, sogar als ‚weltzerstörend‘. Wie lässt sich dieser harsche Kontrast verstehen? Diese extreme und widerstreitende Position kann tatsächlich unter Rückbezug auf ihre frühe Schrift über Augustinus Liebesbegriff verständlicher werden. Wie Augustinus geht auch Arendt, wenngleich ohne Gott als Begründung anzuführen, von einer fehlenden Selbsttransparenz der Person aus. Ich weiß selbst nicht um das, was mich ausmacht. Das Sich-Finden gelingt dem Menschen bei Augustinus auch nicht durch einen Rückbezug auf sich selbst, sondern nur in Bezug auf Gott (bzw. einem bei-Gott-sein). Und ebenso bleibt bei Arendt der Person selbst ihr Personenhaftes unerschlossen, aber es kann vom Anderen gesehen werden. Im Anderen kann ich mich finden, und er sieht mich auf eine Weise, in der ich sonst nicht und von niemandem gesehen bin. Genau hierin scheint nun das einst bei Augustinus fehlende Eigene und Individuelle in Arendts eigener Liebeskonzeption eingelöst, doch bleibt es hier nicht nur im Kontrast zur Weltliebe widerständig, sondern auch eigenartig leer. Denn in dieser persönlichen zweisamen Liebe hat der Andere gerade auch gar keinen Blick für die spezifischen Qualitäten und Eigenschaften, sondern erhellt auf eigentümlich abstrakte und nicht näher ausgeführte Weise die Existenz des Anderen. Die eigenen Eigenschaften erfahre ich hingegen als Person unter Personen, sprechend, handelnd und urteilend in der Welt. Wegen dieser Einzigartigkeit der Beziehung, der Exklusivität dieses mich begründenden Verhältnisses, wirkt diese Art der Relation – Liebe – auch so stark, aber in Arendts Auffassung genauso isolierend gegenüber dem Rest der Welt. Es ist ein Verhältnis, das per definitionem nicht mit anderen geteilt werden kann. Darum ist es ‚weltlos‘, mehr noch: ‚weltzerstörend‘, wenn es potenziert gedacht wird – also die Welt als Ansammlung von mehr oder minder sozusagen autistischen Paar-Existenzen entworfen ist. Arendt rührt damit an einen wunden Punkt der von ihr betrachteten philosophiegeschichtlichen Zusammenhänge bezüglich der Subjekt- und Personen- und sogar Gesellschaftstheorien im Verhältnis zum Liebesdiskurs, nämlich einer weitgehend fehlenden theoretischen Auseinandersetzung mit Intersubjektivität, mit den Verhältnissen von Menschen untereinander, der Interpersonalität menschlicher Relationen. Es wird deutlich, dass es ein weit über die Philosophie hinausreichendes Problem ist, wenn menschliche Verhältnisse und ein mögliches Menschen-Verbindendes entweder immer nur als unverbindlicher Zusammenschluss aus lauter Einzelnen (Einzelpersonen) oder als unpersönlicher Staat oder abstrakte Gesellschaften gedacht werden. Ebenso wenig könnte hier jedoch auch eine isolierte Zweiergruppe der Liebenden Abhilfe für ein fehlendes welthaftes Miteinander schaffen. In all den genannten Relationen ist kein konkretes Miteinander in den Blickpunkt gerückt, vielmehr sind sowohl Gemeinschaften in ihrem Verhältnis zu Einzelnen und umgekehrt eher konfliktuell gedacht. Liebe als Nahbeziehung – und mit ihr Intimität – ist und bleibt ein problematisches Theorem für und bei Arendt. Liebe ist sehend gegenüber dem Anderen, aber blind gegenüber der Welt, die ich mit weiteren Anderen als nur dem Geliebten teile. Was aber besagt dann „Liebe zur Welt?“ Offenbar bedarf es einer Lebens- und Weltvorstellung, deren hervorstechendes Merkmal es ist, sie konkret und d.h. in Auseinandersetzung mit anderen zu teilen. Begreifbar wird auch dies vor dem Hintergrund der augustinischen Liebeseinteilung in falsch und richtig. Bei Arendt teilt sich offenbar Liebe ebenfalls – nur mit umgekehrten Vorzeichen - in eine richtige zur Welt, die uns in unserer Pluralität aufzeigt, und eine falsche, weltabgewandte, mit der wir jedoch immerzu – selbst in unseren tendentiell weltlosen Nahbeziehungen konfrontiert sind. In einer Innerlichkeit der Liebe wird so offenbar eine weltimmanente Weltabgewandtheit gewähnt, die gerade darum als trügerisch und verfehlt – zumindest theoretisch – abgelehnt wird. Es bleibt jedoch zu fragen, inwiefern nicht auch diese Position, die so kritisch gegenüber Zweisamkeit und dem eigenen als isoliertem Selbst ist, problematisch gegenüber einer Welthaftigkeit bleibt, wenn es doch Einzelne sind, die sich in Gemeinschaft vor Gemeinschaft und sich selbst verantworten müssen. – Die moderatere Einstellung einer nur partiellen und nie vollständigen Selbstkenntnis scheint hier weitaus tragfähiger zu sein. Zugleich bleibt auch zu fragen, ob es für den Ansatz einer Theorie von Interpersonalität so zwingend ist, Zweisamkeit und damit Nahbeziehungen von vorneherein als latent vereinzelnd zu diskreditieren, in denen jedoch gerade erste und immer wieder nachhaltige Erfahrungen davon gemacht werden können, wie es ist, nicht bloß miteinander in Funktionszusammenhängen zu stehen, sondern als die Person, die man ist, was immer dies situativ und je einzeln heißen mag, um ‚seiner-selbst-Willen‘, geliebt zu sein. Genau auf diese Denkfigur kommt Arendt immer wieder zurück, sei es in ihren persönlichen Briefen oder aber auch im Spätwerk. Die Formel des Selbstzwecks als höchster Ausdruck von Liebe, der in der Antike bei Aristoteles als Auszeichnung der optimalen Freundschaft und Liebe innerweltlich verstanden war, kommt bei Augustinus nurmehr Gott zu und wird so aus der Welt heraus in ein Jenseits verlagert. Durch diese Verschiebung wird ‚Liebe‘ in arendtscher Diktion ‚weltlos‘. Liebe mitsamt der Selbstzweckformel wird bei Arendt wieder in das weltliche Geschehen zurückgeholt, aber behält gleichwohl einen exklusiven Status, an dem sich sogar in problematischer und konfliktueller Weise Welthaftigkeit und Weltlosigkeit von Einzelnen scheiden. Es ist Arendts Verdienst, die folgenreiche widerstreitende Verknüpfung von Liebes- und Personendiskurs aufzuzeigen und als abendländischen Denkstrang von ethischer und antropologischer Tragweite ernstzunehmen, und es nicht bloß als Spezial-Problem augustinischer Theologie aufzufassen. Die Spur einer theoretisch allererst noch einzulösenden Interindividualität streut sie aus, ohne sie selbst zu verfolgen, ja, sogar im Punkt Intimität zu unterlaufen. Aber, indem die Frage nach Liebe hier philosophisch entfaltet wird, und zwar als Frage, ob von diesem Phänomen her Bezüge von Menschen als gemeinschaftsbildend gelten können, erörtert sie mit ihrer Liebesanalyse bei Augustinus eine Grundlage christlich geprägten okzidentalen Denkens, die durch jahrhundertelange Sedimentierung ins Allgemeingut derart implizit geworden ist, dass sie erst durch einen besonderen Zugriff – in diesem Fall dem scharfsinnigen und zupackenden von Hannah Arendt – wieder ins Bewusstsein gehoben und reflektiert wird und dadurch Diskussion erfahren kann. Letztlich ist es also nicht nur die Frage, wieviel Intimität ich zur eigenen Individualität benötige, sondern auch wieviel Individualität und Intimität ich zur Konstitution und Fundierung von Nahbeziehungen benötige, die immer Teile einer größeren Gemeinschaft sind. AusblickIn den drei ausgewählten Zugängen konnten keine direkten Antworten auf die Frage nach Intimität geliefert, wohl aber die teilweise sogar divergierenden Rahmen dieser Fragen und ihrer möglichen Relevanzen aufgezeigt werden. Es ist die Frage nach eigener möglicher Selbstkenntnis und Durchsichtigkeit oder auch eigener Selbstverstellung, die Frage nach dem eigenen Beheimatetsein, die zugleich Auswirkungen in sozialphilosophischer Perspektive auf die Möglichkeit von geglücktem mit sich-selber oder auch mit einem oder mehreren Anderen-sein hat. Daher steht diese letzte genannte Frage nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der intimen Frage vom eigenen Ausgang aus sich – und damit nach eigener Mündigkeit. Die Unmöglichkeit einer Selbstbestimmung im bloßen Rückzug auf das Selbst wurde hier ebenso deutlich, wie die notwendig formal angenommene Leere eines Selbst, das sich praktisch sehr wohl selbst zu bestimmen weiß und zwar jeweils in lebendigen und durch lebendige, gelebte Verhältnisse. Das Dispositiv jeden reflektierenden Zugangs ist denkwürdiger Weise mit der Liebesthematik verknüpft, in der offenbar das Persönlichste einer Person beheimatet zu sein vermag. Es schreibt sich damit in eine Philosophie bloßen Daseins ein. Intimität weist formal auf die Annahme eines notwendigen Freiraums, ja Leerraums hin, den eine Person zu ihrem eigenen Selbstvollzug als eines geschützten Raumes bedarf. Seine Konturen, Rahmen, Ränder und Grenzen werden wiederum erst von den umgebenden Verhältnissen profiliert, die ihn von hierher als sicht- und wahrnehmbaren erscheinen lassen. Anmerkungen[1] Ovid: Metamorphoses, 3, 339-510, hier: 348. [2] Ebd., 463. [3] Weiterführende und vertiefende Überlegungen zur Tradition des hortus conclusus und zum mehrdeutigen Wechselspiel von innen und außen finden sich in Esther Meiers Aufsatz: Der umschlossene Garten in der Kunstgeschichte – Die Frage nach dem Drinnen und Draussen. In: Hortus conclusus. Ein geistiger Raum wird zum Bild. Hrsg. Nele Ströbel und Walter Zahner. München/Berlin 2006. S. 15-30. Und siehe auch: Walter Zahner: Hortus conclusus – Ein geistiger Raum wird zum Bild. Eine Einführung. Ebd. S. 11-14. [Künftig zitiert: Hortus conclusus.] [4] Siehe hierzu: Reinhold Then: Vom Garten zum Paradies – Biblische Gartenimpressionen. In: Hortus conclusus. S. 33-49. [5] Diesen Hinweis verdanke ich Gerhard Neumann und seiner derzeit an der Freien Universität Berlin gehaltenen Vorlesung zu „Liebe und Literatur“. Seinen Ausflug in diese Thematik beschreibt Kant selbst als „Lustreise“, bei der er sich die Bibel als „heilige Urkunde“ als „Karte“ nimmt. Immanuel Kant: Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte. In: Ders.: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik I. Werkausgabe Bd. XI. Hrsg. v. Wilhelm Weischedel. S. 83-102. Hier S. 85f. [6] Siehe Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. 4. Aufl. München 2006 (1972). S. 308f. [7] Roland Barthes: Wie zusammen leben. Simulationen einiger alltäglicher Räume im Roman. Vorlesung am Collège de France 1976-1977. (Comment vivre ensemble. Simulations romanesques de quelques espaces quotidiens. Paris 2002.). Hrsg. v. Éric Marty. Frankf. a. M. 2007. [8] Diesen Zusammenhang habe ich auch ausführlich in dem Essay: Liebe zum Sein als Liebe zum Leben dargelegt. In: Hannah Arendt: Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation. Hildesheim/Zürich/New York 2006. Ein aufschlußreicher Artikel von Arendt zu Augustinus in seiner theologischen Bedeutung findet sich in der Ausgabe von Ludger Lüdtkehaus: Hannah Arendt : Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation. Berlin/Wien 2003. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/53/fk9.htm |
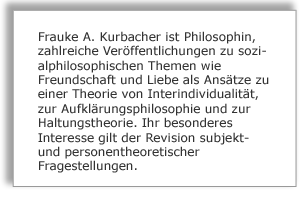 Auf eine erste, schlichte Frage, was unter Intimität zu verstehen sei, könnte vielleicht zunächst ganz allgemein, abstrakt und formal in Form einer steigernden Rede geantwortet werden: „das Persönlichste eines Menschen als individuierter Person“. Die Steigerung, der Superlativ wäre dann genau das Anzeichen dafür, dass mit Intimität nicht einfach eine anthropologische Kondition bedacht wird, sondern was das Person-sein in seiner Individualität spezifisch in den Grenzen des theoretisch Auslotbaren ausmacht. Was dieses ‚Persönlichste‘ ist oder sein könnte, wäre demnach der Bestimmung einer jeden Person je eigen überantwortet. Aber natürlich wirken bei diesen Bestimmungen, die dann vollzogen werden oder würden – ob in Anlehnung oder Ablehnung und einer sich darin immer bekundenden kreativen Variation – schon immer jene Bestimmungen mit, die im kulturellen Kontext bereits als Anwärter für Intimität verhandelt wurden und virulent sind. Dies ist im Fall von Intimität im Besonderen ein Bereich des als ‚Inneren‘ oder auch als ‚Innerlichkeit‘ Bezeichneten, zu dem – auch in Abgrenzung zum bloß Privaten, unter das z.B. auch die Privatsphäre einer ganzen Familie und deren Aktivitäten fallen kann – oft Träume, Wünsche, Geheimnisse und Rätsel einer Person gezählt werden und ebenso eine kulturgeschichtlich variante Zone von eigener Erotik, Sexualität und Auffassung eigener moralischer Tabus.
Auf eine erste, schlichte Frage, was unter Intimität zu verstehen sei, könnte vielleicht zunächst ganz allgemein, abstrakt und formal in Form einer steigernden Rede geantwortet werden: „das Persönlichste eines Menschen als individuierter Person“. Die Steigerung, der Superlativ wäre dann genau das Anzeichen dafür, dass mit Intimität nicht einfach eine anthropologische Kondition bedacht wird, sondern was das Person-sein in seiner Individualität spezifisch in den Grenzen des theoretisch Auslotbaren ausmacht. Was dieses ‚Persönlichste‘ ist oder sein könnte, wäre demnach der Bestimmung einer jeden Person je eigen überantwortet. Aber natürlich wirken bei diesen Bestimmungen, die dann vollzogen werden oder würden – ob in Anlehnung oder Ablehnung und einer sich darin immer bekundenden kreativen Variation – schon immer jene Bestimmungen mit, die im kulturellen Kontext bereits als Anwärter für Intimität verhandelt wurden und virulent sind. Dies ist im Fall von Intimität im Besonderen ein Bereich des als ‚Inneren‘ oder auch als ‚Innerlichkeit‘ Bezeichneten, zu dem – auch in Abgrenzung zum bloß Privaten, unter das z.B. auch die Privatsphäre einer ganzen Familie und deren Aktivitäten fallen kann – oft Träume, Wünsche, Geheimnisse und Rätsel einer Person gezählt werden und ebenso eine kulturgeschichtlich variante Zone von eigener Erotik, Sexualität und Auffassung eigener moralischer Tabus. Problematisch wird für den selten schönen Jüngling die eigene Geschichte, als er sich in das eigene Spiegelbild verliebt, ohne sich zunächst – dies ist die Bedingung für das Verlieben, einen Anderen und nicht sich selbst zu wähnen – der Spiegelung bewusst zu sein. Tragisch und destruktiv wird es in jenem Augenblick, da er merkt, außer der Berührung der Wasseroberfläche, ins Nichts zu greifen. Er kann weder sich als sich selbst, noch sich als Anderen je greifen, je erreichen. Die Situation kippt mit dem „Iste ego sum!“.
Problematisch wird für den selten schönen Jüngling die eigene Geschichte, als er sich in das eigene Spiegelbild verliebt, ohne sich zunächst – dies ist die Bedingung für das Verlieben, einen Anderen und nicht sich selbst zu wähnen – der Spiegelung bewusst zu sein. Tragisch und destruktiv wird es in jenem Augenblick, da er merkt, außer der Berührung der Wasseroberfläche, ins Nichts zu greifen. Er kann weder sich als sich selbst, noch sich als Anderen je greifen, je erreichen. Die Situation kippt mit dem „Iste ego sum!“. Auffällig an den vielfältigen Darstellungen in der Geschichte des hortus conclusus ist ein eigenartiges Changieren von innen und außen.
Auffällig an den vielfältigen Darstellungen in der Geschichte des hortus conclusus ist ein eigenartiges Changieren von innen und außen.