
Intimität |
Ausgestellte Intimität
Zum Liebestod von Dorine und André GorzTatjana Noemi Tömmel
Liebestode gibt es vermutlich so lange wie es die Liebe gibt. Von unglücklichen Paaren, die sich bis in und durch den Tod treu sind, erzählt die Literatur aus allen Erdteilen, zu allen Zeiten. Einige der oben genannten Geschichten sind aus dem Kanon der Weltliteratur nicht wegzudenken, andere dagegen dürften nur noch Literaturwissenschaftlern etwas sagen. All den Geschichten der „großen Liebenden“ aber ist gemein, dass sie von der einen, absoluten Liebe erzählen, die unweigerlich zum Tod führt, sei es, dass einer stirbt oder für Tod geglaubt wird, und der andere nicht ohne ihn sein will, sei es, dass eine individuelle oder metaphysische Schuld die Liebe in dieser Welt nicht zulässt. Die meisten literarischen Paare sterben in der Blüte ihrer Jugend: Die Spanne zwischen dem ersten Liebesblick von Romeo und Julia und ihrem Tod beträgt gerade mal 100 Stunden. Ihren literarischen Vorläufern Pyramus und Thisbe gesteht das Schicksal nicht einmal einen Blick, geschweige denn eine Liebesnacht zu: sie sterben füreinander, ohne sich zu kennen. Sie gleichen Sternschnuppen, die im Augenblick ihrer strahlenden Erscheinung schon verglühen: „Too like the lightning, which doth cease to be/ Ere one can say it lightens. (Romeo and Juliet, II.2) Der Fall des Sozialphilosophen André Gorz und seiner Frau ist offensichtlich ein anderer: Hier töteten sich keine allzu leidenschaftlichen Backfische, sondern ein Ehepaar, das sechzig Jahre miteinander gelebt hatte. Dorine Gorz war bereits seit geraumer Zeit schwerkrank: In den Sechziger Jahren hatte man ihr ein Kontrastmittel gespritzt, das anhaltend starke Schmerzen verursachte, da es vom Körper nicht abgebaut werden konnte. Rund zehn Jahre später, mit Zweiundfünfzig, erkrankte sie an einem Krebs der Gebärmutterschleimhaut, der allerdings operativ entfernt werden konnte. Dass sich das Paar gemeinsam das Leben nahm, wurde also nicht unmittelbar von Dorines Krankheiten ausgelöst, mit denen sie seit Jahrzehnten gelernt hatte zu leben, sondern wesentlich von dem Wunsch ihres Mannes, nicht eines Tages ohne sie leben zu müssen: „Ich will nicht bei Deiner Einäscherung dabei sein; ich will kein Gefäß mit Deiner Asche bekommen.“ Diese Zeilen bilden den Schlussakkord eines etwa achtzig Seiten langen Briefes, den Gorz seiner Frau ein gutes Jahr vor ihrem gemeinsamen Tod geschrieben hatte. Die mediale Aufmerksamkeit, die der Selbstmord auf sich zog, wäre wohl geringer ausgefallen, hätte Gorz nicht vorher mit der Veröffentlichung des „Lettre à D. Histoire d´un amour“ (Editions Galilée, Paris 2006) ihrer Ehe ein literarisches Denkmal gesetzt. Sowohl die französische als auch die deutsche Presse feierten unisono die anrührende Aufrichtigkeit des Buches. Der Text treibe einem die Tränen in die Augen, heißt es im Tagesspiegel vom 26. 9. 2007. Von einer „Hommage an die vom Tode bereits gezeichnete Gefährtin“ (Jürgen Ritte) ist die Rede, auch von einer „grandiosen Liebeserklärung“ (Jörg Altweg, FAZ vom 24.9. 2007). Gorz erzählt im „Brief an D.“ die Etappen ihres gemeinsamen Lebens – d.h. der Ehe, die sie trotz seiner ideologischen Bedenken schließlich eingingen, der wechselnden Wohnorte und Arbeitsplätze, die er stets mit ihrer Hilfe bewältigte, der literarischen und philosophischen Texte, die er schrieb und schließlich den Verlauf ihrer Erkrankungen und seinen Rückzug aus dem Berufsleben - aber nur oberflächlich betrachtet handelt es sich um die „Geschichte einer Liebe“. Das Ziel, das Gorz auf den rund achtzig Seiten verfolgt, ist weniger, seine Beziehung zu Dorine darzustellen, als alles zurückzunehmen, was er in früheren Texten, vor allem seiner Autobiographie „Der Verräter“ (1958), diesbezüglich geschrieben hatte. So handelt es sich also eigentlich nicht um eine Aussprache mit seiner Frau, sondern um einen Kommentar zu seinem eigenen Werk, um eine zum Buch angewachsene apologetische Fußnote. Schon auf der ersten Seite heißt es: „Warum nur bist Du in all dem, was ich geschrieben habe, so wenig präsent, während doch unsere Verbindung das Wichtigste in meinem Leben gewesen ist? Warum nur habe ich in Der Verräter ein falsches Bild von Dir gegeben, das Dich entstellt?“ (S.5)[1] Eigentlich habe er mit diesem Buch zeigen wollen, dass „mein Engagement Dir gegenüber die entscheidende Wende gewesen ist, die es mir ermöglicht hat, leben zu wollen.“ (S.6) Ziel des Briefes soll es nun sein, den vergangenen Missgriff zu klären: „Ich muss die Geschichte unserer Liebe rekonstruieren, um sie in ihrem ganzen Sinn zu erfassen.“ (S. 6) Monolog mit ZuschauerGorz schreibt einen Brief, aber sein Ziel ist nicht der dialogische Austausch,– er stellt keine Fragen an sein Gegenüber, sondern erforscht in augustinischer Manier sein eigenes Inneres. Die zweite Person Singular des Briefes wirkt seltsam deplaziert in einem Text, in dem der Autor zwischen „ich“ und „wir“ nicht unterscheiden kann: „Ich schreibe Dir, um zu verstehen, was ich erlebt habe, was wir zusammen erlebt haben.“ (S. 6) Kein Brief also, sondern ein Monolog - mit Zuschauer wohl bemerkt. Gorz war kein Vertreter jener Richtung von Rousseau bis ´68, denen das Private als politisch galt und die ihre „Intimität“, d.h., das, was ihre Eltern hinter verschlossenen Türen und vielleicht nur mit geschlossenen Augen taten, ans Licht der medialen Öffentlichkeit bringen wollten. Sein „Brief“ ist nicht ein politisches Manifest wie die öffentlich-offene Beziehung zwischen Jean Paul Sartre und de Beauvoir oder das bed-in von Ono und Lennon. Falls er eine politische Bedeutung hat, so liegt sie in der Absage an die Politik, in der öffentlichen Beschwörung des Rückzugs ins Private, der ökologischen Ernährung und alternativen Medizin. Nun produziert das Schreiben über Intimität stets dasselbe Paradox: das Verborgene verliert sein wesentliches Charakteristikum, wenn es als Verborgenes beschrieben und damit ins Licht der Öffentlichkeit gehoben wird. Warum also muss Gorz seinem Text den persönlichen Charakter rauben, warum muss er einen Text, der für seine Frau bestimmt war, veröffentlichen? Fragwürdig ist dieser Grabstein in Briefform nicht nur, weil allein André Gorz spricht, er allein die Interpretationshoheit über das gemeinsame Eheleben behält; sondern auch deswegen, weil die Narration des „Briefes“ die Öffentlichkeit als Adressaten von Anfang an enthüllt. Wie ist es sonst zu erklären, dass „A.“ „D.“ ihre eigene Geschichte erzählen muß? „1973 arbeitetest Du bei den Éditions Galilée, bautest für den Verlag die Abteilung für Rechte und Lizensen auf...“ (S. 71). Ein Brief als Äußerung zwischen Intimi dürfte dagegen für einen Außenstehenden kaum verständlich sein. Ist nicht jede intensive Beziehung durch die Herausbildung einer eigenen Sprache gekennzeichnet, die so von gemeinsamen Erinnerungen, Zitaten, Andeutungen, Witzen und kindlichen Spielereien lebt, dass sie für einen Fremden ein idiosynkratisches Durcheinander darstellt, ein Ärgernis, eine Albernheit? Die Komplimente, die Gorz seiner Frau machen will, wirken dagegen hölzern, wie Zwischenzeugnisse, die der Autor seinem Objekt ausstellt, um ihre Qualitäten jedermann gegenüber anzupreisen: „Auf Anhieb hast Du das Wesentliche vom Beiläufigen unterschieden.“ (S. 8) Der ‚offizielle’ Stil macht den „Brief an D.“ deswegen noch nicht zu einem Brief an X. über D.: Der Leser erfährt nicht einmal ihren Namen. Wer die Frau hinter der Initiale ist, bleibt im Vagen. Eine Engländerin und schön, wie Engländerinnen schön sind: „Du hattest üppiges rotbraunes Haar, die perlmuttschimmernde Haut und die hohe Stimme der Engländerinnen“ (7). Einmal hebt Gorz ihre Ähnlichkeit mit der „Aphrodite von Milo“ hervor, jenem Archetypus einer schönen Frau. Eine Person tritt nie hinter den Klischees hervor. Wenn der Brief aber weder an „D“ noch über sie ist, warum geht es denn dann eigentlich in dieser „Hommage“? Vielleicht hat die Presse sich die Mahnung „de mortuis nisi nil bene“ allzu sehr zu Herzen genommen, vielleicht waren sie derart von der „Aufrichtigkeit“ des Verfassers geblendet, dass ihre Urteilskraft zeitweilig getrübt wurde. Literarisch unscheinbar, lebt das Büchlein vor allem vom Pathos der Wiedergutmachung. Am Ende seines Lebens resümiert ein zeitweiliger Freund Sartres sein schwieriges Verhältnis zur Liebe, leistet Abbitte für das Unrecht, das er seiner Frau angetan hat und konvertiert zur Liebe in ihrer für den Philosophen schwer erträglichen irreduziblen Unergründlichkeit: Existentialismus revisited, als Doku-Soap? Was Gorz´ Liebe im Weg stand, waren nicht einfach ideologische Bedenken - obwohl ihm auch die Ehe als „bourgeoise Institution“(20) zuwider war– nein, seine Bedenken waren philosophischer Natur: „Ich hatte große Schwierigkeiten mit der Liebe (...) denn es lässt sich unmöglich philosophisch erklären, warum man liebt“ (29). Ein Hinweis auf die Philosophiegeschichte hätte ihm vielleicht helfen können. Denn weder Platon noch Augustinus, weder Aristoteles, Thomas, Pascal, Hegel, Kierkegaard oder Husserl wäre es in den Sinn gekommen, die Liebe als „zu banal, zu privat, zu ordinär“ (57) für philosophische Reflexionen zu finden. Selbst sein Freund Sartre widmete ihr bekanntlich rund dreißig Seiten in „L´Être et le Néant“. Gorz aber meinte von sich, als Philosoph keinen Sinn für das Nur-Individuelle haben, dem Besonderen keinen Platz neben den Prinzipien einräumen zu können. „Ich war nicht weit davon entfernt, die Liebe für ein kleinbürgerliches Gefühl zu halten [...] Ich liebte es nicht, Dich zu lieben.“ (63) Gorz schämte sich seiner Gefühle. Und schrieb von „Kay“ (einem Pseudonym für „D.“) „wie von einer Schwäche“ (56). Liebe scheint ihm also ortlos im philosophischen System. Ein buchstäbliches Unding. Dann aber entdeckt er eine Funktion und nicht die schlechteste: Der Verräter „sollte zeigen, wie meine Liebe zu Dir, mehr noch: die Entdeckung der Liebe mit Dir, mich endlich dazu geführt hat, existieren zu wollen; und wie meine Bindung an Dich zur Triebfeder einer existentiellen Bekehrung wurde.“ (S. 55) Der Versuch aber misslang: „Ich versuche vergebens (den Liebesschwur) im Namen universeller Prinzipien zu rechtfertigen, als ob ich mich seiner schämte“ (56). Eine Sache ist, die Liebe zu verschweigen oder zu verachten, etwas anderes, den Menschen, mit dem man lebt zu verleugnen oder gar zu verleumden, das übersieht Gorz in seiner Selbstkritik. Denn er schreibt nicht von seiner Schwäche für „Kay“, sondern beschreibt sie als hilflose Person, die kein Französisch konnte und sich ohne ihn „zugrunde gerichtet hätte“ (6) – was alles nicht den Tatsachen entsprach. Welches philosophische Prinzip hier wohl am Werk gewesen sein mag? Während Elisabeth von Thadden in der „Zeit“ rühmte, dass Gorz „seine individuelle Geschichte mit fast keinem Wort auf die großen Liebenden aus Mythos, Literatur und Geschichte“ beziehe, „als gelte es, jede Verwechslung von Topoi und Klischees mit der eigenen Geschichte zu meiden“, konterkariert ein kurzer Blick in sein Büchlein dieses Urteil: „Auf dem Papier war ich in der Lage aufzuzeigen – unter Berufung auf Hero und Leander, Tristan und Isolde, Romeo und Julia -, dass die Liebe die gegenseitige Faszination zweier Personen ist, mit allem, was an ihnen am wenigsten sagbar, am wenigsten sozialisierbar ist und was sich den Rollen und Selbstbildern, die die Gesellschaft ihnen aufzwingt, sowie den kulturellen Zugehörigkeiten widersetzt.“ (23) Ist es nur eine merkwürdige Koinzidenz, dass alle Paare, die Gorz als Zeugen seiner Liebestheorie „auf dem Papier“ anruft, vor allem durch ihren Liebestod ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind? Beunruhigend ist eine Synopse dieser Geschichten vor allem deswegen, da durch sie zu Tage tritt, dass es nicht die äußeren Hindernisse sind, die letzten Endes zum Tode führen, sondern dass der Tod jener Form von Liebe inhärent ist. Beinahe allen erwähnten Paaren stünde die Möglichkeit offen zu fliehen und außerhalb ihrer Herkunftsfamilie und Gesellschaft ein neues Leben zu gründen. Vrenchen und Sali in Gottfried Kellers „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ gehen nicht an einem Irrtum zugrunde, sondern ziehen den gemeinsamen Tod einem gemeinsam Leben ohne den Rückhalt der bürgerlichen Gesellschaft, ohne die Institution der Ehe und materielle Sicherheit vor. Leidenschaft allein, das wissen hier schon die Kinder, wird ihre Liebe nicht tragen können. In Wagners „Tristan und Isolde“ ist die Liebe der Katalysator des Todes, das Quietiv des Willens zum Leben. Als Isolde zu ihrem Geliebten zurückkehrt und sie gemeinsam leben könnten, reißt sich Tristan die Wundverbände herunter, um endlich sterben zu können: „Heia, mein Blut! Lustig nun fließe!“[2] Das Reich der Nacht, des Todes und der Mutter wird zum locus amoenus, zum Ort ewiger Verschmelzung. Sie funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip: Wo Ich war, soll Es werden. Unglücklich ist jeder auf seine eigene Art, während alle glücklichen Paare einander gleichen einander, deswegen haben sie keine Geschichte. „Eine gescheiterte, unmögliche Liebe dagegen ergibt edle Literatur“ (57), das weiß selbst Gorz. Doch die „edle Literatur“ erweist nicht die Liebe als unmöglich, sondern die Welt, das zeigen uns die Paare, die ohne einander nicht weiterleben wollen, ist es ihnen nicht wert, in ihr zu leben. „Kürzlich habe ich mich von neuem in D. verliebt, und wieder trage ich in der Brust diese zehrende Leere, die einzig die Wärme Deines Körpers an dem meinen auszufüllen vermag.“ (S.5) Was der Nachwelt als große Liebe dünkt, ist nur der jähe Tod auf dem Höhepunkt von Idealisierung und Symbiose. Werden die Liebenden einander zu Erlösern aus einer schlechten Welt, ist ihr Schicksal schon besiegelt. Die Dramaturgie ihrer Liebesgeschichte verlangt ihren Tod, bevor sie wieder zu gewöhnlichen Menschen werden. Ließe der Tod auf sich warten, so würden wir Zeugen davon, wie das vollkommene Bild Risse bekäme, die schöne Illusion bröckelte, die Idealisierung sich nicht aufrechterhalten ließe. Dann käme das Menschliche hervor unter den vollkommenen Zügen der Aphrodite von Milo. Es gibt einen schönen Satz von Botho Strauss: „Die Liebe ist immer nur des geliebten Lebens kleinere Schwester.“ Er reiht sich ein in die Tradition, die vom Alten Testament bis zu Erich Fromm reicht und deren einfache Lehre lautet: Liebe zu einem anderen Menschen kann nie die Selbstliebe oder die Liebe zur Welt und zum Leben ersetzen. Ein Mensch kann nie ausgleichen, was alle anderen zunichte machen. Es gibt kein „Herz der herzlosen Welt“, wie es in einem Gedicht von Erich Fried heißt. Der Geliebte ist nie der Messias, der uns erlöst. Das vielleicht einzige Beispiel einer Liebe, die durch ein ganzes Leben hindurch blüht und wächst, geben in der Literatur Philemon und Baucis, denen die Götter ihren größten Wunsch – im selben Augenblick zu sterben, um nicht ohne einander sein zu müssen – erfüllen. Sterbend werden sie in Bäume verwandelt und bleiben im Tod „Stamm neben Stamme sich nah, aus beiden Körpern gewachsen.“[3] Der Vergleich mit Gorz und Dorine, die Hand in Hand aufgefunden wurden, liegt nahe und so haben ihn viele Nachrufe eilfertig gezogen. Der wesentliche Unterschied aber ist offensichtlich: Nicht nur begehen Philemon und Baucis keinen Selbstmord, sondern ihr Tod als Gnadenakt ist ein Geschenk dafür, dass sie die Götter, als diese verkleidet zu ihnen kamen, mit Liebe bei sich aufgenommen haben. Ihre Liebe zueinander wird belohnt, weil sie die Liebe zur ganzen Welt in sich einschloss. Dass es sich bei den Gorz´ so verhielt, ist zumindest zweifelhaft, scheint es doch so, dass zumindest er seine Liebe nicht durch Teilung vermehren konnte. So gab er in einem Interview mit „Libération“ an, dass das Paar keine Kinder bekommen habe, weil er sonst eifersüchtig gewesen wäre: „Ich wollte Dorine für mich alleine haben.“ Während Dorines Bedürfnisse sich von den seinen vollkommen verzehren ließen – „Einen Schriftsteller lieben heißt lieben, dass er schreibt, sagtest Du.“ (32) – gelingt es Gorz nicht einmal dort, wo es um seine Arbeit geht, die Grenzen seines Ich zu transzendieren. Der Mann, der immerhin als „Sozialphilosoph“ bekannt geworden ist, sagt von seiner Arbeit mit der größten Selbstverständlichkeit: „Das Sagen ist wichtig, nicht das Gesagte“ (53). „Nicht was er schreibt, ist das vorgängige Ziel des Schriftstellers. Sein vorrangiges Bedürfnis ist das Schreiben. (...) Jedes Thema ist tauglich, sofern es das Schreiben ermöglicht.“ (33) Das Schreiben ist wichtiger als das Geschriebene, denn in ihm stößt der Schreibende auf sich selbst, erfährt sich selbst als Schreibenden. Was der derartig von seinem Sujet verlassene Schriftsteller versucht, ist eigentlich die Objekthaftigkeit der Welt, ihr ständiges Antwortengeben auf Fragen, die wir noch nicht einmal gestellt haben, loszuwerden. Aber selbst im leeren Schreiben bleibt noch ein Rest Welt erhalten, den es abzuwerfen gilt: „Mit Dir konnte ich meine Wirklichkeit vergessen. Du warst die ideale Ergänzung des ununterbrochenen Schreibens, mit dem ich mich seit sieben oder acht Jahren bemühte, mein wirkliches Dasein loszuwerden.“ (23f) Während das Schreiben also die Weltflucht erster Ordnung war, wird die „Liebe“ zu „D.“ die Flucht aus der Flucht, eine Flucht zweiter Ordnung, ein potenzierter Weltverlust, wie man in Anlehnung an Hannah Arendt formulieren könnte. Wenn das Sagen Gorz aber wichtiger ist als das Gesagte, so kann sein „Brief“ a priori keine Nachricht sein, keine späte Erwiderung der Liebe seiner Frau, sondern lediglich das zufällig abfallende Produkt eines Schreibprozesses, in dem Gorz sich immer nur selbst begegnet. „Ist es nicht Zeit, daß wir liebend uns vom Geliebten befrein?" hatte Rilke in der Ersten Duineser Elegie gefragt und das objektlose „In-der-Liebe-sein“ der Philosophie erneut ins Gedächtnis gerufen. Gorz erfindet die Intransitivität des Schreibens und ist zugleich der intransitiven Liebe verfallen. Auf den Anderen kommt es in der Liebe nicht an, solange er dem Selbst nur Anlaß gibt, sich als Liebenden zu erfahren. Deshalb ist „die Entdeckung der Liebe“ immer „mehr“ als die „Liebe“ selbst, sie ist „die Triebfeder einer existentiellen Bekehrung“ (S. 55, Hervorhebung von mir, T.N.T.). Die Erfahrung des Ich ist zugleich das Zentrum von Gorz´ Existenz und ein leerer Raum, den er vergeblich zu füllen sucht. Schwer erträglich ist manchmal die Erzählung von einschneidenden Ereignissen, banalen Urteilen und narzißtischen Ritualen, die Gorz nebeneinander stellt, als bestünde ein logischer Zusammenhang zwischen ihnen. Nachdem bei Dorine Krebs diagnostiziert wurde, schildert er seine Reaktion: „Ich habe Deinen Namen in Stein gemeißelt. Es war ein magisches Haus. Alle Räume waren trapezförmig.“ Das Nebeneinander der Parataxen verrät den Gorz´schen Budenzauber: Seine Frau ist lebensbedrohlich erkrankt. Er flieht in eine rituelle Handlung, einem verliebten Pennäler gleich, dessen geballte Passivität sich darin entlädt, dass er den Namen seiner Geliebten in einen Stein ritzt. Denselben Namen übrigens, den er dem Leser, der sonst alles wissen darf, so beredt verschweigt. Dignität gewinnt das Haus als „magisches“ – während die „Apparatemedizin“ zum Aggressor geworden ist, hält sich der Sozialphilosoph an ein Kultobjekt, das seinen Status erhält, weil die Wände nicht im 90 Grad Winkel zueinander stehen... (vgl. 76). Als Dorine im Krankenhaus operiert wird, hört Gorz nachts die „ganze Neunte Symphonie von Schubert“ (77) – der Erzähler führt den Leser nicht ans Bett der Kranken, sondern an das „offene Fenster“, an dem der Ehemann steht, der nun endlich die Gelegenheit ergreifen kann, in seiner Rolle als tragischer Liebender tiefe Gefühle zu entdecken. Schuberts letzte Sinfonie liefert die passende Untermalung zur Nachtwache. Auch hier ist die Liebe nicht die Liebe zu einer Person, sondern Anlaß, „Augenblicke von außergewöhnlicher Intensität zu erleben“ (78). (Dass das Leben, das Dorine hier „geschenkt“ wurde, der Verdienst der Medizin ist, darüber verliert Gorz kein Wort. Nachtigallen und die Hinwendung zur Ökologie stehen nun im Vordergrund.) „Du hast mir Dein ganzes Leben und alles, was Du bist, geschenkt; ich möchte Dir in der Zeit, die uns noch bleibt, alles von mir schenken können.“ (83). Ein Zyniker könnte entgegnen, dass ja nicht viel Zeit blieb, die Gorz opfern musste, um von den Liebes- und Pressegöttern exkulpiert zu werden. Ein rentables Tauschgeschäft. Der Liebesbeweis des gemeinsamen Todes ist immer mit weniger Aufwand verbunden als mit der Liebe zu leben. Während Gorz mit seiner Abbitte scheinbar das irreduzibel Besondere der Liebe anerkennt, verleiht er ihr im selben Augenblick eine Funktion, die sie zu einem Allgemeinen macht: sie ist, was seine Existenz bestimmt und erhält. Dorines raison d´être ist, seine raison d´être zu sein. Sie lebt gleichsam nur durch ihn. Die mit „D.“ apostrophierte Figur ist allein seine Imagination (und leider nicht einmal eine besonders originelle). Als Verleugnete hatte Dorine immer noch eine Existenz jenseits seiner Imagination, es bestand immerhin noch eine, wenn auch schmerzliche, Differenz zwischen ihr und ihrem Bildnis. Indem Gorz kurz vor ihrem tatsächlichen Ableben sich zu ihr bekehrt, löst er die Differenz endgültig auf und eignet sich die Interpretationshoheit nun völlig an. D und D´, beides Geschöpfe von Gorz, fallen nun zusammen. Doreen oder Dorine existiert überhaupt nicht mehr, weil der Kritik an seiner Missinterpretation, das Bewusstsein, dass Mensch und Bildnis nie zusammenfallen, das Wasser abgegraben ist. Ein Spezifikum des Liebestodes, wie wir es aus der Literatur kennen, ist, dass die Liebesbeziehung nicht Zweck an sich sein kann, sondern von der Sehnsucht, ewig zu leben, in Dienst genommen wird. Diese Ewigkeit wird häufig in der einer metaphysischen Stätte, in einem Jenseits, verortet – bei Gorz ist dies aber dezidiert nicht der Fall. Statt dessen ist die „Ewigkeit“ im öffentlichen Gedächtnis zu suchen: der Leser wird zum Zweitbestatter. Der Liebestod erfüllt also das verständliche und weit verbreitete, aber deswegen nicht weniger narzißtische Bedürfnis nach Immortalisierung. Die Konversion, die Gorz am Ende seines Lebens vollzieht, erfüllt nicht nur den Zweck, das Leben einer kritischen Revue auszusetzen, sondern es in einen neuen Deutungszusammenhang zu stellen, der dem alten Leben neuen Sinn verleiht. Durch das neue Leben wird auch das alte Leben ein neues, es wird zum Sockel, auf dem das Gebäude der neuen Erkenntnis notwendigerweise steht. Wenn Paulus, um Paulus zu werden, Saulus gewesen sein muss, legitimiert die Konversion den Zustand der Sünde als erlösungsnotwendig. Das Narrativ des Bildungsromans erfordert den tumben Tor, um bis zum Helden fortschreiten zu können. Gorz feiert im „Brief“ seine eigene Entwicklung. Dorine Gorz soll die Veröffentlichung des Bändchens übrigens unangenehm gewesen sein, aber sie akzeptierte die Entscheidung ihres Mannes. Diese Haltung ist, wenn man Gorz´ „Brief“ als verlässliche Quelle ansehen will, paradigmatisch für ihre ganze Ehe. Ob den Eigenheiten ihres schriftstellernden Gatten oder ihren körperlichen Schmerzen gegenüber: Dorine zeichnete sich stets durch duldsame Milde und Opferbereitschaft aus: „Du hast nie protestiert.“ (S. 29) Sie verdiente Geld in schlechten Zeiten, damit er schreiben konnte und unterstützte ihn später bei seiner Verlagstätigkeit. „Ich kann mir nicht vorstellen, weiter zu schreiben, wenn Du nicht mehr bist.“ (81) Narziß und Echo stehen Pate, nicht Philemon und Baucis. Das eigentlich Verblüffende an der ganzen Angelegenheit ist die Reaktion der Presse. Während es in den letzten Jahren zum Einmaleins des Genie-Bashing gehörte, Intimbeziehung zum Zeugen für charakterliche Schwächen aufzurufen, schweigen im Fall Gorz die Advokaten unterdrückter Weiblichkeit. Anders als Brecht, Picasso oder Heidegger wird Gorz nicht als narzißtischer Chauvinist demaskiert. Dem Unbehagen, das den einen oder anderen Rezensenten dann doch bei der Lektüre gekommen ist, sind jeweils nur die letzten Zeilen gewidmet. Jürgen Ritte erwägt kurz, ob es sich etwa um ein „Spiel mit Damenopfer“ handeln könnte. Da aber „D.“ „dazu stets geschwiegen“ hat, schweigt auch der Rezensent und läßt seinen Artikel an dieser Stelle enden. Elisabeth von Thadden stellt sich die Frage, ob „dieses weibliche Leben von D. nicht auch ein klassisches Selbstopfer für den denkenden Mann sei?“ und gibt die Antwort: „Aber so stellt sich die Frage angesichts dieses Paars eben nicht.“ Warum nicht? – Nimmt vielleicht die Abbitte, die Gorz in seinem „Brief“ leistet, den Journalisten den Wind aus den Segeln? Oder ist die Sehnsucht, endlich ein Beispiel für lebenslanges Liebesglück zu haben, so groß? |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/53/tt1.htm
|
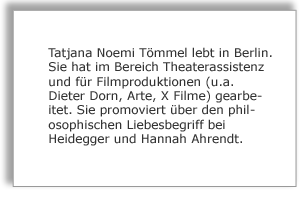 Nun teilen sie ein Schicksal mit Alcyone und Ceyx, Hagbard und Signy, Tokubei und Ohatsu, mit Hero, Leander, Tristan und Isolde: am 22. September 2007 nahmen sich André Gorz und seine schwerkranke Frau Dorine das Leben.
Nun teilen sie ein Schicksal mit Alcyone und Ceyx, Hagbard und Signy, Tokubei und Ohatsu, mit Hero, Leander, Tristan und Isolde: am 22. September 2007 nahmen sich André Gorz und seine schwerkranke Frau Dorine das Leben.