
Religiöse Räume |
Erfahrungen ermöglichen
Zum Themenheft "Religiöse Räume"Andreas Mertin / Jörg Mertin Das vorliegende Heft des Magazins für Kunst, Kultur, Theologie und Ästhetik verdankt sich zum einen der langjährigen Beschäftigung mit dem Thema „Krankenhauskapellen“, zum zweiten der Begleitung eines konkreten Kunstprojekts in diesem Kontext und zum dritten der grundsätzlichen Beschäftigung mit den Fragen des religiösen Raumes im Unterschied zum heiligen Raum bzw. dem Sakralraum respektive des konfessionsspezifischen Raumes.
Dass Künstler nicht in der Funktion der ancilla ecclesiae im Auftrag der Kirche arbeiten, sondern eigenständig und frei Inhalt und Form einer Kapelle bestimmen, ist das Ergebnis eines Jahrhunderte währenden Prozesses, den man vielleicht mit der Renaissance beginnen lassen könnte und der in der Gegenwart noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Albrecht Dürers Selbstporträt im Stil einer Christusdarstellung ist vielleicht ein frühes Zeugnis dieser beginnenden autonomen künstlerischen Intervention in den religiösen Raum. Immer dort, wo man von Gestaltung, Ausdruck und Darstellung spricht, ist man dagegen immer noch im Bereich der alten Unterordnung der künstlerischen Arbeit unter das religiöse Programm. Es fällt offenkundig immer noch einigen Menschen im 21. Jahrhundert schwer, dieses Denkmodell – das ja auch dem religiösen Kunsthandwerk zugrunde liegt – zu verabschieden. Sie verstehen religiöse Räume weiterhin als von Künstlern nach theologischen Vorgaben gestaltete Räume. Erinnert sei aber daran, dass die zentralen in der Bibel beschriebenen Verortungen der Religion nicht nach theologischen Vorgaben erfolgten, sondern elementare sinnliche Vorgänge waren. Erst später mit einer sich entwickelnden politischen Theologie und damit einer Theologie der Macht wurde die Gestaltwerdung der Religion unter- und nachgeordnet. Aus Erfahrung wurde Ostentation. Seitdem Friedrich Schiller und ihm folgend die Romantiker unter Bezug auf Immanuel Kant die Kunst als freies Spiel bestimmten und gerade in dieser Freiheit den unersetzbaren (!) Beitrag der Kunst für das menschliche Leben bestimmten, ist die Frage der Bedeutung der Kunst für die Religion ebenso virulent wie offen. Deutlich ist seit dem 20. Jahrhundert, dass in der Kunst kein Ort göttlicher Offenbarung zu denken ist. Das ist eine genieästhetische Verirrung und läuft zudem der modernen Diskursdifferenzierung zuwider. Statt dessen ist die Kunst radikal menschlich zu denken und gerade darin in religiöser Perspektive Ernst zu nehmen. In der Kunst wird nach Karl Barth, "die Problematik der Gegenwart gerade darum und darin ernst genommen, dass sie in ihrer Beschränktheit eingesehen, dass sie in der Aisthesis grundsätzlich überboten wird ... Das Wort und Gebot Gottes fordert Kunst". Aber eben nicht als Ausdruck von Religion, sondern grundsätzlich als Kunst in ihrer Kunsthaftigkeit. Wenn also Kunst nicht mehr als Ornament einer Institution dient, nicht zur Ostentation und damit zum Aufweis von Macht und Stärke, sondern wenn in der Kunst selbst eine grundsätzliche und durch die formale Sprache nicht substituierbaren Eigenständigkeit zur Geltung kommt, dann und nur dann wird sie auch religionsproduktiv. Überall dort, wo wir der Kunst selbst zutrauen und zumuten, unmittelbare und zugleich reflektierte Erfahrungen zu generieren, die Menschen in ihrer Aisthesis unvermittelt anzusprechen und Erfahrungsprozesse auszulösen, dort nähern wir uns der modernen künstlerischen Geistesgegenwart. Mit diesem Heft beziehen uns auf die vielleicht etwas provokativ anmutende, in der Sache aber wohl begründete These, dass heute nur noch freie Künstler und Architekten (und nicht die durch die Religionen gebundenen) solche Räume schaffen können, die gleichzeitig religiös, interreligiös und interkulturell bedeutsam sind. Und das geschieht nicht, indem Künstler in traditioneller Weise religiöse Symbole aufgreifen und somit Religion illustrieren, sondern es geschieht, indem sie konsequent gemäß ihrer Profession arbeiten und Wahrnehmungs- und Erfahrungsräume eröffnen.
Die Bedeutung der Gegenwartskunst für die Weltreligionen und den interkulturellen Dialog liegt deshalb darin, dass sie gerade im Beharren auf den Kunstcharakter der Kunst den ideologischen Symbolismus unterläuft, in den sich die Religionen verstärkt in den letzten Jahren in ihrer oberflächlich verdeckten und fundamentalistisch abgewehrten Schwäche zurückgezogen haben. Die Kunst unterstellt einerseits die Kraft der Religionen und ordnet ihre Elemente in neuen Konstellationen an. Andererseits schafft die Kunst aus sich heraus so etwas wie eine autonome Spiritualität, eine besondere Erfahrbarkeit des Ortes und des Raumes und der Materialität. Beide Aspekte zusammen befördern schöpferische Transformationen, in denen eine andere Form der Identität ausprobiert werden kann: ohne Angst Wahrnehmungen zu erweitern, verschieden zu leben und das Leben zu bereichern. Wer jedoch landauf landab auf die Umgestaltungen von Kirchenräumen blickt, die inzwischen den Neubau von Kirchen nahezu vollständig abgelöst haben, stößt auf eine merkwürdige Ausdrucks- und Gefühlskälte in der Raumgestaltung. Perfekt werden hier inzwischen Funktionalräume geschaffen und gestaltet, die auf eine fatale und erschreckende Weise erfahrungslos sind. Genauer: sie werden so gestaltet, dass sie zu bestimmten erwünschten Wahrnehmungen führen und gerade keine wirklichen Erfahrungen (die immer Widerfahrnisse sind) ermöglichen. Und dort wo Künstlerinnen und Künstler Räume so erarbeiten, dass sie zu eigenständigen Erfahrungen führen könnten, weil sie die Subjektivität des Betrachters mit einem neuen Wahrnehmungspotential konfrontieren, genau dort wird mit einem eingeschliffenen Zeichenarsenal der befürchtete „Schaden“ des nicht kontrollierten und nicht kontrollierbaren Erfahrungsangebots eingegrenzt. Dass die Menschen auch in einer weiterhin zunehmend funktionalisierten Welt abweichende Erfahrungen machen können, ist vielleicht gar nicht erwünscht. Statt dessen wird dann gegenüber Künstlerinnen und Künstlern auf das missverständliche „Form-follows-function“-Argument von Louis Sullivan verwiesen. Nun ist dieses Argument aus Architektur und Design für die Kunst nicht tragfähig, denn die notwendige ästhetische Zwecklosigkeit kollidiert mit der eingeforderten Bindung an die kirchliche Funktion. Grundsätzlich ist die Forderung „Form-follows-Function“ in der Kirche zwiespältig, denn nirgendwo trifft man auf so viel Ornament wie im kirchlichen Funktionalismus. Man kann aber fragen, ob diese Funktionalisierung mit dem, was zentraler Gehalt von Religion ist, überhaupt vereinbar ist. Denn auch die Religion thematisiert und ermöglicht eine bestimmte neue Erfahrung mit der Welt, Religion widerspricht der Kolonisierung der Lebenswelten im Sinne der Zweckrationalität. Funktional ist das Kreuz nur für Fundamentalisten. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/54/mm4.htm
|
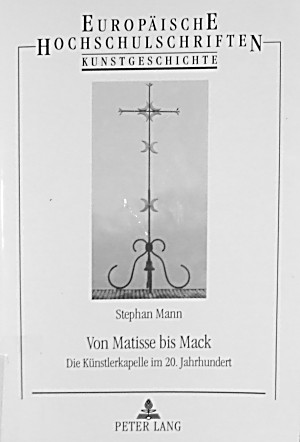 Hinzu kommt das Interesse dafür, wie Künstlerinnen und Künstler heute aus ihrer Perspektive mit dem religiösen Raum umgehen, was sie inspiriert, welche Strategien sie verfolgen und wie sie ihre Arbeit für derartige Räume sinnenfällig machen. Seit knapp 60 Jahren gibt es das Phänomen der so genannten Künstlerkapelle im modernen, autonomen Sinn. Einschlägig für die Auseinandersetzung zu diesem Thema ist Stephan Manns Doktorarbeit „Von Matisse bis Mack. Die Künstlerkapelle im 20. Jahrhundert“ aus dem Jahr 1996. Er zeigt an Beispielen von Matisse, Cocteau, Rothko, Corbusier, Wotruba, Mack, Picasso, Ackermann und Chagall die unterschiedlichen Typen der von Künstlern gestalteten religiösen Räume auf. Natürlich gibt es darüber hinaus noch hunderte von Kirchen, die von zeitgenössischen Künstlern gestaltet wurden. Von Künstlerkapelle im engeren Sinne sollte man aber dann sprechen, wenn der Künstler auf die architektonische wie die künstlerische Konzeption grundlegend Einfluss genommen hat. Das ist bei den im vorliegenden Heft als Beispielen aufgeführten Kapellen der Fall.
Hinzu kommt das Interesse dafür, wie Künstlerinnen und Künstler heute aus ihrer Perspektive mit dem religiösen Raum umgehen, was sie inspiriert, welche Strategien sie verfolgen und wie sie ihre Arbeit für derartige Räume sinnenfällig machen. Seit knapp 60 Jahren gibt es das Phänomen der so genannten Künstlerkapelle im modernen, autonomen Sinn. Einschlägig für die Auseinandersetzung zu diesem Thema ist Stephan Manns Doktorarbeit „Von Matisse bis Mack. Die Künstlerkapelle im 20. Jahrhundert“ aus dem Jahr 1996. Er zeigt an Beispielen von Matisse, Cocteau, Rothko, Corbusier, Wotruba, Mack, Picasso, Ackermann und Chagall die unterschiedlichen Typen der von Künstlern gestalteten religiösen Räume auf. Natürlich gibt es darüber hinaus noch hunderte von Kirchen, die von zeitgenössischen Künstlern gestaltet wurden. Von Künstlerkapelle im engeren Sinne sollte man aber dann sprechen, wenn der Künstler auf die architektonische wie die künstlerische Konzeption grundlegend Einfluss genommen hat. Das ist bei den im vorliegenden Heft als Beispielen aufgeführten Kapellen der Fall. Die in diesem Heft vorgestellten Beispiele aus den letzten 50 Jahren machen jedenfalls Mut dazu. Es beginnt mit der Kapelle von Henri Matisse, die noch am nächsten dem Modell der kirchlichen Auftraggeberschaft ist, aber dennoch bereits eine eigenständige und vom Künstler getragene Raum- und Kunstlösung ist. Und es setzt sich fort mit Mark Rothkos Kapelle in Houston, die als erste autonome Lösung anzusehen ist und zugleich das Modell der Öffnung für das Interreligiöse darstellt. Günther Ueckers Kapelle im Reichstag ist der Versuch, gleichzeitig spezifisch religiös wie interreligiös zu sein, also nicht in der Abstraktion die Lösung zu sehen, sondern in spezifischen Realisierungsmöglichkeiten für die Religionen. Thierry DeCordiers im letzten Jahr fertig gestellte Kapelle des Nichts kontextualisiert sich in religiöser Umgebung und ist zugleich doch radikal autonomes Werk. Und Susanne Tunns Kapelle eröffnet ausgehend vom künstlerischen Material einen Erfahrungsraum, den man ästhetisch erschließen und zugleich religiös qualifizieren kann.
Die in diesem Heft vorgestellten Beispiele aus den letzten 50 Jahren machen jedenfalls Mut dazu. Es beginnt mit der Kapelle von Henri Matisse, die noch am nächsten dem Modell der kirchlichen Auftraggeberschaft ist, aber dennoch bereits eine eigenständige und vom Künstler getragene Raum- und Kunstlösung ist. Und es setzt sich fort mit Mark Rothkos Kapelle in Houston, die als erste autonome Lösung anzusehen ist und zugleich das Modell der Öffnung für das Interreligiöse darstellt. Günther Ueckers Kapelle im Reichstag ist der Versuch, gleichzeitig spezifisch religiös wie interreligiös zu sein, also nicht in der Abstraktion die Lösung zu sehen, sondern in spezifischen Realisierungsmöglichkeiten für die Religionen. Thierry DeCordiers im letzten Jahr fertig gestellte Kapelle des Nichts kontextualisiert sich in religiöser Umgebung und ist zugleich doch radikal autonomes Werk. Und Susanne Tunns Kapelle eröffnet ausgehend vom künstlerischen Material einen Erfahrungsraum, den man ästhetisch erschließen und zugleich religiös qualifizieren kann.