
Landschaften |
Ein Leben ohne Religion nötigt den Menschen zum RealismusGespräch mit Dieter WellershoffHorst Schwebel
Aber ich habe in meinen Büchern nie ausdrücklich über christliche Glaubensinhalte gesprochen. Wenn christliche Themen oder Glaubensinhalte bei Ihnen nicht vorkommen, bedeutet das, daß solche Fragen für Sie nicht relevant sind? Das Christentum antwortet auf fundamentale menschliche Erfahrungen, auf die ich auch antworte. Aber seine Hauptantworten, die christlichen Glaubensinhalte, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich glaube nicht an einen persönlichen Gott, nicht an die Auferstehung des Fleisches und nicht an ein ewiges, jenseitiges, wahres Leben. Die Vorstellung eines Lebens nach dem Tode ist so unwahrscheinlich, daß man die grandiose Phantasieleistung bewundern muß, die diesen Gedanken hervorgebracht hat. Es ist eine phantastische Abwehrleistung in der Auseinandersetzung der Menschheit mit dem Tod. Meinen Sie, daß die Religion eine Art Opium des Volkes ist? Ja, insofern Opium betäubt, Schmerzen lindert, die sonst unerträglich wären, und auch, indem es phantastische imaginäre Wunscherfüllungen erträumen hilft, ferne Seligkeiten, in die man sich flüchten kann. Andererseits - und das widerspricht diesem bloß passiven Aspekt, der in dem Begriff Opium steckt - hat die Religion mit dem Versprechen einer Erlösung und einer späteren, alles versöhnenden, postmortalen Existenz den Menschen geholfen, Ungerechtigkeit, Krankheit, Elend und Tod, das heißt alle Lasten ihrer konkreten Existenz zu ertragen, ohne zusammenzubrechen. Jenseitshoffnungen haben so trotz ihrer Irrealität einen praktischen, realistischen Aspekt. Es gibt Personen, die sich nicht primär an den Jenseitsvorstellungen orientieren - Luhmann etwa -, die aber trotzdem Religion für äußerst wichtig erachten, als eine Form der Kontingenzbewältigung, wenn dem Menschen ein unvorhersehbarer Schicksalsschlag - der Tod eines Angehörigen, eine unheilbare Krankheit usw. - trifft. Hier wird die Religionsfrage nicht in Hinsicht auf eine postmortale Existenz gestellt, sondern in bezug auf die Bewältigung einer konkreten, seelisch angespannten Lebenssituation. Wenn man die metaphysischen Glaubensinhalte wegstreicht, dann verschwimmt die Religion nahezu ununterscheidbar mit Ethik, Humanität, Existenzphilosophie und persönlicher Sinnsuche und Weisheit. Gewisse Vorstellungen, denen man früher anhing, können und wollen wir heutzutage nicht mehr aufrechterhalten. Das christliche Existenzverständnis ist nicht identisch mit dem Weltbild der Spätantike oder des Hochmittelalters. Man muß das trennen können. Ich weiß, es gibt eine starke Tendenz zur Entmythologisierung, von Bultmann bis zu J. A. T. Robinson und Dorothee Solle. Möglicherweise kommt jetzt das Diesseits stärker in den Blick. Man ist darum bemüht, bei theologischen Aussagen die Lebenswirklichkeit des heute lebenden Menschen stärker zu berücksichtigen, so daß die theologische Aussage - im Sinne von Tillich - tatsächlich Antwort auf eine vom Menschen gestellte, aus seiner Lebenssituation erwachsene Anfrage ist. So ist es auch zu erklären, daß in einigen Formen der Theologie Gott zur Chiffre für das Du der Mitmenschlichkeit, oder als Zuspruch von Sinn angesichts des Sinnverlustes wird. In diesen Beispielen handelt es sich um reduzierte Formen. Sehr reduzierte. Diese Spiritualisierung Gottes zur Metapher ist die aktuelle Form seines Verschwindens. So sublimiert ist er dann für Intellektuelle, die - aus welchen Gründen auch immer - noch im Traditionshorizont des christlichen Glaubens bleiben wollen, gerade noch erträglich. Aber man sollte nicht von Spiritualismus reden, wenn massive Vorstellungskomplexe, die das christliche Existenzverständnis lediglich belasten, ohne einem Menschen konkret zu helfen, abgebaut werden. Bis dahin würde Bultmann auch gehen. Das Gemeinsame neuerer Theologien besteht darin, daß sie so von Gott reden, daß sich dieses Reden deckt mit etwas, das immanent erfahrbar ist. Der Zuspruch eines Menschen etwa, der ist erfahrbar, während es auch ein Reden über Gott gibt, das außerhalb des menschlichen Erfahrungsbereiches und darum stark spekulativ ist. Aber das hat eine merkwürdige Sprachspaltung hervorgebracht. Ich habe das vor Jahren auf einer Tagung erlebt, an der Theologen, aber auch gläubige Laien teilgenommen haben. Die Intellektuellen, das heißt die Theologen, verständigten sich auf diese spirituelle Weise. Für sie war Gott ein alter Name, der nichts anderes bedeutete als die Liebesbeziehung der Menschen. Der alte, der persönliche Gott, an den man sich doch einmal wie an einen Vater im Gebet gewendet hat, blieb wie ein ehrwürdiges metaphysisches Wappentier im Dunkel. Aber für die Laien waren die alten Glaubensinhalte noch in kompakter, anschaulicher Form präsent. Da gab es noch den persönlichen Gott, den Gottvater, die Auferstehung, den Himmel, und die Theologen bemühten sich dann, so mit diesen Laien zu sprechen, daß keine Konflikte entstanden. Sie beugten sich gewissermaßen aus ihrem besseren Wissen zu ihnen herab. Würden Sie diese Art Sprachregelung als doppelzüngig abtun und hier auf Entscheidung drängen, wie man nun sprechen sollte? Ich spreche für mich. Wenn man diese Sprachregelung einmal miterlebt hat, kann man sie nicht mehr gut mitmachen. Sie mag noch einen pragmatischen, seelsorgerischen Sinn haben. Aber ich fürchte, wenn die christliche Verkündigung zur bloßen Rhetorik verkommt, dann verliert sie auch ihre Kraft. Sie klingt dann hohl, formal, metaphorisch, und man beginnt sich zu fragen, warum die Diskussion aktueller Lebensfragen, um die es ja in der Predigt auch immer wieder geht, über alte mythologische Vorstellungen umgeleitet werden muß, welchen Grund es dafür gibt. Weil es die traditionelle Sprache der Kirche ist, wird sie eben weitergesprochen. Egal wie's klingt angesichts der Wirklichkeit und ihres Widerspruchs. Am schlimmsten finde ich es immer bei Beerdigungen. Da wird das alte Versprechen des ewigen Lebens wie eine verblichene Fahne über dem Grab geschwenkt, und es herrscht ein stillschweigendes Einverständnis und ein anständiges Verschweigen der Tatsache, daß kaum noch einer daran glaubt. Die Menschen nehmen ihre Kraft zum Weitermachen anderswoher, vielleicht aus ihrer Vitalität, oder der Gewohnheit, oder dem Fatalismus, und aus den Mechanismen der Verdrängung, einschließlich der Beruhigungspillen der pharmazeutischen Industrie. Aber Sie beschäftigen sich doch mit ähnlichen Fragen. Nicht nur Gott als abstrakte Chiffre ist das Thema der Religion, sondern der Mensch, wie er lebt, wie er sich selbst versteht, wie er sein Verhältnis zum Du versteht, ob er sich vom Du getragen weiß oder das Du als feindlich oder bedrohlich erfährt. Die Bedrohung des Menschen ist ein Problem, das in der Religion eine zentrale Rolle spielt. Es spielt bei Ihnen - ohne Umleitung über alte mythologische Formeln - ebenfalls die zentrale Rolle. Aber ich sehe alle Probleme des Lebens bewußt als innerweltliche Probleme. Dann sind sie nämlich hart und unaufschiebbar gestellt, wie in einem Boxring, der ringsum von Seilen begrenzt ist und von Dunkelheit. Ich finde, es ist wichtig zu wissen, daß es keinen späteren Ausgleich für Unglück, Leiden, Benachteiligungen und eigenes Versagen gibt. Diese tröstlichen Illusionen verschleiern uns unsere wirkliche Lage und deshalb vielleicht auch unsere wirklichen Möglichkeiten. Vielleicht kann man sagen, daß Religion eine notwendige Phase der Gattungsgeschichte war. Die Menschheit konnte nicht aus der Unbewußtheit ihrer vorgeschichtlichen Anfänge erwachen und Tod und Ungerechtigkeit und Leiden als Bedingungen der Existenz begreifen, sie mußte diese Widersinnigkeiten einbetten in einen Sinn. Nur dadurch konnte sie auch die ungeheuren Lasten der Kultur, das heißt Arbeit, Verzicht, Unterdrückung und Selbstentfremdung, ertragen. Die Religion hat die notwendige Legitimation und den notwendigen Trost geliefert. Das hat die Menschen zu großen Leistungen befähigt, hat sie aber auch bei der Stange und im Joch gehalten, wenn sie den Karren der Privilegierten zogen. Sie würden also sagen, daß wir uns in einer nachchristlichen bzw. einer nachreligiösen Situation befinden. Für den Theologen hängt viel davon ab, ob Theologie nur an bestimmte Zeitbedingungen gebunden ist und dann einmal - wie alles Zeitliche - aufhören wird, oder ob es sich um eine Angelegenheit handelt, die die Zeit überdauert. Ja, ich denke, wir leben in einer nachreligiösen Zeit. Wir haben durch Wissenschaft und Technik mehr Mittel der praktischen Daseinsbewältigung dazugewonnen, aber als Konsequenz die Seelenhilfe der Religion dagegen eingetauscht. Ist der Mensch, der die Stangen der Religion nicht mehr hat, überhaupt dazu in der Lage, durch sein Leben hindurchzukommen? Ist der Mensch seelisch überhaupt fähig, religionslos zu sein? Oder geschieht in dem Augenblick, wo er solcher transzendentaler Vergewisserung entledigt wird, ein Sturz in den Abgrund? Ein Leben ohne Religion nötigt den Menschen zum Realismus, das heißt zur uneingeschränkten, unbeschönigten Wahrnehmung der Bedingungen seiner Existenz. Und das ist eine gewaltige Zumutung. Man muß akzeptieren, daß man stirbt und für alle Ewigkeit ohne Widerruf aus dem Sein verschwindet. Man muß das akzeptieren, obwohl auch die gewährte einmalige Chance zur Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, die unser Leben ist, beeinträchtigt, verkürzt oder zunichte gemacht werden kann durch Umstände, Bedingungen, Ereignisse, denen wir ausgesetzt sind und die wir zum größten Teil kaum beeinflussen und ändern können. Man kann sich seine Eltern nicht auswählen. Und in der Kindheit werden ja schon unsere späteren Glücks- und Unglücksmöglichkeiten vorgeprägt. Oder man wird durch fremde Schuld in einen Verkehrsunfall verwickelt und verbringt- den Rest des Lebens im Rollstuhl. In den Krankenhäusern sterben junge Menschen an unheilbaren Krankheiten. Sind sie schuld daran? Selbst wenn man annimmt, daß Krankheiten die Konsequenzen eines falschen Lebens sind, hätten sie dieses Leben ändern können? Hatten sie die Freiheit, die Kraft dazu, etwas zu ändern? Oder denken Sie an kollektive Katastrophen wie den Krieg. Die modernen Vernichtungsmittel, die dem Individuum und seiner Selbstbehauptung keine Chance lassen, repräsentieren die Blindheit und Gleichgültigkeit eines solchen Geschehens. Aber auch früher war es eher Zufall, wer überlebte und wer nicht. Vielleicht ist auch Glück zunächst einmal Zufall, so wie es der alte Begriff der Fortuna meinte. Das Rad dreht sich, die einen werden nach oben getragen, die anderen stürzen ab. Neben den Friedhöfen, natürlich mit etwas räumlichem Abstand, aber prinzipiell dicht beieinander, liegen die Tennisplätze, die Tanzcafes, die Restaurants für Feinschmecker. Adorno hat einmal gesagt: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Dieses Wort erneuert den alten religiösen Anspruch auf einen universalen Ausgleich. Man kann es auch als moralisches Postulat verstehen: Die Menschheit soll sich als Überlebensgemeinschaft begreifen, in der Glück und Unglück geteilt werden. Aber als Aussage über das faktische Leben ist dieses Wort falsch. Es gibt nämlich durchaus individuell geglücktes Leben mitten im allgemeinen Unglück. Es gibt Gesunde und Kranke, es gibt Menschen, die sich entfalten, und Menschen, die verstümmelt werden. Und das Unglück ist schlimmer, nämlich uneinsehbarer, ungerechter, wenn andere glücklich sind, und skandalöserweise gewinnt Glück sogar an Tiefe und Kostbarkeit, weil es das Unglück und den Tod gibt. Sie schildern jetzt die menschliche Situation in einer ganz bestimmten Ausweglosigkeit, als sei alles determiniert: der eine kommt aus dem Haus, wo die Armen sind, der andere aus dem Haus, wo die Reichen sind. Und verschiedene Ausgangssituationen sind Chancen zu mehr oder weniger Freiheit. Der eine kommt aus dem Haus der gesunden, glücklichen Eltern, der andere aus dem Haus der neurotischen, unglücklichen, wahnhaften Eltern. Und der eine wird Freiheit haben, sein Leben zu gestalten, der andere ist schwer geschädigt und auf weiteres Unglück abonniert. Das ist das weiterwirkende Unglück, das die Religion unter dem Begriff der Erbsünde erfaßt hat. Die vulgären Glückverheißungen unserer Reklame leugnen übrigens das Verhängnis der Vergangenheit. Da gibt es keine Erbsünde, sondern offenbar gleiche Angebote für alle, glücklich und erfolgreich zu sein. Realistische Literatur kann dagegen am Begriff der Erbsünde anknüpfen und im Individuellen und Besonderen weiterwirkende Zusammenhänge des Unglücks aufspüren. Wir erben die Unglücksstrukturen, wir lernen unser Unglück und vollziehen es blind, ohne es zu durchschauen. Wir können es oft ja nicht einmal anschauen, nur leben. In der Literatur, wie ich sie verstehe, werden alle diese Möglichkeiten erfahrbar und anschaubar. Sie muten dem Menschen etwas Großes zu. Ist dies eine Art Psychoanalyse? Nicht im engeren Sinne. Denn ich lasse ja nicht den Leser seine geheime Geschichte erzählen, sondern erzähle Geschichten. Aber der Leser muß diese Geschichten mit seinen Erfahrungsmöglichkeiten realisieren. Dabei erfährt er sich dann auch selbst. Er wird durch die fiktionalen Figuren über seine eigene begrenzte praktische Erfahrung hinausgeführt. Das ist ein anderes Verfahren als die Psychoanalyse. Aber es erneuert und erweitert auch die Wahrnehmung des Lebens und die Selbsterfahrung. Was die Psychoanalyse als Verdrängung und Krankheit beschreibt oder was das Christentum als Sünde beschreibt oder die Existenzphilosophie als Verfallen des Daseins in das Man, in die Uneigentlichkeit, oder was in der marxistischen Philosophie als Entfremdung des Menschen erscheint, das ist immer dasselbe, nämlich daß die Menschen abgeschnitten sind von der Erfahrung ihrer selbst, und auch von ihren wirklichen Möglichkeiten, daß sie ein Scheinleben führen, daß sie reduziert sind. Ich glaube, man muß das weitläufiger vergleichen. Die Grenzerfahrungen, in die die realistische kritische Literatur die Menschen führt, zum Beispiel auch in Ihren Büchern und Filmen, das sind ebenso wichtige Erfahrungen für die Religion. Zum Beispiel in den Psalmen, wenn Personen verfolgt, ungerecht angeklagt werden oder wenn sie in Krankheit, Not und Elend sind. Gerade in solchen Situationen wenden sich die Menschen in ihrem Glauben an Gott. Auch Situationen wie Stalingrad, die Briefe aus Stalingrad zeigen, daß in solchen Situationen der Glaube aufbricht, oder wie es Jaspers sagt, daß in der Grenzsituation der Mensch Erfahrungen eigener Art macht, daß er der Transzendenz inne wird. Sicher, die Wahrheit, die die Religion formuliert hat, wird in der kritischen, realistischen Literatur aufgenommen. Sie macht die gleichen Erfahrungen, nur der Verständnisrahmen ist ein anderer. Faszinierend an diesem Vorgang ist für mich, daß sich dies im literarischen Bereich - noch nicht einmal im philosophischen - abspielt. Ich möchte noch eine Form von geistiger Erbschaft erwähnen. Die Theologie hat ja heute Schwierigkeiten, von Himmel und Hölle zu reden. Ich finde, es ist heute vor allem Sache der Literatur, die Dimensionen von Himmel und Hölle offenzuhalten, sie anschaulich und erkennbar zu machen, allerdings als innerweltliche Zustände. Es gibt ja viele Arten von innerweltlichen Höllen, in den Ehen, Familien, im Beruf, es gibt gemütliche Höllen, luxuriöse und elende. Der Himmel scheint flüchtiger, augenblickshafter zu sein und weniger institutionell abgesichert. Er ist eher eine Gegenerfahrung, die keinen gesicherten Platz hat. Wenn innerhalb der Religion von Himmel und Hölle gesprochen wird, so geht es nicht nur darum, daß die Bösen bestraft werden und daß es den Guten gut gehen wird, sondern es geht ebenfalls um konkrete Erfahrungen. Sicher, anders kann man heute nicht mehr davon sprechen. Es gibt keine Disziplinierungsmittel mehr. Auch keine Tröstungen. Könnte es nicht sein, daß der Anblick ihrer innerweltlichen Höllen ohne religiöse Tröstungen unerträglich ist für viele Menschen? Es brechen ja viele Menschen zusammen, daran ist nicht zu zweifeln. Das seelische Leid in unserer Gesellschaft ist riesengroß. Ich nehme an, daß manche dieser psychisch Kranken, wenn sie glauben könnten, gesünder wären. Haben Sie eine therapeutische Intention in dem, was Sie schreiben? Ähnlich wie Freud? Zunächst einmal hat das Schreiben für mich selbst eine therapeutische Funktion. Es ist überhaupt meine Art, mit meinen Erfahrungen umzugehen, meine Erfahrungen zu intensivieren, festzuhalten, vielleicht auch besser zu verstehen. Also die Zielsetzung Heilung, Lösung, Katharsis wäre nicht das Primäre. Das erste wäre, daß die Maske abgenommen wird. Es geht um den Akt der Demaskierung, daß der Mensch seiner Triebe, seiner verschiedenen Rollen, seiner Maßlosigkeit, aber auch seines Unglücks ansichtig wird und sich dem stellt. Es ist wahrscheinlich eine Angst- und Schreckensbeschwörung, daß ich das schreibe. Es sind die eigenen negativen Möglichkeiten, die da gebannt werden, indem ich sie mir vor Augen halte. So würde ich das sehen, auf mich selbst bezogen. Die scheiternden Helden meiner Bücher und Filme sind meine armen Brüder. Ich meine das wirklich im Sinne von Verwandtschaft. Ich kann diese Verwandtschaft erkennen und zugeben, weil ich weiß, daß ich mich auch von ihnen unterscheide. Die Unterscheidung ermöglicht die angstlose Identifikation mit den schattenhaften, dunklen, bedrohlichen Möglichkeiten. Und man unterscheidet sich ja schon durch das Schreiben, dadurch überschreitet man das dargestellte Leben auch. Vielleicht auch, indem man besonders unbarmherzig mit den Figuren umgeht. Aber es stimmt nicht, was einmal eine Leserin vermutet hat, daß ich meine Figuren hasse oder verachte. Sie sind für mich schon dadurch, daß sie an den Rand geraten, mehr als der gut angepaßte Durchschnittsmensch. Sie zeigen sich mehr. Sie sagen mir mehr über die Menschen. Das Problem des Todes bzw. des Sterbens nimmt bei Ihnen eine zentrale Rolle ein. Aber nicht nur bei Ihnen. Es gab einen »Spiegel«-Artikel unter dem Titel »Das schöne Sterben«. Bücher über den Tod nehmen einen gewichtigen Raum ein. Ist das eine Mode? Oder steckt mehr dahinter? Ja, die Antworten der Religion werden nicht mehr in demselben Maß geglaubt, so daß das Problem nackt und neu vor uns steht. Weil außerdem mehr individuelle Lebenschancen wahrgenommen werden, ist es um so härter und schmerzlicher, daß das Leben begrenzt ist. Die Menschen fühlen sich nicht mehr aufgehoben in der Gesellschaft, nicht mehr im gleichen Maße in einer Kollektivinterpretation geborgen. Jeder muß sich mit dem eigenen Sterben, mit seinem Ausscheiden aus der menschlichen Gesellschaft beschäftigen. Ernst Bloch hat eine Hoffnungsphilosophie entworfen, ist aber jetzt tot. Die Philosophie wirkt weiter oder auch nicht. Jedenfalls kann er nicht mehr daran teilnehmen. Das muß man sich deutlich machen. Nicht nur in der Religion, auch im Realismus scheint der Tod eine besondere Stellung einzunehmen. - Ist es aber überhaupt sinnvoll, dem Tod eine solche Reverenz zu erweisen? Ich würde es so sagen: Dauerndes Fixiertsein durch den Tod ist ganz bestimmt pathologisch. Andererseits ist es pathologisch, sich nicht bewußt zu sein, daß man sterben muß - es nicht wissen zu wollen. Beides ist pathologisch. Irgendwie besteht ein Zusammenhang zwischen leben können, leben lernen und sterben lernen. Das beginnt schon mit der Geburt. Die Selbsterfahrung erwacht an der Erfahrung von Widerständen und Grenzen. Und Erwachsenwerden bedeutet wohl, die eigene Begrenztheit zu akzeptieren, ohne zu verzweifeln oder auszuweichen in Illusionen oder tröstende Wahnvorstellungen. Man kann auch sagen, das ist Realismus: ungebeugt die Bedingungen der eigenen Existenz erkennen. Die Hauptfigur in Ihrem Buch »Die Schönheit des Schimpansen« wird zu einem Mörder, obgleich ein Bewußtwerden im eben beschriebenen Sinn nicht stattfindet. Klaus Jung, die Hauptfigur aus der »Schönheit des Schimpansen«, ist ein Mensch, der die Kränkungen der Realität nicht ertragen kann. Sein Ich ist zu schwach, um zugeben zu können, wie begrenzt es ist. Deshalb flüchtet er in den Selbstbetrug, und deshalb bringt er schließlich einen Menschen um. Er will ein grandioses Bild von sich selbst gegen die Realität aufrechterhalten, um nicht der Depression zu verfallen. Er ahnt, daß er beim Anblick seiner vollen Wirklichkeit von Depressionen und Selbstmord bedroht ist. Und der Mord ist nur der letzte Versuch, die Kraft der Selbstzerstörung von sich abzuwenden und gegen einen anderen zu kehren. Jung ist zu unglücklich, zu verstört, um sich selbst zu erkennen. Das kommt ja auch schon darin zum Ausdruck, daß er seine Examensarbeit über das Tibetanische Totenbuch nicht schreiben kann. Ja, er kann den Grundgedanken des Buches nicht denken. Das Totenbuch sagt ja, daß die Schrecken, die der Seele nach dem Tod begegnen, alle nur Äußerungen ihrer selbst sind. Und wenn sie das erkennt, dann zerfallen die Schrecken, und die Seele ist erlöst. Es ist ein Gedanke, den es bereits bei Sokrates gibt... … und später bei Freud … … daß Erkenntnis befreit, daß die bewußte Wahrnehmung des Schreckens vom Schrecken befreit. Das bedeutet dann Katharsis. Es hängt auch mit der Befreiung von Schuld zusammen. Erst wenn man nicht mehr befürchtet, für die eigene Verfaßtheit, die eigene Natur von den anderen oder von ihrer gesetzgebenden, überweltlichen Instanz, von Gott, bestraft zu werden, kann man sich wirklich wahrnehmen. Die Ethik des Neuen Testaments will ja den Sündern das Gefühl der Verdammnis nehmen. Das ist ein Schritt zu einer nicht mehr streng normativen, sondern zu einer individualisierten Wahrnehmung, einem intimen, realistischen Verstehen. Ich würde das als die realistische Tendenz unserer Bewußtseinsgeschichte bezeichnen. Immer mehr Züge, Elemente, Eigenschaften der Wirklichkeit, eben auch der eigenen Wirklichkeit, werden aufgenommen in das Bild, das wir von uns und der Welt haben. Wir geben immer mehr zu, was wir aus Angst vorher nicht zugeben wollten. Es ist also ein Fortschreiten von einem einfachen abstrakten zu einem vielfältigen und konkreten Bild. Eine unendliche Annäherung mit immer neuen Rückschlägen, Rückzügen, neuen Verlusten. Der Realismus wächst jedenfalls im gleichen Maße, wie wir darauf verzichten, bei der Wahrnehmung des Lebens auf vereinfachende und tröstende Schemata zu verzichten. Ist dieser Verzicht nicht auch ein Verlust? Läuft der Realismus, so verstanden, nicht auf eine trostlose negative Erkenntnis zu? Sein Fluchtpunkt ist doch der Tod als unüberschreitbare Grenze. Ich glaube, nicht notwendig ist Negativität das Ergebnis des Realismus. Es könnte doch auch auf ein Ja-Sagen hinauslaufen. Es gibt doch auch Umkehrungen der Negativität ins Positive. Wir sterben zu früh, wir leben alle unter unseren besten Möglichkeiten, oft ist das Defizit unerträglich, unzumutbar. Aber andererseits, ohne den Tod, ohne die Begrenzung unseres Daseins wäre ja eine Daseinsintensität überhaupt nicht denkbar. Wenn wir Millionen Jahre leben könnten, wäre doch alles gleichgültig. Wir würden zu Steinen werden. Was sollte uns noch motivieren und in Bewegung setzen, wenn alles endlos da wäre, wenn wir auch endlos da wären? Nur die begrenzte Lebenszeit, und daß jeder Augenblick unwiederbringlich ist, das macht das Leben zu einer einmaligen kostbaren Chance. Die christliche Verheißung, daß man vom Tod zum Leben kommt, meint ja vielleicht gerade das. Wenn man den Jenseitsaspekt einmal abzieht, dann bezeichnet sie diesen Umkehrungsvorgang, daß man aus der Todeserfahrung ein vertieftes Leben gewinnt. Wer das Leben bewußt liebt, hat die Sterblichkeit des Lebens in seine Erfahrung aufgenommen. Und um uns des Lebens zu versichern, nähern wir uns auch immer wieder den Möglichkeiten seiner Vereitelung. Ich jedenfalls habe das Bedürfnis, hinzusehen und die Bedrohung des Lebens für mich durchzuspielen. Ich glaube nicht, daß das frivol ist, es ist ein Grundmuster der Erfahrung. Phantasie ist eine Zunge, die auch am Tod leckt. Oder weshalb schreiben die Dichter Tragödien, weshalb sehen wir sie uns an? Weshalb faszinieren uns Hochseil- und Trapezakrobaten und der Salto mortale? Weshalb lesen wir die Katastrophenberichte der Zeitungen und sehen uns die tödlichen Kämpfe der Gangsterfilme an? Weil wir die Berührung mit Tod und Gefahr brauchen, um zu leben. Das Bild des Helden, das wir in uns tragen, das ist der Mensch, der sich dem Risiko des Todes aussetzt, der große Mühen und Schmerzen erduldet und vielleicht untergeht. Wir empfinden, daß selbst der Untergang des Helden noch ein Sieg sein kann, und auf jeden Fall, daß das Leben eines solchen Menschen mehr menschliche Größe hat als das eines braven Durchschnittsbürgers, der in bequemen Gewohnheiten und Sicherheiten dahintrottet. Es ist wohl so, daß wir einen Menschen um so mehr bewundern, je mehr er feindlichen Bedingungen, also letzten Endes der Todesdrohung standhält. Er bringt dadurch sein Ich, seine Autonomie schärfer zur Geltung. Er wird nicht von außen gelebt, von den Umständen, im Gegenteil, er beweist die Kraft, gegen die Umstände zu leben, auch wenn er am Ende scheitert. Und ich glaube, das interessiert uns fundamental: Was passiert in Krisen, wie zeigt sich dann der Mensch? Aber es gibt natürlich auch eine starke Gegentendenz auf eine Kultur, eine Gesellschaft hin, in der es keine extremen Erfahrungen mehr gibt, in der alle sich gleich sind, gleich geborgen, sicher, versorgt, und in der es keine Anreize gibt, sich zu riskieren und auszusetzen. Das ist nicht nur die klassenlose Gesellschaft, es ist bereits der verwaltete Wohlfahrtsstaat oder eine Gesellschaft, wie sie der amerikanische Verhaltensforscher Skinner entworfen hat. Er nennt sie eine Gesellschaft jenseits von Freiheit und Würde des Individuums. Es ist die Gesellschaft des gut kontrollierten und konditionierten Durchschnittsmenschen. In dieser Welt, sagt er, wird niemand mehr eine Blume pflücken vor einem Abgrund, genannt Gefahr. Man wird diese Erfahrung, die unser Lebensgefühl immer wieder verstärkt, dann nicht mehr verstehen können. Aber ich fürchte, diese Menschen werden überhaupt nichts mehr verstehen und fühlen und wahrnehmen, sich selbst schon gar nicht mehr. Es ist eigentlich eine undenkbare Utopie. Es wäre natürlich eine Gesellschaft mit weniger Leiden. Vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Es könnte eine Gesellschaft des unbewußten Leidens sein. Die Gesellschaft eines depressiven Friedens. Ein traumloses Leben. Ich fürchte, die Insassen dieses Paradieses werden alle beginnen, Drogen zu schlucken, um sich von dieser faden Alltäglichkeit zu erlösen. Alltäglichkeit spielt ja auch bei Ihnen eine große Rolle. Sie lenken den Blick des Lesers immer wieder auf alltägliche Dinge und Vorgänge. Ich finde es befreiend, wenn in einer Szene eine Stehbierhalle im Bahnhof dargestellt wird, wo die Menschen aus Pappbechern Bier trinken und Besoffene Ketchup umwerfen. Alles unbedeutende Dinge, die täglich passieren und die auf einmal zum Stoff von Literatur werden. Auch wenn Sie Frauen schildern, schildern Sie nicht nur irgendwelche Schönheiten, sondern da kommen auch Falten und Fettpolster vor. Da wird nicht an irgendeinem Schönheitsideal gemessen, sondern die Sache gewinnt aus ihrer Individualität heraus Bedeutung. Das ist ein erhellender Vorgang. Der Gang durch eine Bahnhofshalle bedeutet dann nicht, daß man die Nase rümpft und das Gesicht abwendet, sondern daß man hinsieht oder daß man sogar bewußt riecht. Ja, das ist der große Reiz des Schreibens, die Wahrnehmung von vorgeordneten Klassifikationen, von schön und häßlich, gut und böse zu befreien und das Individuelle, das Besondere, Einmalige der Dinge und der Ereignisse zu entdecken. Walter Benjamin hat von »profaner Erleuchtung« gesprochen. Es ist ein gesteigertes Sehen, das die Dinge aus ihrer Unauffälligkeit hervortreten läßt und sie offenbart als einmalige Elemente der Wirklichkeit. Die kleinste Kleinigkeit, auf die der Blick fällt, kann dann auch plötzlich etwas vom Ganzen enthalten, die Kostbarkeit des ganzen Lebens zeigen. Hat das nicht auch etwas mit Sakramentalität zu tun? Mit einer Sakramentalisierung des Lebens? Ich gehe als Autor davon aus, daß es nichts Wirkliches gibt, das unbedeutend ist. Aber von einer Sakramentalisierung des Lebens, des Alltags würden Sie nicht sprechen? Ich wäre nicht darauf gekommen, es so zu nennen. Aber ich glaube, wir meinen dasselbe. Nicht Verklärung oder gar Beschönigung, sondern ein eindringliches Erfassen dessen, was ist, und eine grundsätzliche Zustimmung zum Leben. Auch im Zen-Buddhismus gibt es4 ja diese Haltung. Über alles kann man meditieren, auch über das geringste Ding, einen Strohhalm, einen Stein, eine Blume, ein Schriftzeichen, alles kann zum Gegenstand der Erleuchtung werden. Ist das nicht eine religiöse Haltung? Es ist für mich eine Form von Lebensandacht. Sie braucht keinen transzendenten Hintergrund. Der Hintergrund dieser Erfahrung ist eigentlich nur das Wissen, daß alles, was da ist, auch nicht da sein könnte, daß das ganze Leben, was wir für selbstverständlich halten, eigentlich etwas ganz Unwahrscheinliches und Phantastisches ist. Ich habe kein Bedürfnis, dieses Staunen und Ergriffensein zu rationalisieren, durch religiöse Erklärungen und Deutungsschemata. Ich kann es auch nicht mehr in diesen Begriffen fassen, etwa, daß das Leben die Schöpfung Gottes sei. Letzten Endes ist das nur ein Streit um Worte. Wir beschäftigen uns in der Theologie zur Zeit mit dem Problem der Biographie. Was ist die Biographie eines Menschen, was geschieht da eigentlich? Diese Beschäftigung ist nicht uneigennützig, weil wir uns als Kirche natürlich überlegen müssen, an welchen Punkten innerhalb seiner Biographie man einen Menschen ansprechen müßte, wenn er beispielsweise eine besondere Hilfestellung nötig hätte. Es gibt zwar eine Sozialisationsforschung. Bis zur Erwachsenensozialisation ist sie aber noch kaum vorgedrungen. Vielleicht kann man hier von einem realistischen Autor wichtige Anregungen empfangen. Sie haben sich mit typischen Biographieproblemen beschäftigt, vor allem mit Krisensituationen. Weil Krisen gleichbedeutend damit sind, daß wir eine Erfahrung machen, weil es keine Korrektur und kein emotionales und geistiges Wachsen ohne Krisen gibt. Aber wenn man jetzt mehr sagen will, dann muß man sich den einzelnen Fall ansehen. Obwohl, das muß ich sagen, um Mißverständnissen vorzubeugen: ein Schriftsteller studiert nicht einfach in einem neutralen, allseitigen Interesse irgendwelche Fälle, die er dann literarisch nachkonstruiert, sondern er bringt immer, auch im fremden Material, seine besondere Erfahrung zum Ausdruck. Die wird erweitert, radikalisiert, umgeformt, aber es gibt da einen eigenen Kern, ein Moment von Zeugenschaft, das der literarischen Fiktion die Authentizität gibt. Man kann auch sagen, das Wissen des Schriftstellers ist heißes Wissen, im Gegensatz zu dem kalten Wissen des wissenschaftlichen Forschers. Man lernt deshalb von der Literatur ähnlich wie von einer Lebensbegegnung. Sie gehen beim Schreiben auch nicht von einer Theorie oder von einem psychologischen Modell aus? Nein, von konkreten Faszinationen. Meistens sind es unverstandene Einzelheiten, die irgendwie stumme Signale sind, die man noch nicht versteht. Neulich habe ich ein altes Ehepaar auf dem Land besucht. Diese Leute hatten die Gewohnheit, immer die Haustür aufstehen zu lassen. Warum, was erwarten sie? Da liegt der Schlüssel zu einem Geheimnis. Oder ich sah in einer Theateraufführung einen goldenen Bühnenvorhang, der von Scheinwerfern angestrahlt wurde, ein dunkles Schwarzgold. Mir fiel das Wort »Das goldene Vlies« ein, und ich stellte mir einen alten Mann vor, der glaubt, ruhig Abschied genommen zu haben von früheren Phasen seines Lebens, und plötzlich heimgesucht wird von unerledigten Erinnerungen und unerfüllten, unerfüllbar gewordenen Wünschen. In diesem Glitzern trafen sich eine Menge Dinge, erotische Faszinationen, Erfolgsträume, die Erfahrung des Alters. Es war ein unbestimmtes und starkes Signal. An diesem Abend war ich disponiert, so darauf zu reagieren. Und wenn das so ist, dann darf man sich nicht dazwischenreden und sich etwa zurechtweisen und sagen, das ist doch Kitsch, ein goldener Vorhang ist doch Kitsch, dann brechen nämlich die Phantasien zusammen, und man kehrt mit gesenktem Kopf zur Vernunft zurück. Ich verstehe diesen Vorgang sehr gut. Aber Sie sind ja nicht nur Erfahrungsautor. Kaum ein anderer Romanschriftsteller hat sich so stark mit Literaturtheorie auseinandergesetzt. Psychoanalyse, Rollentheorie, Systemtheorie, ganz allgemein gesagt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse - bis hin zu Luhmann — werden von Ihnen aufgearbeitet, so wie umgekehrt auch die Forschungszweige von Ihnen profitieren können. Ich nehme an, daß es ein Amalgam ist von Gelerntem, Gelesenem, Erfahrenem. Was ich über den Menschen gelesen habe, meinetwegen bei Freud, bei Marx oder bei anderen Philosophen, Psychologen, Verhaltensforschern, das bestimmt natürlich meine Erfahrung mit. Das ist darin enthalten. Wir sprechen von Biographie und Erfahrung. Dazu gehört auch die Midlife Crisis. Für einen realistischen Autor sicher eine wichtige Situation. Sind Sie in besonderer Weise ein Autor für eine Generation, die an diesen Wendepunkt gekommen ist? Das gilt ausdrücklich eigentlich nur für mein Buch »Doppeltbelichtetes Seestück« und einige Hörspiele, auch für die »Schattengrenze«. Jung in der »Schönheit der Schimpansen« hat eine tiefergreifende Existenzkrise. In den Krisen sind bei Ihnen die Menschen immer allein. Auch das Du erscheint nicht als etwas Tragendes. Es treten auch nicht die Institutionen als hilfreich auf. Arnold Gehlen etwa ist der Meinung, daß der Mensch konstitutionell sehr wach ist und der Institutionen bedarf, um einige Stangen zu haben, an denen er sich festhalten kann. Ich gebe zu, daß es in meinen Büchern einen Vorrang der Krise vor der Ordnung gibt. Die Menschen, die ich dargestellt habe, halten sich auch nicht an den Institutionen fest. Sie sind vielmehr aus ihnen herausgefallen oder empfinden sie als Bedrückung. Aber ich muß zugeben, ich habe nicht meine ganze Lebenserfahrung in meinen Büchern dargestellt. Wie meinen Sie das? Ich kenne auch das andere: Solidarität, Liebe, Geborgenheit. Ja, sicher, das strahlen Sie auch aus, aber Sie schreiben es nicht. Ein Geborgensein gibt es in den Büchern nicht. Oder sollte ich sagen, noch nicht? Das ist vielleicht ein Mangel. Es ist ein schwieriges Problem für mich. Das Schreiben ist ja an sich schon eine starke Zuwendung, eine Solidarisierung mit den dargestellten Menschen. Aber vielleicht gibt es in der Literatur doch einen erkenntnispraktischen Vorrang der Krise. Und vielleicht kann man auch nicht hoffen oder es nur langfristig als Forderung stellen, daß man die ganze Spannbreite seiner Erfahrung formuliert. Mein Bild des Lebens ist ja nicht fertig, ich schreibe noch daran, und ich glaube, das Schreiben folgt der Lebenserfahrung mit einiger, manchmal mit großer Verzögerung. Andererseits geht es aber auch über sie hinaus, radikalisiert sie in einer bestimmten Richtung, zeichnet bestimmte extreme Möglichkeiten. Man seilt sich ab in eine Höhle, immer weiter. Vielleicht könnte man auch an der Höhle vorbeiwandern. Aber aus verschiedenen Gründen liegt das Forschungsobjekt in der Höhle, und dann muß man immer tiefer hinein. Die Bücher stellen Etappen eines Weges dar, auf dem man vordringt. Vielleicht kann man es so erklären, weshalb es da eine begrenzte Aufmerksamkeitsrichtung gibt, als schaue man immer wieder auf dieselben Dinge. Andererseits möchte ich aber auch widersprechen. Die Erfahrung, die in meinen Büchern formuliert ist, ist nicht monolithisch. Es gibt darin Gegenbewegungen, Versöhnungsmomente, Befreiungsmomente, erfüllte Augenblicke, nur keinen endgültigen Sieg und keinen gesicherten Besitz von Glück. Das sind immer nur verschwindende Momente. Ja. Oft stehen sie auch im Kontrast zu der realen Situation der Menschen. Der alte Mann im »Schönen Tag« erinnert sich, als er von seiner Tochter alleingelassen worden ist, daran, wie er mit ihr Ferien gemacht hat. Und da war so ein Moment, den er nun wiedererlebt. Er hat im Regen an einem Badehaus gestanden und den Geruch des warmen Holzes gerochen. Seine Tochter ist über den Badesteg gelaufen, ins Wasser gesprungen und in den See hinausgeschwommen. Dieser Augenblick ist jetzt für ihn ein verdichtetes Bild des Lebens. Und es kommen ihm noch andere ähnliche Erinnerungen. Jung in der »Schönheit der Schimpansen« erlebt einmal auf einem Spaziergang auf einem Felsweg oberhalb des Meeres einen ekstatischen Augenblick der Lebensfülle. Das Leuchten des Himmels, das Blenden und Gleißen der Wasserfläche, die Wärme der Steine, der Lavendelgeruch und plötzlich die Erinnerung an die Nacht mit der Frau und an ihre Haare, das kann er alles zusammen erleben. Und er hat auch einmal nachts ein mystisches Gefühl, mit dem ganzen Leben verschmolzen zu sein, mit allen Menschen und allen Kreaturen. Er kann es allerdings nicht festhalten. Ja, es gibt diese erfüllten Augenblicke in Ihren Büchern. Aber was ist das? Sind das Versprechen, utopische Vorwegnahmen? Ich meine, es sind die Momente, in denen sich Menschen neu für das Leben öffnen. Gibt es bei Ihnen irgendeine Art Transzendenz, wenn nicht vertikal der Himmel, so doch vielleicht ein Fernziel, ein Stück Utopie? Irgendeinen Spannungsbogen muß es doch geben, so daß es sich lohnt, sich auszustrecken, um weiterzuleben. Diese Bewegung nach vorn ist ja das Leben. Wir leben ja alle auf Zukunft hin. Wir stehen morgens auf, und unser Blick ist nach vorne gerichtet. Wir wollen etwas tun. etwas erreichen, wir hoffen auf etwas. Oder wir erinnern uns, aber Erinnerung ist immer auch ein Neusehen der Vergangenheit. Wir erinnern uns, weil die Erinnerungen für jetzt und morgen von Bedeutung sind. Wir wollen etwas fortsetzen, vollenden oder ändern. Man bewegt sich immer nach vorne, obwohl man weiß, daß die Lebenszeit immer kürzer wird. Manchmal sind es ja nur kleine Abschnitte. Man wartet auf die nächste Stunde, und wenn einen etwas Unangenehmes erwartet, auf die Zeit danach. Das ist die vitale Lebensrichtung, nicht die Erwartung von Utopie, die sich erfüllen soll. Aber ein Gefühl von Mehrwerden, von Bereicherung, daß etwas Gutes noch kommt, daß man noch mehr tun kann, noch etwas besser oder deutlicher machen kann. Ein utopisches Leuchten ist das schon. Das ist eigentlich ein vitales Wunder, wenn man bedenkt, daß man sterben muß, in absehbarer, wenn auch unbestimmter Zeit. Aber es kommt doch jetzt - wenn ich bei diesem Bild der Spannung bleibe - darauf an, ob es ein Hinausleben über den Tod gibt. Ein indirektes Hinausleben oder Beteiligtsein. Zum Beispiel wäre es schön für mich zu wissen, daß meine Bücher noch eine Zeitlang gelesen werden, daß es eine Spur ist, die ich hinterlasse. Das ist ein Teilwunsch innerhalb eines viel größeren Wunsches, daß die menschliche Welt weiter existiert, daß die fürchterlichen Katastrophen, die uns drohen, nicht eintreten, weder der Krieg, noch die ökologische Katastrophe, daß meine Kinder in einer menschlichen Welt leben. Also die anderen Menschen sind einbezogen. Aber sicher, ich lebe ja nicht allein. Man lebt doch nur mit anderen und durch andere. Man kann im Grunde auch nicht sagen: nach mir die Sintflut. Wenn man sich nämlich vorstellt, daß mit dem eigenen Tod auch das Ende der Menschheit gekommen ist, das würde einen total verfinstern. Bei der Aussicht, daß im Jahr 2000 alle Menschen tot sind, könnte ich keine Zeile mehr schreiben. Wozu auch? Man würde schon vorher erstarren. Aber von Hoffnung im Bloch'schen Sinne würden Sie nicht sprechen? - Bloch sagt: Man muß über das Ziel hinausschießen, um das Ziel zu erreichen. Man braucht ein Stimulans, das weit nach vorn weist. Er hat aber nur Bewegungselemente, utopische Traummaterialien formuliert oder sichtbar gemacht. Er hat keine konkrete Utopie entworfen. Das wäre ihm nämlich abstrakt erschienen. Müssen wir also vom Gedanken der Utopie völlig Abstand nehmen? Von der Utopie sicher, nicht von Wünschen und Hoffnungen. Ist das ein Standpunkt der Skepsis gegenüber der Geschichte und dem Fortschritt? Ja, das ist vor allem eine Erfahrung unserer Zeit: Fast jeder Fortschritt ist mit Negativem vermischt und bringt unüberschaubare Folgelasten mit sich. Die Insektizide erhöhen die Ernteerträge, aber sie gefährden die Gesundheit und das ökologische Gleichgewicht. Man kann lange Listen solcher Widersprüche aufstellen, täglich kommen neue hinzu. Ich glaube trotzdem an Verbesserungen. Es bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig, als dauernd etwas zu verbessern, zu ändern, zu korrigieren. Aber ich glaube nicht an die Institutionalisierbarkeit des Glücks, weder per einlinigen Fortschritt, noch durch den eschatologischen Sprung in die völlig neue Lebensqualität. Man muß leben können mit Verlusten und beschränkten Horizonten, mit eng begrenzter individueller Lebensaussicht, mit zum Teil bedrohlichen Aussichten für die ganze Menschheit. Und können Sie sich in diesem Zusammenhang die Institution Kirche als einen positiven Wert denken? Doch, das kann ich. Wenn sich die Kirche nämlich als eine Institution versteht, die unabhängig von Interessenkämpfen und Koalitionen christliche Werte vertritt. Wenn sie dies radikal tut und konkret auf die Gegenwart bezogen. Ich erwarte von der Kirche einen Beitrag zur Diskussion des Industrialismus, zum Umweltproblem, zu Fragen der gerechten Verteilung der Güter und Lasten, zur Erziehung, zur Rüstung und zu vielen anderen heißen Fragen. Es ist die Chance der Kirche, daß sie sich querstellen kann zum Konformismus und Lavieren und Taktieren aller übrigen Instanzen. Eigentlich muß sie es tun. Aber die Kirche ist bei uns zu vielfältig mit den etablierten Mächten verknüpft. Von denen hat sie mehr angenommen als die von ihr. Wenn ich unser Gespräch überdenke, so scheint es mir, dass die von Ihnen vertretene realistische Literatur Funktionen wahrnimmt, die zu den klassischen Funktionen der Religion zählen. Mir liegt viel daran, daß Realismus nicht Anpassung und Kleinbeigeben bedeutet, sondern Erweiterung im Sinne von Erwachsenwerden. Es sind Kriterien des Realismus und des Erwachsenseins, daß man Widersprüche zugeben und ertragen kann, daß man es nicht nötig hat, einfache und abstrakte Schemata über die Mannigfaltigkeit der Welt zu legen, daß man den Zufall und das Besondere akzeptieren kann. Erwachsensein bedeutet auch, daß die Sicht des Lebens nicht zu sehr von Angst beeinträchtigt wird, und zwar weil man Angst zugeben und durcharbeiten kann, weil man sie nicht verleugnen muß. Es bedeutet Unabhängigkeit von Autorität und verinnerlichten Schuldgefühlen, so daß man auch neue Wege gehen kann und den Blick der anderen nicht fürchtet. Das klingt jetzt auch wie Utopie. Sicher. Man erreicht diesen Zustand nicht endgültig und ein für alle Mal. Und es wäre auch ganz falsch, wenn man daraus jetzt wieder eine bedrohliche Norm machte: Du hast dauernd und eisern erwachsen zu sein. Man könnte es eher umgekehrt sagen: Erwachsensein heißt zugeben können, daß man es keinesfalls immer ist. So wie auch kein Mensch immer gut ist, immer ausgeglichen, immer verantwortlich ist. Wir können den Begriff des Erwachsenseins auch fallen lassen. Es handelt sich darum, die Realität und das eigene Selbst wahrzunehmen oder fähig zu werden zur Erfahrung. AnmerkungenErstveröffentlichung: Horst Schwebel. Glaubwürdig. Fünf Gespräche über heutige Kunst und Religion mit Joseph Beuys, Heinrich Böll, Herbert Falken, Kurt Marti, Dieter Wellershoff. München 1979, S, 127-152. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/62/hs12.htm
|
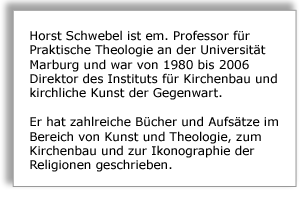 Ich komme zu Ihnen, weil ich in Ihrem Schreiben eine Herausforderung an die Theologie, besser an das christliche Existenzverständnis, sehe.
Ich komme zu Ihnen, weil ich in Ihrem Schreiben eine Herausforderung an die Theologie, besser an das christliche Existenzverständnis, sehe.