
Landschaften |
Worin wir leben
LandschaftenKarin Wendt
Heute scheint mir diese aufgeklärte Grundskepsis gegenüber dem Landschaftsbegriff bzw. gegenüber seiner unhinterfragten Verwendung zugunsten einer nur scheinbar aufgeklärten Neutralität in den Hintergrund getreten zu sein. In der Suche nach dem stimmigen Ambiente, der idealen Landschaft, treffen sich kulturelle, politische und religiöse Anliegen. Wenn es um die Gestaltung und Organisation von Räumen geht, seien es konkrete, kommunikative, politische, religiöse oder ästhetische Räume, wird fast nie danach gefragt, warum etwas in dieser oder jener Form erscheint oder erscheinen sollte, sondern immer rechtfertigend auf bestimmte Formenkonstellationen verwiesen, die sich in unserem Gedächtnis abgelagert und von daher einen hohen (funktionalen) Wiedererkennungswert haben. Dass es aber gewordene Formen sind, Resultate unseres Willens zur Organisation, über die wir uns gerade austauschen und verständigen müssen, wird als lästige Verkomplizierung der Entscheidungsprozesse eingestuft. Was bis in die 80er Jahre noch der Werbung und der politischen Rhetorik vorbehalten war, nämlich die assertorische Rede vom „Faktischen“, ist allgemeine Argumentationskultur geworden, während die implizite Normativität kultureller Entscheidungen wie ausgeblendet scheint. Man könnte auch sagen: Wir beschwören Bilder von Landschaften dort, wo es eigentlich um Urteilsprozesse und Selbstbefragung ginge, und wir heucheln Aufgeklärtheit und historische Verantwortung dort, wo wir eigentlich eben jene Landschaftsrepräsentationen kritisch in den Blick nehmen müssten. Es ginge darum zu fragen, wo wir uns in Bezug auf bestimmte Landschaften sehen – seien es die alten Kulturlandschaften Europas, seien es die Medienlandschaften der westlichen Welt oder die politischen Landschaften einer globalisierten Gesellschaft, um nur drei Bereiche landschaftsanaloger Verdichtung herauszugreifen. Ich möchte im folgenden drei Positionen unterscheiden, die wir angesichts der Erfahrung von und Begegnung mit Landschaften einnehmen können: Wir befinden uns in einer Landschaft, also mehr oder weniger im Zentrum einer durch bestimmte Charakteristika gekennzeichneten Umgebung (1.). Wir befinden uns am Rand einer solchen Region (2.), oder wir befinden uns zwischen zwei unterschiedlich charakterisierten Bereichen, in einem Zwischenraum (3.). Die erste Position möchte ich im Bild des „Gartens“ fassen, als Ort einer nach innen wie außen integren Umgebung, die als nicht konfliktuell wahrgenommen wird. Die zweite Position ist die der „Peripherie“, die durch den Übergang vom Gestalteten ins Ungestaltete, von der Ordnung zur Un- oder Nichtordnung charakterisiert ist. Dieser Bereich wird als prozessual, offen und mindestens teilweise konfliktuell wahrgenommen. Die dritte Position ist die des „Zwischenraums“, der als Ort der Gleichzeitigkeit von Differentem, als Bereich der Widersprüche und Hybridbildung erfahren wird. Wie man sich vorfindet, hängt gleichwohl immer auch vom Blick auf die Umgebung ab. Es ist unsere Haltung gegenüber der Welt, die unsere Wahrnehmung bestimmt. Im GartenZu den frühen Landschaftsrepräsentationen gehört die Idee eines unversehrten Teils der Erde, der entweder einmal existiert hat oder aber potenziell wieder existieren könnte, etwa das griechische „Arkadien“ als „Goldenes Zeitalter“ des Hellenismus, der „Garten der Hesperiden“, der sich „im Laufe der Jahrhunderte mit wachsender geographischer Kenntnis der Griechen bis in den die drei Kontinente Europa, Asien und Afrika umfließenden Okeanos (Atlantik)“ verschob[1], oder das keltische „Avalon“, die „Apfelinsel“ bzw. der „Apfelgarten“. Eine der ältesten Raummetaphern für die Utopie des guten Anfangs oder des guten Kerns ist das „Paradies“. Die sprachliche Wurzel liegt im Altpersischen, wo damit ein parkähnlich umgrenzter Bereich innerhalb einer Repräsentationsarchitektur bezeichnet wird. Eine solche Gartenanlage diente der Erholung und Entspannung, aber auch spirituellen oder sozialen Aktiviäten. Bereits von Beginn an verknüpfen sich also im Bild vom Garten natürliche und gestalterische Merkmale zu einer integrativen Landschaftsästhetik. Diese zeichnet sich durch jeweils gültige Harmonie- und Schönheitsvorstellungen aus, durch Vielfalt und Ausgewogenheit und ein bestimmtes Moment der Abgeschiedenheit mit der Möglichkeit zur Sammlung und Regeneration, man könnte auch sagen der Sinneskultivierung. Das transkulturelle Modell vom Garten als eine besonders gestaltete, generell Leben spendende und erhaltende Umgebung exemplifiziert auch die biblische Erzählung vom „Garten Eden“, in der griechischen Übersetzung das „irdische Paradies“. Der Mensch ist dort gut aufgehoben, er kennt sich aus, er bietet ihm alles, was er zum Leben braucht. Generell ist der Garten der Ort, an dem die menschliche Gestaltung der Natur gelingt, ihn zu Ruhe und Einkehr kommen lässt und das Studium der Welt auf eine gefahrlose und sogar heilbringende Art und Weise erfolgen kann. Die Idee des Gartens wird immer dann kultiviert, wenn es um das Wohl des Einzelnen und um die Stärkung des Autarkiegedankens geht. Historische Beispiele einer „Kultur des Gartens“ sind die Gartenzusammenkünfte der Stoiker um Epikur, die mittelalterlichen Klostergärten oder die eindrucksvollen Park- und Gartenanlagen zur Zeit der Aufklärung. „Ende des 18. Jahrhunderts inspirierte die aufgeklärte Vision eines bewusst konzipierten Gartenparadieses, in dem sich 'das Nützliche mit dem Schönen verband', die Gestaltung von Garten und Parks in ganz Europa. Durchdrungen von dem Ideal, den Menschen durch Bildung zu einem besseren Wesen zu erziehen, bot gerade eine Gartengestaltung, die den Menschen in Einklang mit der Natur bringen sollte, entsprechenden Raum für Erkenntnis im Sinne der Aufklärung.“[2] Versteht man den „Garten“ als abstrakten Topos eines durch die Vorstellung der Integrität geprägten Kulturbegriffs, so lässt sich seine Inanspruchnahme bis in die Gegenwart verfolgen, in der Rede vom „Garten der Kulturen“ oder dem „Garten der Künste“, aber auch im Modell einer globalen Kultur. So ließe sich die documenta11 (2002) auch als postkoloniale Gartenutopie deuten. Dem Kurator Okwui Enwesor ging es nicht um die Konfrontation künstlerischer und kultureller Muster und Praktiken, sondern darum, deren integratives Potenzial im Sinne einer globalen Weltbürgerschaft gemeinschaftlich und Kontinente übergreifend zu eruieren. Die Metapher des Gartens, so könnte man vielleicht zusammenfassen, steht für den Versuch, der Ungeordnetheit der Welt eine menschliche Ordnung einzuschreiben. Schon im „Paradies“ beginnt jedoch zugleich die andere Geschichte, nämlich die vom zerstörten Garten, der verloren oder nicht mehr zugänglich ist. Die historische Bibelforschung geht davon aus, dass die leidvollen Erfahrungen angesichts der zunehmenden Versteppung Mesopotamiens und der damit einhergehenden Unfruchtbarkeit ganzer Landstriche bei der Beschreibung von der „Vertreibung aus dem Paradies“ eine Rolle spielten. Je elaborierter die nachfolgende Vorstellung vom „wahren Leben“ in der christlichen Deutung jedoch wurde, desto stärker wurde der eschatologische Zug der Erzählung. Erst die politische Philosophie des 20. Jahrhunderts im Kreis um Ernst Bloch rückte den konkreten Kern der Utopie erneut in den Mittelpunkt.
An der PeripherieDer Weg aus dem Garten heraus, weg vom Zentrum, führt irgendwann an den Rand. An der Peripherie löst sich die Gestalt eines bis dahin relativ klar strukturierten und als homogen wahrgenommenen Bereichs in Teilen auf, sie franst aus oder bricht ein. Der Blick zurück vom Rand aus auf die nun mehr oder weniger entfernte Landschaft lässt diese indes erst deutlich als ein Ganzes erscheinen, gleichwohl nur aus der Ferne. Die Peripherie ist bedingt durch die Relation zum Kernbereich, sie ist die Umgebung einer Stadt oder einer Region, eines Landes oder einer Landschaft. Sie beschreibt keinen Ort des Bleibens, sondern eher einen Bereich der Bewegung, genauer des Kreisens und des Umkreisens. Im Griechischen bedeutet „periphéreia“ ursprünglich „das Herumtragen; der Umlauf“ (zum Verb „peripherein“ = „herumtragen“). In der christlichen Ikonographie ist es die Heiligenlegende des Christopherus, die den Topos des „Herumtragens“ zentral bearbeitet hat.
Auf einer Bildtafel des Schweizer Malers Konrad Witz (1400-1446) sehen wir den Heiligen Christopherus (1435), wie er Jesus auf seinen Schultern tragend durch das Wasser geht. Witz, der sich in seiner Malerei an der niederländischen Kunst von Jan van Eyck und Rogier van der Weyden geschult hat, interessiert sich für die genaue Darstellung einer vom Wasser geprägten Uferlandschaft und um die Visualisierung der optischen Eigenschaften des Wassers selbst: Wir sehen die unterschiedliche Beschaffenheit der Küsten, ihre felsigen steilen Ränder, schmale flache Sandstreifen, eingeebnete Strände, die landeinwärts auch bewohnbar sind, und er ermöglicht uns den Blick auf das entfernte, nicht mehr sichtbare andere Ufer des großen Sees. Im Zentrum des Bildes erkennen wir die Spiegelungen des roten Mantels im Wasser, welche die Untiefen des Sees verbergen, wir erkennen die durch das Eintauchen des langen Stocks verursachten Wellenbewegungen, die die Anstrengung des Gehens durch Wasser anzeigen. Für den Betrachter wird jedoch nicht klar, von wo nach wo Christopherus das Wasser durchquert, Das Bild gibt keine klar eingezeichnete Furt zu erkennen, an der sich der Mann orientiert, seine Stellung ist geradezu eine unmögliche – nämlich mitten im Wasser, mitten im Bild. Der Künstler zeigt uns eher symbolisch einen schweren, wagemutigen, fast skurrilen Gang. Christopherus geht, während er den Blick verantwortungs- aber auch vertrauensvoll nach unten richtet, ohne den weit entfernten Menschen am Uferstrand zu bemerken und scheinbar einzig konzentriert darauf, den Menschen, den er trägt, sicher zu geleiten. Wollte man die Darstellung im Sinne einer Visualierung christlicher Existenz deuten, so könnte man sagen, dass sich der Mensch im Übergang befindet auf dem Weg von einem Ufer zum anderen Ufer, immer an den Rändern einer nur entfernt wahrnehmbaren Landschaft. Etwas vom Rand her oder am Rand befindlich zu kennzeichnen, beinhaltet immer auch die Festschreibung einer grundsätzlichen Hierarchie. Das Periphere erklärt sich vom Zentrum her, seine Gestalt ist nur insofern sichtbar, als sie der zentralen Gestalt noch irgendwie ähnelt oder auf diese rückverweist. Anders herum bedeutet der Blick auf die Peripherien einer Landschaft, einer Stadt, einer Kultur oder einer Gesellschaft immer den Aufbruch zu neuen Ufern, die Erschließung von bis dahin Unbekanntem oder Ausgegrenztem. Die Randgänge der Geschichte sind im besten Fall Selbstbefragungen, zu der sich eine Kultur verpflichtet, um nicht in einem affirmativen Status zu erstarren. Auch die Geschichte der Kunst ist seitdem und insofern sie als Stilgeschichte geschrieben wird, geographisch gebunden als „die Geschichte einer Reihe von Zentren, von denen aus sich jeweils ein Stil verbreitet hat. [...] Ein Stil entwickelt sich nicht spontan in einem weit ausgedehnten Gebiet. Er ist die Schöpfung eines Zentrums, einer einzelnen Einheit, von der der Impuls ausgeht, die klein sein kann wie das Florenz des 15. Jahrhunderts oder groß wie das Paris der Vorkriegszeit [...].“[3] Vor allem die Forschung der 80er Jahre hat die etablierte Stilgeschichte einer Revision unterzogen und gezeigt, dass gerade die Peripherie auch „als Abweichung“ fungieren und abseits der Hauptströmung künstlerische Alternativen hervorbringen kann, wie etwa das Beispiel der Kunst des florentinischen Manierismus, der unabhängig vom römischen Stil so etwas wie eine „antiklassische Guerilla“[4] bildete. Deutlich wird dabei aber auch, dass Bilder fast nie im „friedlichen Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie Mittel zur Überzeugung und Beherrschung sein können.“[5] Bis heute lassen sich sicher Beispiele für eine „erzwungene Übernahme stilistischer und ikonographischer Modelle, die aus dem Zentrum stammen““[6], finden, zuletzt etwa die fast rauschhafte Entwicklung der Neuen Leipziger Schule zu Beginn der 90er Jahre von einer anfänglich innovativen Szene zu einem marktbeherrschenden Branding. Dass die Geschichte aber nicht nur von Landschaften geprägt ist und von daher über jene gestaltet und erschlossen werden kann, sondern im Gegenteil der landschaftliche Blick immer auch Geschichte tilgt, verdeutlicht eine Serie von Aquarellzeichnungen des Künstlers Tobias Rehberger (*1966) mit dem Titel „S.M.N. (Somme, Marne, Verdun)“ aus dem Jahr 1993.
Im einleitenden Text zu einer Wanderausstellung „Landschaften eines Jahrhunderts“ (1999) mit Landschaftsbildern aus der Sammlung Deutsche Bank heißt es: „Die frisch gepflügte Erde ist dunkelbraun aufgeworfen, über sich schachbrettartig ausbreitende Felder, sanfte Hügel und Niederungen ziehen die Wolken: Tobias Rehbergers 1993 entstandene Aquarell-Serie mutet wie die Fingerübung eines Hobbymalers an, der seine Staffelei in die Natur getragen hat, um die Stimmung des Frühjahrs festzuhalten; das zarte Grün des jungen Grases, den Verlauf der Wälder am Horizont, die wechselnden Blau- und Grautöne des Himmels. Bis zur Trivialität lieblich und harmlos erscheinen diese Landschaften, wäre da nicht die schockierende Desillusionierung, die bei der Reflexion des Titels eintritt: S.M.V. (Somme, Marne, Verdun). Die Idylle ist tatsächlich ein ehemaliges Schlachtfeld. So starben in der Region von Somme im Juli 1916 während einer alliierten Offensive über eine Million und bei einer deutschen Offensive im März 1918 weitere 380.000 Soldaten. Der Sehnsucht nach einer urtümlichen und unberührten Landschaft und Natur, stehen historische Schuld und Verfehlung gegenüber. Der Anblick der Felder aber verrät nichts von dieser Geschichte, er ist und bleibt - trotz all des vergossenen Blutes, trotz allen Leidens und Schreckens – banal.“[7] Rehbergers Arbeit referiert jedoch nicht nur auf den Prozess der historischen Verdrängung in unserer Sehnsucht nach einer „heilen“ Landschaft, sondern auch auf das Genre der Schlachtengemälde, die eine landschaftliche Verklärung von Kriegsgreueln im Ästhetischen darstellen.
Antoine-Jean Gros, Napoleon auf dem Schlachtfeld von Eylau, 1807, Musee du Louvre, Paris Die bewusst laienhafte Darstellung der Landschaft ist damit auch der Versuch, am Rand der Kunst einen neuen Blick auf die ideologische Tradition der Landschaftsmalerei zu gewinnen, die im Nationalsozialismus schließlich zum ausdrücklichen Propagandamittel wurde. Im Zwischenraum
Beispiele für eine Kunst, die diesen Versuch, der Dialektik zu entkommen, visualisiert und mit ihm die schmerzvolle Dimension kultureller Heterogenität erfahrbar macht, nämlich Reibung, Irritation und Fremdheit, sind die Installationen des Künstlers Chen Zhen (1955-2000). Nach dem Besuch einer Ausstellung im Jahr 2003 habe ich versucht, die Bedeutung der Kunst Zhens so zu umreißen: „Es geht bei Zhens Projekt sicher auch um eine Erweiterung kultureller Beschreibungsmodelle. Immer sind Elemente so zusammengefügt, dass sie als einzelne unverwechselbar und sperrig bleiben, und doch ist etwas zu einer untrennbaren Form geronnen. Seine Installationen entwerfen damit keine harmonischen Gestaltintegrale multikultureller Identität, sondern verkörpern Hybriden, deren Trennungslinien haarscharf und fast schmerzlich offen liegen und die darin "man's dominance over his environment" noch einmal mehr verbildlichen und befragen. Zhens Kunst betreibt kein Spiel mit den Kulturen, sondern sie zeigt das regellose (Regel-)spiel der Kultur.[8] 2007 war das Werk von Zhen in der Ausstellung „Chen Zhen. Der Körper als Landschaft“ in der Kunsthalle Wien zu sehen. Die Kuratoren finden für Zhens Arbeiten die zentrale Metapher der Landschaft und schreiben im Text zur Ausstellung: „Chens Installationen sind poetische Landschaften, ungewöhnliche Materialallianzen, Hybride, die Passagen und neue Verbindungswege zwischen fernöstlichen Traditionen und westlichen Avantgardebewegungen knüpfen. Das selbst gewählte Exil, die eigene Krankheit und die klassische chinesische Medizin verwebt er zu metaphorischen Objekten, die den Körper der Gesellschaft interpretieren und neu vermessen.“ In einer seiner letzten Arbeiten bricht Zhen das Problem der kulturellen Dialektik in Form einer modellhaften Abstraktion gleichsam noch einmal auf die elementare Ebene der Selbsterfahrung herunter: Die Installation „Crystal Landscape of Inner Body“ aus dem Jahr 2000 besteht aus elf in Kristallin gegossenen Organen, die in einem chirurgischen Bett zu einer Körper-Landschaft auf einem Tisch arrangiert sind. Es sind es die sinnlichen Eigenschaften der Formen, ihre aseptische Reinheit und ihre naturalistische Gestalt, die faszinieren und zugleich abstoßen. Zhen zeigt uns das durchsichtige Schema eines Organismus, unseres Organismus. So richtet die Installation unser Augenmerk auf die Tatsache, dass wir als körperliche Wesen selbst eine Landschaft ausbilden, einen Zwischen-Raum der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die Arbeit macht einsichtig, dass die Analogie zwischen dem Organismus der Landschaft und dem Organismus des Bildes letztlich ihren zentralen, gleichsam physischen Ausgangspunkt im Organismus des Menschen, in unser eigenen organischen Verfasstheit also, hat. „The external landscape is reflected in the crystal surface of the interior landscape of the body, underlining the relationship between internal and external causes, between the human body and society.“ Diese (Körper-)Landschaft ist, auch dies macht die Arbeit unmittelbar erfahrbar, äußerst fragil und darin kostbar. „However, it also reveals the value of life and how fragile it is.“ Zhen gelingt es, die Kulturgeschichte des Bildes als wechselnde Landschaft auf ihre existentiellen und ihre symbolischen Parameter zurückzuführen und sie zugleich erneut vor unseren Augen auszurollen. Darin liegt nicht nur eine analytische sondern sicher auch eine visionäre Kraft. Anmerkungen[2] Bürgerliche Paradiese. Parks und Gärten der Aufklärung und des Biedermeier in Friesland. Ausstellung im Schlossmuseum Jever 2007-2008. [3] K. Clark, Provincialism, The English Association Presidential Address, London 1962, S. 3. Zitiert nach E. Castelnuovo / C. Ginzburg, Zentrum und Peripherie. In: Italienische Kunst. Eine neue Sicht auf ihre Geschichte, hg. von G. Previtali u. F. Zeri, Berlin 1988, S. 23. [4] Italienische Kunst. Eine neue Sicht auf ihre Geschichte, Berlin 1988, S. 62. [5] A.a.O., S. 75. [6] A.a.O., S. 76. [7] Verlorener Ursprung, utopischer Schauplatz: Landschaftsmalerei in der Sammlung Deutsche Bank, db-artmag.de 2004 [8] K. Wendt, Chen Zhen: Residence – Resonance – Resistence (R – R – R), Magazin für Theologie und Ästhetik 24/2003 |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/62/kw64.htm
|
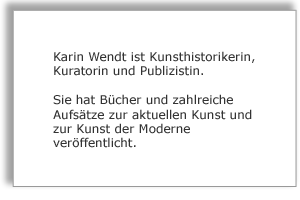 Wir sprechen von Landschaften, wenn wir etwas im Interesse seiner besonderen Formation, Gestaltung oder Organisation betrachten und es damit zugleich distanzierend beschreiben. Landschaften zu sehen, heißt zunächst, sich ein Bild von etwas zu machen. Es ist immer der begrenzende, konstellierende und von daher differenzierende aber auch idealisierende Blick auf einen Ausschnitt der Wirklichkeit, durch den sich die Vorstellung einer „Landschaft“ herausbildet und weiter tradiert. Darin vollziehen wir eine zweifache Bewegung: die der subjektiven Aneignung eines Raumes, einer Szene, einer Begegnung auf der einen und deren identifizierende Festlegung als ein bestimmter Ort, eine bestimmte Szenerie, eine bestimmte Erfahrung auf der anderen Seite. Wenn Landschaften ein Spiegel dafür sind, wo und wie wir Grenzen setzen, was uns charakteristisch erscheint und welche Dinge wir als zusammengehörig bzw. als different wahrnehmen (wollen), dann zeigt sich im Blick auf Landschaften bzw. auf Phänomene, die wir so bezeichnen, auch etwas von der Freiheit und Unfreiheit in unserem Umgang mit den Dingen. Die Kunst der Landschaft liegt in der Sichtbarmachung dieser Ambivalenz. Die Etablierung der Landschaft als eigenständiges Genre der Kunst gehört insofern sicher zu den wichtigen Schritten auf dem Weg in die Moderne, da sie die konkrete Befragung der Analogie zwischen Bild und Landschaft im 20. und auch noch 21. Jahrhundert vorbereitet. Die Landschaftskunst von Caspar David Friedrich bildet bereits ihr neuzeitliches Paradigma, indem sie über das Sujet der Landschaftsdarstellung die darin virulente Ideenwelt sichtbar macht. Erst die Künstler des 20. Jahrhunderts haben jedoch ein ausgeprägtes Sensorium für das Ideologem „Landschaft“ entwickelt und sich an der Analogie von Komposition und Landschaft gleichsam abgearbeitet. Dazu gehören die Arbeiten von Mark Rothko, in denen wir den Prozess der Entgrenzung und Verdichtung im Zuge landschaftlicher Wahrnehmung erfahren. Dazu gehören auch die akompositionellen Bilder von Barnett Newman, die die Landschaftsanalogie aufrufen, um sie zugleich zu überbieten. Aber auch der andere Weg einer systematischen Prozessualisierung und Öffnung kompositioneller Geschlossenheit, den Kasimir Malewitsch mit seiner Kunst des Suprematismus bereits zu Beginn des Jahrhunderts vorschlägt, gehört zu den elementaren Reflexionen über die abendländische Verknüpfung zwischen dem Bild- und dem Landschaftsbegriff. Wenn Malewitsch eine gegenstandslose Malerei proklamiert und von der notwendigen „Zertrümmerung der Dingwelt“ spricht, dann stellt er die Darstellungskunst im Sinne einer – landschaftlich – abbildenden Kunst in Frage und mit ihr die vielfältigen Weisen, wie wir die (Um-)Welt verdinglichen. Landschaftsformationen säumen gleichsam den Weg, den Kulturen auf der Suche nach sich selbst zurücklegen. Sie repräsentieren damit verdichtet und punktuell eben jene Prozesse der Vergegenständlichung, als deren Ausgang wir von der Welt und ihrer Verfasstheit und nicht zuletzt von uns selbst erfahren. Wir sind nicht nur von Landschaften umgeben, auf die wir beschreibend verweisen können, sondern wir sind so in sie verwoben, dass wir darin leben.
Wir sprechen von Landschaften, wenn wir etwas im Interesse seiner besonderen Formation, Gestaltung oder Organisation betrachten und es damit zugleich distanzierend beschreiben. Landschaften zu sehen, heißt zunächst, sich ein Bild von etwas zu machen. Es ist immer der begrenzende, konstellierende und von daher differenzierende aber auch idealisierende Blick auf einen Ausschnitt der Wirklichkeit, durch den sich die Vorstellung einer „Landschaft“ herausbildet und weiter tradiert. Darin vollziehen wir eine zweifache Bewegung: die der subjektiven Aneignung eines Raumes, einer Szene, einer Begegnung auf der einen und deren identifizierende Festlegung als ein bestimmter Ort, eine bestimmte Szenerie, eine bestimmte Erfahrung auf der anderen Seite. Wenn Landschaften ein Spiegel dafür sind, wo und wie wir Grenzen setzen, was uns charakteristisch erscheint und welche Dinge wir als zusammengehörig bzw. als different wahrnehmen (wollen), dann zeigt sich im Blick auf Landschaften bzw. auf Phänomene, die wir so bezeichnen, auch etwas von der Freiheit und Unfreiheit in unserem Umgang mit den Dingen. Die Kunst der Landschaft liegt in der Sichtbarmachung dieser Ambivalenz. Die Etablierung der Landschaft als eigenständiges Genre der Kunst gehört insofern sicher zu den wichtigen Schritten auf dem Weg in die Moderne, da sie die konkrete Befragung der Analogie zwischen Bild und Landschaft im 20. und auch noch 21. Jahrhundert vorbereitet. Die Landschaftskunst von Caspar David Friedrich bildet bereits ihr neuzeitliches Paradigma, indem sie über das Sujet der Landschaftsdarstellung die darin virulente Ideenwelt sichtbar macht. Erst die Künstler des 20. Jahrhunderts haben jedoch ein ausgeprägtes Sensorium für das Ideologem „Landschaft“ entwickelt und sich an der Analogie von Komposition und Landschaft gleichsam abgearbeitet. Dazu gehören die Arbeiten von Mark Rothko, in denen wir den Prozess der Entgrenzung und Verdichtung im Zuge landschaftlicher Wahrnehmung erfahren. Dazu gehören auch die akompositionellen Bilder von Barnett Newman, die die Landschaftsanalogie aufrufen, um sie zugleich zu überbieten. Aber auch der andere Weg einer systematischen Prozessualisierung und Öffnung kompositioneller Geschlossenheit, den Kasimir Malewitsch mit seiner Kunst des Suprematismus bereits zu Beginn des Jahrhunderts vorschlägt, gehört zu den elementaren Reflexionen über die abendländische Verknüpfung zwischen dem Bild- und dem Landschaftsbegriff. Wenn Malewitsch eine gegenstandslose Malerei proklamiert und von der notwendigen „Zertrümmerung der Dingwelt“ spricht, dann stellt er die Darstellungskunst im Sinne einer – landschaftlich – abbildenden Kunst in Frage und mit ihr die vielfältigen Weisen, wie wir die (Um-)Welt verdinglichen. Landschaftsformationen säumen gleichsam den Weg, den Kulturen auf der Suche nach sich selbst zurücklegen. Sie repräsentieren damit verdichtet und punktuell eben jene Prozesse der Vergegenständlichung, als deren Ausgang wir von der Welt und ihrer Verfasstheit und nicht zuletzt von uns selbst erfahren. Wir sind nicht nur von Landschaften umgeben, auf die wir beschreibend verweisen können, sondern wir sind so in sie verwoben, dass wir darin leben.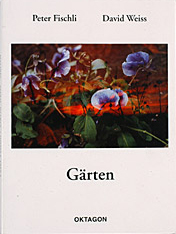 Gleichwohl birgt das Modell des Gartens auch in sich eine Problematik. Sie liegt darin, dass man jedes Konfliktpotenzial ausblenden muss und das Moment der Verschiedenheit nur insoweit wahrnehmen kann, als es ohne Reibung neben- und miteinander zu existieren vermag. Dass die Idee vom Garten diese andere Geschichte selbst schreibt bzw. fortschreibt, nämlich die der Verdrängung und Unterdrückung des Wilden und Triebhaften, generell des anderen, thematisiert die Arbeit „Garten“ (1990) von den Künstlern Fischli & Weiß. Die vierfarbige Fotolithographie zeigt den Blick in einen Schweizer, insgesamt aber für den deutschsprachigen Raum typischen Schrebergarten. Man sieht die charakteristische üppige Bewachsung, die die eng und geradlinig gezogenen Beetbegrenzungen fast zu sprengen scheint. Die künstlerische Nobilitierung eines eher im Kleinbürgerlichen verhafteten Sujets vergegenwärtigt die darin verborgene Ideologie einer gestutzten und bis ins soziale Miteinander vielfältig reglementierten Ordnung.
Gleichwohl birgt das Modell des Gartens auch in sich eine Problematik. Sie liegt darin, dass man jedes Konfliktpotenzial ausblenden muss und das Moment der Verschiedenheit nur insoweit wahrnehmen kann, als es ohne Reibung neben- und miteinander zu existieren vermag. Dass die Idee vom Garten diese andere Geschichte selbst schreibt bzw. fortschreibt, nämlich die der Verdrängung und Unterdrückung des Wilden und Triebhaften, generell des anderen, thematisiert die Arbeit „Garten“ (1990) von den Künstlern Fischli & Weiß. Die vierfarbige Fotolithographie zeigt den Blick in einen Schweizer, insgesamt aber für den deutschsprachigen Raum typischen Schrebergarten. Man sieht die charakteristische üppige Bewachsung, die die eng und geradlinig gezogenen Beetbegrenzungen fast zu sprengen scheint. Die künstlerische Nobilitierung eines eher im Kleinbürgerlichen verhafteten Sujets vergegenwärtigt die darin verborgene Ideologie einer gestutzten und bis ins soziale Miteinander vielfältig reglementierten Ordnung. 


 Durch den Perspektivwechsel, den wir vollziehen, wenn wir nicht mehr von Peripherie und Zentrum, sondern vom Zwischenraum, vom Schwellenbereich oder dem Übergang sprechen, haben wir die Möglichkeit, uns in einem eigenwertigen „dritten Raum“, einer heterogenen Landschaft, zu erfahren. Dies ist ein Versuch, den Zentrismus des „Garten“-Modells und die dem Peripheriebegriff eingeschriebene Hierarchie zu überwinden.
Durch den Perspektivwechsel, den wir vollziehen, wenn wir nicht mehr von Peripherie und Zentrum, sondern vom Zwischenraum, vom Schwellenbereich oder dem Übergang sprechen, haben wir die Möglichkeit, uns in einem eigenwertigen „dritten Raum“, einer heterogenen Landschaft, zu erfahren. Dies ist ein Versuch, den Zentrismus des „Garten“-Modells und die dem Peripheriebegriff eingeschriebene Hierarchie zu überwinden.