
Ästhetisierung von Religion? |
||||
Idolatrie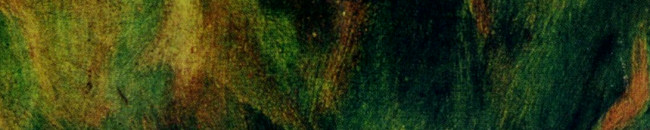
BeobachtungenAndreas Mertin
Westeuropäer, die auf Ikonen treffen, wissen das oft nicht und halten Ikonen für Kunstwerke, die z.B. im Sinne des Barock an der wahrgenommenen Inszenierung gemessen werden. In Wirklichkeit sind Ikonen aber allenfalls Buchillustrationen vergleichbar, die den vorgegebenen Gegenstand besser oder schlechter umsetzen und zudem nur akzeptabel sind, wenn jede abgebildete Figur zugeordnet werden kann. Ikonenmalerei ist keine freie Kunst im Sinne des Endergebnisses europäischer Aufklärung, sondern von Technikern geschaffene und von Klerikern zertifizierte Glaubenslehre. Wer den Unterschied zwischen freier Kunst und Ikonenmalerei einmal präzise beobachten will, kann dies an einem berühmten kunsthistorischen Beispiel tun:
Es ist also ob Jahrhunderte zwischen beiden Bildern lägen und es sind doch nur wenige Jahre. Links sehen wir religiöses Kunsthandwerk, rechts freie Kunst. Man spürt dem linken Bild schon an, wie sehr es seinen Schöpfer aus dem engen Schablonenhandwerk hinausdrängt, wie gerne er mit kühnen Farben die Stofflichkeit des Geschehens einfangen würde, allein er darf es nicht. Dazu muss er sich schon emanzipieren und Kreta verlassen und über Venedig, Rom, Madrid nach Toledo reisen. Er befreit sich nicht von der Kirche, wohl aber von den malerischen Vorgaben, die sein Talent einengen. Man muss die schier unendliche Distanz zwischen diesen beiden Bildern intellektuell nachvollziehen, um zu begreifen, was freie Kunst leistet und inwiefern sie mit der Emanzipation der Menschheit aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit in eins geht. Das alles muss vorausgeschickt werden, um die Auseinandersetzung mit dem folgenden Bild zu verstehen, das aus dem Ordo der orthodoxen Bildertheologie stammt und das keinen Geist menschlicher Freiheit atmet, sondern liturgische Vorgaben sklavisch umsetzt und allenfalls minimale Varianzen gegenüber byzantinischen Vorbildern zulässt. Wer also wissen will, was Bildschaffen als ancilla ecclesiae meint, kann das hier ebenfalls geradezu physisch erfahren:
Geburt Christi; Andrei Rubljow, (* um 1360; † 29. Januar 1430 in Moskau) Diese so genannte Weihnachtsikone stammt aus dem Jahr 1405 und wird Andrej Rubjow zugeschrieben. Für einen westlichen Betrachter muss vieles auf dem Bild zunächst unvertraut erscheinen, weil die westliche Ikonographie hier zum Teil ganz andere Bildlösungen gefunden hat. Zu den in westlicher Perspektive sich darstellenden Eigentümlichkeiten dieser visuellen Simultanerzählung gehört sicher die Geburt in einer Grotte, zumal mit einer deutlichen Abtrennung der Maria vom Geburtsgeschehen. Zu den Eigentümlichkeiten gehört auch, dass hier, anders als in der westlichen Tradition, nicht Jesus, sondern Maria – und hier ihr Schoß – den Bildmittelpunkt bildet. Alles, was um den Bildkern kreist, hat einen Bezugspunkt auf diesen Schoß hin. Nicht weil Maria eine Gottesgebärerin (Theotókos) ist, wie man vielleicht meinen könnte, sondern weil alles darauf abzielt, die postnatale Jungfräulichkeit der Maria sicherzustellen. Dieses Bild ist ein durch und durch dogmatisches Bild, es gilt der Immerwährenden Jungfräulichkeit Marias. Nach Martin Luther ist aber Marias Verehrung als immerwährende Jungfrau Götzendienst. Wir haben es hier also mit einem kontroverstheologischen Bild zu tun, dem Protestanten kaum zustimmen können. Inwiefern spielt die Jungfräulichkeit der Maria hier so eine besondere Rolle? Das ergibt sich aus der Narratio des Bildes. Schauen wir uns das Geschehen am rechten unteren Bildrand an, dann sehen wir zwei Frauen vor einem kleinen Badezuber, eine davon mit einem Kind auf dem Schoß, die andere mit einer Karaffe von frischem Wasser.
Wie passt diese Szene auf ein Bild von der Geburt Christi? Sie geht in der ältesten Variante zurück auf das Protoevangelium des Jakobus. Im Gegensatz zu den Geburtsgeschichten der Evangelien Matthäus und Lukas geht das Protevangelium über die dortige Darstellung der Geburt Jesu hinaus und erzählt zudem ausführlich von der Herkunft Marias, der Mutter Jesu. Entstanden sein dürfte es zwischen 150 und 200 n.Chr. und bezeichnet sich als Offenbarung über den Ursprung der Maria. Vieles was wir auf mittelalterlichen Bildern der Geburt Christ finden, das sich nicht auf die biblischen Schriften zurückführen lässt, geht auf diesen Text zurück, dessen Verfasser aber kaum ortskundig gewesen sein dürfte. Eine jüngere Variante ist das Pseudo-Matthäus-Evangelium aus dem 8./9. Jahrhundert n. Chr., in dem die Geschichte noch ausgeschmückt wird. Gezeigt werden hier jedenfalls zwei Hebammen bei der Arbeit, eine trägt den Namen Zelomi. Diese bittet Maria, sie anfassen und untersuchen zu dürfen. Und das Ergebnis? Zelomi ruft aus: "Herr, großer Herr, erbarme dich! Niemals hat man gehört, ja nicht einmal geahnt, daß die Brüste voller Milch sein können und doch der neugeborene Knabe seine Mutter als Jungfrau erweist. Keine Verunreinigung mit Blut erfolgte bei dem Kind, keine Schmerz bei der Gebärenden. Als Jungfrau hat sie empfangen, als Jungfrau geboren, Jungfrau ist sie geblieben." Da werden die neuzeitlichen medizinischen Grundkenntnisse arg strapaziert und in Frage gestellt. Die andere Hebamme heißt Salome und ist eine Art literarisches Zwillingsstück zum ungläubigen Thomas, denn diese Hebamme zweifelt an der Jungfräulichkeit der Maria: Da Maria die Berührung erlaubte, führte Salome mit ihrer Hand die Prüfung durch. Und wie sie Maria prüfend berührte, verdorrte sogleich ihre Hand. Vor Schmerz begann sie, heftig zu weinen, sich zu ängstigen und zu rufen: … Siehe, ich bin erbärmlich geworden wegen meines Unglaubens, weil ich es wagte, deine Jungfrau auf die Probe zu stellen." Erst auf ihr verzweifeltes Flehen und nachdem sie den Saum der Windeln(!) Jesu berührt hatte, erhält sie ihre Hand wieder. Wir lernen daraus, dass Gott bezüglich der Immerwährenden Jungfräulichkeit Marias nicht mit sich spaßen und schon gar nicht sich in Frage stellen lässt. Man wird dies als frühe populärkulturelle Phantasie des Christentums bezeichnen können, die – ganz dem Tun-Ergehens-Zusammenhang verpflichtet – die Strafe auf den Zweifel folgen lässt. In der Bibel finden sich diese eher magisch orientierten Erzählungen nicht. Ähnlich ist es mit Ochs und Esel, die vermutlich aufgrund von Jesaja 1,3 hier ihren Platz finden, worauf uns ebenfalls das Pseudo-Matthäus-Evangelium hinweist: Am dritten Tag nach der Geburt des Herrn verließ Maria die Höhle und ging in einen Stall. Sie legte den Knaben in eine Krippe; Ochs und Esel huldigten ihm. Da ging in Erfüllung, was der Prophet Jesaja gesagt hatte: "Es kennt der Ochse seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn." Bis heute hat diese Tieradaption mit antijudaistischer Spitze nichts von ihrer volkskulturellen Attraktivität verloren. Dass Ochs und Esel den Herrn erkennen, das jüdische Volk aber nicht, bildet die argumentative Grundlage für all die Judenverfolgung in späteren Zeiten.
Kommen wir zu der merkwürdigen Szene auf der linken unteren Seite der Ikone. Wir sehen Joseph mit einer kleinen bärtigen Figur im Fellumhang, die vor ihm steht. Joseph können wir leicht identifizieren, er spielt zwar im engeren Geburtsgeschehen keine große Rolle (außer später in den Visionen der Brigitta von Schweden), hat aber in der Dramaturgie der apokryphen Überlieferung seinen präzisen Platz: als alter Mann am Rande des Geschehens, der mit sich selbst im Zweifel ist, wie er sich gegenüber Maria verhalten soll. Für die Figur rechts von ihm gibt es nun verschiedene Deutungen: religiöse, kunsthistorische und andere. Einige meinen, hier sei der Prophet Jesaja abgebildet, der Joseph das Kommen des Gottesknechts ankündigt. Dagegen sprechen mehrere Gesichtspunkte. Zum einen hatte Joseph das zur Zeit der Geburt ja gar nicht mehr bezweifelt. Wir müssten es hier also mit einem massiven Zeitsprung zu tun haben. Zum zweiten gibt es keine Weihnachtsikone, auf der diese Figur als Jesaja bezeichnet ist, was ungewöhnlich angesichts der diesbezüglichen Tradition der orthodoxen Ikonenmalerei ist. Vor allem aber trägt diese Figur keinen Nimbus. Jesaja wird aber – anders als in der westlichen Tradition – in der östlichen Tradition immer mit Nimbus gekennzeichnet. Das lässt vermuten, dass wir es hier nicht mit Jesaja zu tun haben. Bliebe als nächste Deutung, dass wir hier den Hohepriester Annas vor uns haben, der Joseph nach der Schwangerschaft der Maria befragt. Auch in diesem Falle fiele die Narratio aus dem zeitlichen Kontext des Bildes heraus, fand dieses Gespräch doch lange vor der Zeit der Geburt statt. Ganz ausgeschlossen werden kann diese Bezugnahme aber nicht. Zum Dritten könnte man vermuten, dass es sich um eine Art Versucher handelt, der Joseph damit in Versuchung führt, dass er die Jungfräulichkeit der Maria vor, während und nach der Geburt bezweifelt. Auch das ist eine nicht auszuschließende Möglichkeit, vielleicht eine, die aufgrund eines künstlerischen Betriebsunfalls zustande gekommen ist. Denn aufgrund der Fellkleidung des Gesprächspartners legt sich eine ganz andere, rationale Deutung nahe: Ursprünglich war Joseph vermutlich auf der rechten unteren Seite der Weihnachtsikonen platziert (dafür gibt es zahlreiche Belege). Und einem Maler ist aus Platzgründen einer der darüber platzierten Hirten „heruntergerutscht“ und dieser hat nun in der Interaktion mit Joseph eine eigene Rolle bekommen. Dann brauchte man eine Legitimation für diese Figur, die scheinbar mit Joseph im Gespräch versunken war. Und da boten sich die gerade skizzierten Lösungen an. Man könnte nun Punkt für Punkt die weiteren Szenen des Bildes durchgehen. Herausgehoben seien vielleicht noch einige Besonderheiten: Im Zentrum des Bildes liegt Maria, den Rücken der ‚Geburtsgrotte’ zugewandt und auf einer roten Matratze platziert.
Man muss nicht gleich von einer postnatalen Depression sprechen, aber diese demonstrative Abwendung ist sicher nicht zufällig dargestellt. Da Maria – genauer ihr Schoß – das Zentrum des Bildes bildet, haben wir es auf keinen Fall mit einer abwertenden Darstellung zu tun. Im Lexikon der christlichen Ikonographie wird diese Darstellung auf die paläologische Zeit datiert und Maria als „geschwächte Wöchnerin“ bezeichnet. Trotzdem wird Maria hier hervorgehoben – auf Kosten und zu Lasten des Kindes. So ganz und gar nicht passt die purpurne Unterlage zur Geburt in der Futterkrippe. Hier wird auf jede Einfühlungsästhetik verzichtet, denn welche Mutter würde ihr Kind in der Krippe liegen lassen, wenn ihr eine weiche Matratze aus dem Herrschaftshaus zur Verfügung stünde?
Die Grotte geht auf die Überlieferung des Protoevangeliums des Jakobus bzw. auf das Pseudo-Matthäus-Evangelium zurück. Hier ist die Grotte erst verdunkelt und dann vom Kind erleuchtet. Vielleicht spielen hier auch Pilgerberichte vom Besuch der Grotte in Bethlehem eine Rolle.
Die Magier oder Könige sind links oben auf dem Bild lokalisiert, sie ziehen weniger zur Grotte als zum leitenden Stern, der dann auf die ‚Geburtsgrotte’ verweist. Die Hirten auf der rechten Seite sind etwas nahe an Maria geraten, gehören aber eigentlich zum Engel oberhalb, der ihnen die Botschaft verkündigt. Wenn wir zur Kontrolle auf eine etwas später entstandene russische Weihnachtsikone blicken, haben wir noch einmal den klaren (wenn auch leicht variiierten) Aufbau vor uns.
Deutlicher ist hier noch einmal die Bergkonstruktion des Bildes mit der Grotte als tiefem Loch. Deutlicher ist hier auch die Tatsache, dass es sich um eine Sammelgeschichte handelt, deren narrative Ebenen unterschiedlichen Zeitpunkten zuzuordnen sind. Und es wird deutlicher, dass wir es hier mit einem dogmatischen Bild zu tun haben, das viele Fragen abfangen und beantworten soll, die den Menschen beim Zuhören der Weihnachtsgeschichte bis heute kommen. Zur ideologischen BildkonstruktionEin moderner Beobachter wird dieser dogmatischen Konstruktion nicht folgen können. Wie auch die westlichen Weihnachtsbilder geben die Ikonen nicht das Geschehen nach der biblischen Überlieferung wieder. Sie beziehen sich auf außerbiblische Überlieferungen, die ihrerseits den Zweck hatten, bestimmte Leerstellen des biblischen Textes zu füllen und legitimatorisch zu unterlegen. Wie war das mit der Geschichte der Maria? Was für eine Rolle spielt Joseph? Was ist das für eine Geschichte mit der Immerwährenden Jungfräulichkeit der Maria? Insofern dabei die visuellen Gewichte verschoben werden – also z.B. weg vom Jesuskind, hin zur Maria als wahrem Zentrum des Bildes und des Geschehens – wird hier auch eine ideologische Konstruktion vollzogen. Dienten die Bilder zunächst zur Sicherung des Nachweises der wahren Inkarnation Jesu Christi, so werden sie nun zum Verstärker bestimmter späterer ideologischer Ausformungen. Verehrung genießt nicht mehr primär das Gotteskind, sondern die Gottesmutter. Wenn das so ist, ist man gezwungen, darauf ideologisch zu reagieren. Niemand kann sagen, lass dich doch einfach mal spirituell auf diese Ikone ein, wenn das ideologische Ziel dieser Annäherung die Verherrlichung Marias bzw. ihrer Jungfernschaft ist. Sonst könnte man mit der gleichen Logik den ästhetisch-spirituellen Inszenierungen von Satanisten folgen. Die ästhetische Konstruktion ist hier immer zugleich auch ideologische Konstruktion, beginnend vom Goldgrund und endend bei der mirakulösen Darstellung der Maria, die eben nicht mehr die Verklärung des Gewöhnlichen aus dem biblischen Magnifikat ist. Ich will an dieser Stelle gar nicht erst fragen, ob es von hier aus nicht auch eine direkte Verbindung zur frauenverachtenden Haltung der orthodoxen Kirche in der Gegenwart gibt, die meiner eigenen Kirche die Kommunikation verweigert, weil sie eine geschiedene Frau an die Spitze gewählt hat und deshalb lieber in den Worten des Erzbischof Ilarion von Volokalamsk mit dem „jahrelangen Freund, Bischof Wolfgang Huber, als Leiter der Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland“ sprechen möchte. Es lebe die Männergesellschaft! Man kann sich aber auch nicht bloß auf die „techne“ der Ikonen konzentrieren, als wäre diese gegenüber der mit ihrer Hilfe ausgedrückten Botschaft neutral. Wenn man diese Bilder ernst nimmt, dann muss man sie auch als Herausforderung begreifen. Man muss sie studieren und deutlich machen, wo sie dem eigenen Glauben und der eigenen kulturellen Tradition zutiefst zuwider laufen. P.S.Dieser Text sollte eigentlich an anderer Stelle erscheinen. Gedacht war er für die Diskussion der Weihnachtsikone von Rubljow im Bildforum auf der religionspädagogischen Plattform rpi-virtuell. Dort war dieses Bild im Dezember 2009 das so genannte „Bild des Monats“. Es wird den Nutzern zur Betrachtung vorgeschlagen und diese tauschen sich darüber einen Monat aus. Und dabei war aus den oben erwähnten Gründen der Vorschlag, gerade dieses Bild auf einer von der EKD getragenen Plattform zu Weihnachten zu meditieren, wie es dort so schön heißt, schon eine klare Gratwanderung. Es hätte nur funktionieren können, wenn alle Beteiligten ihre religiösen und ästhetischen Voraussetzungen offen gelegt hätten, wenn sie das Bild exakt wahrgenommen hätten und bereit gewesen währen, sich auf eine begründete Stellungnahme zu den literarischen Bezugstexten dieses Bildes einzulassen. Es hätte auch vorausgesetzt, dass sich die Teilnehmer an diesem Gespräch vor einem Gemälde im frühromantischen Stil über die Haltung ihrer eigenen Konfession zu diesen Fragen bewusst gewesen wären. Die vielen Konjunktive zeigen an, das dies heute nicht mehr der Fall ist. Dass Bilder seit 2000 Jahren im Christentum zwischen den Kirchen und Konfessionen kontrovers diskutiert werden und zum Teil ja nun seit 1167 Jahren als kirchentrennend angesehen werden, spielt heute keine Rolle mehr. In Zeiten, in den Protestanten aus der Evangelischen Kirche austreten, weil der Papst angeblich etwas Falsches gesagt hat, kann man nun auch so tun, als könnten alle Christen eine orthodoxe Ikone unter gleichen Voraussetzungen meditieren und verehren, indem sie sich auf die orthodoxe Liturgie einlassen. Genau das geht aber nicht. Vielmehr muss ein jeder seinen Erwartungshorizont bedenken, ihn mit der Wahrnehmung des Bildes und den dazu notwendigen Informationen abgleichen und dann dazu Stellung beziehen. Es gibt keine eindeutige Lesart eines Bildes, auch keiner Ikone. Alles andere hieße, die unentrinnbaren Horizonte des Betrachters außer Acht zu lassen. Auf der genannten Plattform war man aber nicht bereit, diese hermeneutischen Grundvoraussetzungen zu akzeptieren. Sondern es wurde ein Zugang exklusiv bevorzugt und dieser setzte dann bei anderen Teilnehmern schlichtweg ein Sacrificium intellectus voraus. Wenn man sich nicht daran hielt, wurde man gebeten, sich aus der Diskussion herauszuhalten, damit die anderen ungestört die orthodoxe Liturgie meditieren konnten und nicht von zu vielen Informationen irritiert würden. Das macht ein Gespräch über Bilder sinnlos. Zum anderen war ich überrascht, dass ein Gespräch über Bilder geführt werden sollte, bei dem die Betrachtung des Bildes dann gar keine Rolle mehr spielte, sondern man gleich zur Erörterung der zu Grunde liegenden Liturgie weiterging: 'Pictura loquitur … ut populus ad ecclesiam trahatur''. So hätten sie es gerne. Bei der Bildmeditation konkret spielte es dann keine Rolle mehr, ob eine Szene rechts oder links, oben oder unten, mit einer Figur oder zwei Figuren, mit gold oder mit blau ausgestattet war – Hauptsache man landete bei die orthodoxen Liturgie. Mit anderen Worten, all das, was in der Entwicklung der westlichen Kunst seit der Frührenaissance eine zentrale Rolle spielt, sollte plötzlich hinfällig sein. Wieder einmal verstand ich, was Paul Valery meinte, als er schrieb, die Mehrzahl der Menschen nähme Bilder nicht mit den Augen, sondern mit dem Wörterbuch wahr: "Anstelle farbiger Räume nehmen sie Begriffe in sich auf. Eine kubische weißliche Form, die hochsteht und mit Reflexen von Glasscheiben durchschossen ist, nennen sie mir nichts dir nichts ein Haus, was für sie soviel heißt wie: Das Haus! Statt dessen gilt es sich daran zu erinnern, dass ein Gemälde - bevor es ein Schlachtross, eine nackte Frau oder irgendeine Anekdote ist - wesentlich eine ebene Oberfläche ist, bedeckt mit Farben in einer bestimmten Anordnung." Während man im ausgehenden 20. Jahrhundert, also in der Zeit zwischen 1980 und 2000, noch davon ausgehen konnte, dass auch religiöse Menschen bereit waren, Bilder überhaupt erst einmal wahrzunehmen, bevor sie sie mit der religiösen Abbreviatur erschlugen, kann selbst das heute nicht mehr vorausgesetzt werden. Warum noch hinschauen, wenn man sich der Sache doch sicher ist, oder in orthodoxer Lesart, wenn die Wahrheit des Bildes durch das heiligende externe Wort sichergestellt wird. Warum das allerdings noch unter ästhetischer Bildung laufen sollte, ist mir fraglich. Letztlich handelt es sich um eine verkappte Form der Idolatrie, oder wenn das etwas etwas besser klingt: von Ikonodulie. |
||||
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/63/am306.htm
|
 Der Umgang mit Bildern im Allgemeinen und Bildender Kunst im Speziellen ist nicht leicht, nicht nur, wenn es sich um Bilder der zeitgenössischen Kunst oder der Medien der Gegenwart handelt. Gerade im Blick auf historische Bilder fehlen oftmals die Voraussetzungen, sich den Bildern sachadäquat zu nähern, also das unentbehrliche Hintergrundwissen, vor dem sich die konkrete Bildgestalt erschließt. Oftmals fehlt aber auch der Wille genau hinzuschauen, sich Fragen zum Bild zu stellen, neugierig auf Differenzen und Abweichungen zu sein. Statt dessen wird ein religiöser Text wie Soße über das Bild gekippt, so dass das Spezifische des Bildes gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Seit der Frühzeit der Bilder im Christentum begleiten Sicherungsmaßnahmen die Wahrnehmung des Bildes, steuern sie, lassen eine ungefilterte und ergebnisoffene Annäherung kaum noch zu. Worte überdecken das Bild statt es zu erschließen. Die orthodoxe Kirche hat sich schon früh dazu bekannt, dass Bilder nur gültig sind, wenn sie mit entsprechenden Tituli versehen werden, so dass die „Wahrheit“ der Bilder quasi von außen und durch das Wort garantiert wird.
Der Umgang mit Bildern im Allgemeinen und Bildender Kunst im Speziellen ist nicht leicht, nicht nur, wenn es sich um Bilder der zeitgenössischen Kunst oder der Medien der Gegenwart handelt. Gerade im Blick auf historische Bilder fehlen oftmals die Voraussetzungen, sich den Bildern sachadäquat zu nähern, also das unentbehrliche Hintergrundwissen, vor dem sich die konkrete Bildgestalt erschließt. Oftmals fehlt aber auch der Wille genau hinzuschauen, sich Fragen zum Bild zu stellen, neugierig auf Differenzen und Abweichungen zu sein. Statt dessen wird ein religiöser Text wie Soße über das Bild gekippt, so dass das Spezifische des Bildes gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Seit der Frühzeit der Bilder im Christentum begleiten Sicherungsmaßnahmen die Wahrnehmung des Bildes, steuern sie, lassen eine ungefilterte und ergebnisoffene Annäherung kaum noch zu. Worte überdecken das Bild statt es zu erschließen. Die orthodoxe Kirche hat sich schon früh dazu bekannt, dass Bilder nur gültig sind, wenn sie mit entsprechenden Tituli versehen werden, so dass die „Wahrheit“ der Bilder quasi von außen und durch das Wort garantiert wird.







