
SÜNDE |
Das ‚sündige Selbst‘Zu einer gravierenden Ambivalenz des christlichen Liebesbegriffs in Reflexion auf Augustinus, Hannah Arendt und Christian ThomasiusFrauke Kurbacher
Daß die Themen Christentum und geschlechtliche Liebe ein problematisches Feld bilden, scheinen jüngste Ereignisse und Aufdeckungen vor allem in der katholischen Kirche auf traurige und erschreckende Weise zu bestätigen. Die Problematik umfaßt jedoch zweifelsohne beide großen christlichen Konfessionen und darüber hinausgreifend, weitaus größer gedacht, das Verhältnis von „Liebe und Person“ im abendländischen Kontext überhaupt und den zumeist vermeidenden Diskurs über Leiblichkeit.[2] Ohne jedoch den im einzelnen oft noch aufzuweisenden und zu differenzierenden Gemeinplatz einer ‚Leibfeindlichkeit‘ des Christentums an dieser Stelle bemühen zu wollen, sei hier eher auf die möglichen Ursachen dafür reflektiert, nämlich auf eine problematische Auffassung der Person, wie sie in der Verbindung mit dem interpersonellen Liebesphänomen zu Tage tritt. Und es sei zugleich vielmehr umgekehrt darauf geschaut, daß es gegenüber den vielen theologischen Ausführungen zur Gottesliebe weitaus weniger theoretische Überlegungen zu positiven profanen Liebesverständnissen im abendländischen Denken gibt. Ihre Reflexion ist fast gänzlich dem Bereich des Ästhetischen überlassen worden. Die abendländische Geschichte des Selbst hingegen zeugt zumeist von der Exklusion des Konkreten und Interpersonellen, die im 20. Jahrhundert als Defizit schmerzlich bewußt wurde. Welchen Anteil hat ein spezifisches Denken von Liebe und Nahbeziehungen darin, von denen anzunehmen ist, das sie als per se interpersonelle Relationen eine besondere Rolle für die Individuierung von Personen spielen, weswegen der Philosoph Michael Quante auch überhaupt von „Individuierung in Relation“ spricht? Aber kann die Liebe wirklich Sünde sein? Die aufgeworfene Problematik der Ausschließung des Konkreten, Interpersonellen und Individuellen findet einen Anhalt in der theoretischen, philosophischen Exposition des Zusammenhangs von Liebe und Person in einer speziellen Verschränkung beider bei Augustinus. Als philosophisches Problem möchte ich also die theoretische Lücke und Unterbestimmtheit von glückenden, konkreten und geschlechtlichen Liebesvorstellungen im Abendland aufwerfen und das Augenmerk auf zwei Positionen lenken, die sich eingehend mit der Thematik in kritischer Absicht auseinander gesetzt haben: Hannah Arendt im 20. Jahrhundert und Christian Thomasius im beginnenden „Zeitalter der Aufklärung“, im 18. Jahrhundert. Beide Konzeptionen, die in diametraler Spannung zueinander stehen, kommen bei aller Verschiedenheit der Anlagen letztlich selbst auch zu recht ambivalenten Ergebnissen in ihrer Betrachtung des Liebesphänomens. Dennoch tragen sie beide Entscheidendes zum Liebes-Diskurs bei. Es bleibt zu fragen, inwiefern die von ihnen bedachten Liebeskonzepte auch der gegenwärtigen Debatte einen neuen und anderen Wink zu geben vermöchten. Arendt und auch Thomasius machen bereits einige Vorstöße in die Richtung einer Generalreflexion, Diskussion und Kritik des abendländischen Liebesbegriffs, doch die entscheidende Tragweite wird letztlich erst ersichtlich, wenn über beide hinausgehend – und zwar an einem Punkt, an dem sich beide aus unterschiedlichen Gründen und Motivationen eher bedeckt halten – die persontheoretische Dimension in den Blick kommt. Im Folgenden soll das Denken des Selbst bevor es bei Thomasius ein produktives, philosophisches Programm des „Selbstdenkens“ wird, das noch Kant aufgreift, mit Blick auf die Liebesthematik bei Augustinus, Arendt und Thomasius betrachtet sein.
Bei Augustinus findet sich eine folgenreiche Verzahnung des philosophischen Denkens von Individualität, Liebe und transzendentem Bezug. Der Mensch, der sich selbst zur Frage wird, aber mit allen anderen den einen Wunsch teilt, zu leben und zwar wirklich zu leben, begibt sich somit auf die Suche danach. Da in der Vorstellung Gottes sowohl diejenige von wahrem, ewigem Leben und Liebe zusammenschießen, ist es zugleich eine Selbst-, Lebens-, Liebes- und Gottessuche. Das Ziel dieser Bewegung liegt außerhalb des Selbst. Gesucht wird qua Liebe – einem liebendem Begehren (appetitus) - , die sich als cupiditas in der und an die Welt verlieren kann oder als auf Gott gerichtete caritas ihr telos vielleicht erreicht. Anders aber als beispielsweise noch in der reziproken Freundschaftsliebe im antiken, aristotelischen Konzept der philia, können nun unter den Vorbehalten gegenüber der Welt und ihrer Hinfälligkeit, weder dieselbe, noch der Andere die Nahbeziehung mehr spiegeln. Der Freund im Freundschaftsverhältnis erhält direkten Aufschluß über sein Handeln im Zusammenspiel mit dem Freund. Für das Selbst bei Augustinus, dessen Liebesbeziehung grundlegend asymmetrisch zwischen diesem Selbst und der höheren Instanz Gott angelegt ist, vollzieht sich hier hingegen eine Wendung nach innen, die auch den Beginn einer Thematisierung von „Innerlichkeit“ markiert.[4] Welt und Andere können diese Selbstvergewisserung nicht mehr bieten. Das Selbst bleibt auf die Befragung seiner selbst und seines Willens angewiesen. In diesem Geschehen kann es jedoch auch nicht mehr um das Selbst in einer konkreten Form gehen, die Individualität in ihrer jeweiligen Besonderheit, weil sie ebenso weltlich und endlich wäre. Mehr noch, es wird verlangt, genau von diesem weltlichen Selbst Abstand zu nehmen, - es zu verleugnen, denn selbst in seinem Innern steht es um den Menschen nicht gut: „So, ja so, so ist der Mensch in seinem Innern: blind und schlaff, schlumpig und unanständig“.[5] Individualität als solche, als Vorgang der Besonderheit und Vereinzelung umfaßt, ist im Rahmen von Überlegungen zu Möglichkeiten von Gottesferne per se ein, wenn letztlich auch unumgängliches Problem. Die Ambivalenz des individuellen Selbst ist unhintergehbar, - ohne Individualität gibt es keine Entfernung von der Gottesliebe, aber auch keine Hinwendung zu ihr. Das Selbst kann diese Individualität weder vermeiden, noch aber begrüßen. Augustinus, sowohl als Kirchenvater beider großen Konfessionen als auch als derjenige, der als erster Autobiograph in die Geistesgeschichte eingeht, initiiert über diese Triangel-Konstellation aus Liebe, Individualität und Gott ein überaus problematisches, ambivalentes Selbstverhältnis, das nicht nur Züge einer Exklusion alles Kontingenten wie Gefühle, Leib und letztlich alles Individuellen aufweist, sondern durch eine von ihm positiv eingeforderte Selbstverleugnung das Selbst in selbstreflexiver Weise dauerhaft an sich selbst zurückbindet, die es ebenso zentriert wie leert. Beide Momente gewinnen im Denken des Selbst durchaus auch produktive Facetten und Konturen im Laufe der Rezeption und finden sich vielfach in abendländischer Geistesgeschichte, - auch da noch, wo gar keine religiöse Verankerung mehr benannt und u.U. auch nicht mehr bewußt ist. Doch entwickelt sich all dies um den Preis, permanent ein Problem mit dem Kontingenten, Besonderen und Individuellen, zu dem u.a. Gefühle und Leiblichkeit zählen, in philosophischer Theorie zu erwirken. Der Blick auf das Allgemeine ist zwar bereits seit der Antike die vornehmliche und eine ja auch durchaus sinnvolle Blickrichtung, aber bei Augustinus verschraubt sie sich über die Liebes- als Gottesliebe-Figur mit einer Selbstreflexion, in der – worauf Arendt zurecht aufmerksam macht -, nicht nur das Selbstverhältnis nachhaltig gestört wird, sondern auch vor allem das Verhältnis zum Anderen, zum Nächsten. Augustinus ist Arendt letztlich nicht paulinisch genug. „Pseudo-christlich“ wird er ihr, weil sie wähnt, daß ohne Anerkennung und Wertschätzung des Weltbezugs, der Nächste bei Augustinus Gefahr läuft, im bloßen Wunsch nach Gottgefälligkeit funktionalisiert zu werden, was jedem Verständnis von Nächstenliebe und Liebe überhaupt zuwider läuft.[6] Auffällig ist dabei überdies, daß die Themen von Liebe und Freundschaft, eros und philia, in der Auffassung von Augustinus als Begehren (appetitus) eine selbstzentrierte Inversion erfahren. Die Bewegung der Nahbeziehung als Verhältnis zwischen Personen, impliziert durchaus auch einen Selbstbezug, radikalisiert ihn jedoch nicht. Der Bezug zum Anderen ist eminent und konstitutiv. In der Confessio und Conversio des Augustinus dagegen scheint Liebe jedoch eine nahezu ausschließliche Frage des Selbst zu werden, und dies, obwohl sich alle Bemühung auf die Gottesliebe richtet. Die abendländische Geburtsstunde des Individuellen beginnt paradoxer Weise mit einer Selbst- und Weltverleugnung. Dem Gottesliebessucher wird die Welt zur Wüste. Er lebt in der Selbstisolation. Dies alles zeigt aber auch, daß die großen im 20. Jahrhundert aufbrechenden philosophischen Probleme von Leiblichkeit, Alterität und Emotionalität nicht allein – wie es in aktueller Diskussion seit geraumer Zeit unternommen wird - im kritischen Rückgang auf Descartes zu reflektieren sind, der wiederum mit seinem Denkbegriff, der selbst Fühlen und Träumen umfaßt, am „allerwenigsten ein Cartesianer war“, – wie Jean Greisch es kürzlich so treffend bemerkte.[7] Die Problemlagen sind zweifelsohne weitaus komplexer und beginnen schon zuvor.
Hannah Arendts Position zur Liebe selbst ist vielfältig und die Stationen ihres Werks, frühe, mittlere und späte Phase, geben ein sehr reiches, aber auch extrem divergierendes Bild. So verschieden diese Etappen sein mögen, so eint sie doch eines, nämlich ein ebenfalls – wie bei Augustinus – ambivalentes Verhältnis zum Liebesbegriff. Arendts augustinische Prägung schlägt an verschiedenen Punkten durch – besonders wirkungsreich am übernommenen Gedanken des „initium“, der Anfänglichkeit des Menschen und seiner Möglichkeit, stets neu beginnen zu können. Vor allem aber zeigt es sich unter umgekehrten Vorzeichen. Augustinus‘ Tendenz sich in Kritik an der Welt in der Ausrichtung auf Gott auf ein Jenseits zu konzentrieren, wird unter kritischem Blickwinkel zur Weltabkehr und Weltflucht. Diese Exposition provoziert bei Arendt genau das Gegenteil, eine Zentrierung ihres gesamten Denkens auf weltliche Belange, die ihr „Welthaftigkeit“ zur positiven Auszeichnung werden lassen und „Weltentfremdung“ zu einer Vorstufe von problematischen Tendenzen, die im Gedankenlosen beginnen und bis zur „Banalität des Bösen“ reichen können. Im mittleren Werk wird ihr dann aber – und dies ist wie gesagt, nur eine Stellungnahme ihrerseits zur Liebesthematik – die Liebe fragwürdig unter einer Vorgabe, die doch wieder an den augustinischen Entwurf, wenn auch verschoben, erinnert. Arendt wartet hier mit einem sehr traditionellen, landläufig sogenannten ‚romantischen‘ Liebesideal auf, das seinerseits nichts mit all dem progressiven kritischen Liebespotential zu tun hat, das gerade die – auch Arendt durchaus vertraute - Frühromantik kennzeichnet. Es ist offenbar von ‚amour passion‘ bis ‚amour fou‘ die Rede, wenn die politische Theoretikerin die beiden Liebenden als diejenige beschreibt, die für die Welt nicht mehr zu gebrauchen sind, und die Welt auch nicht mehr für sie. Damit bringen sie jene Problematik mit, daß das „Bezugsgewebe“ zwischen den Menschen, d.h. auch den anderen Menschen außerhalb dieses Liebespaares, nicht mehr aufrecht erhalten wird und werden kann. Die Liebe ist in der vita activa - Arendts radikalste Stellungnahme zur Thematik - nicht nur „apolitisch“, sondern „antipolitisch“ und weltzersetzend.[9] Die Liebenden sind weltfremd, wie es der Liebes-Gottes-Sucher bei Augustinus war, und wie bei Augustinus zeigt sich im Personenverständnis eine tiefgreifende Parallele. Der sich zur Frage werdende Mensch bei Augustinus kann und muß sich suchen, weil er sich letztlich nicht hat, nicht kennt und auch prinzipiell nicht finden kann, denn finden kann ihn im Grunde nur Gott qua Gnade. Dieser kennt ihn auch allein. Säkularisiert begegnet diese Figur auch bei Arendt. In der Liebe wird das „Wer-jemand-ist“, das keineswegs in Charaktereigenschaften oder Stellungen in der Welt, in einem ‚Was-jemand-ist‘ aufgeht, erkannt. Dieses „Wer“ wird nicht von einem selbst, sondern nur vom Anderen in der Liebe geschaut.[10] Es fragt sich, worin dieses „Wer“ eigentlich besteht, es bleibt eigenartig omniös und leer wie schon im augustinischen Fall. Denn, wie schon bei dem Kirchenvater fragt sich nun auch hier, was von uns übrig bleibt, wenn wir von unserer Konkretion in der Welt absehen? Gleichzeitig schwingt ein positiv kritisches Potential mit, wenn es eine Sicht des Anderen gibt, die durch nichts in der Welt zu korrumpiert werden vermag. Doch dieser Aspekt wird von Arendt nicht weiter verfolgt. Die Transgression bezieht sich hier zwar nicht mehr auf Gott, sondern auf den Liebenden, aber das Liebesgeschehen selbst hat wie schon zuvor auch hier problematische radikale und absolute Züge. Das ausschließlich Schauen des ‚Wer-einer-ist‘, das der Liebe vorbehalten bleibt, schafft offenbar die Besonderheit, Exklusivität dieser intimen Beziehung, aber gleichzeitig sind die darin Befindlichen für die Welt verloren. Liebe ist sozusagen auch bei Arendt nicht von dieser Welt. Und genau das ist ihr Problem. Liebe ist offenbar Isolation zu zweit.
Es scheint zu lohnen, sich erneut mit diesem wenig beachteten philosophischen Liebeskonzept des Frühaufklärers Christian Thomasius auseinander zu setzen. Er selbst hat es getan und ist nicht bei diesen freundlichen Anfängen geblieben,[14] die quer zur Kirchendogmatik stehen. Das schmälert ihre Bedeutung für eine mögliche Umkehr im weltlichen Bedenken von Personalität, Interpersonalität und Individualität und Liebe auf Basis eines christlich-säkularisierten Verständnisses freilich nicht. Anmerkungen
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/66/fk12.htm |
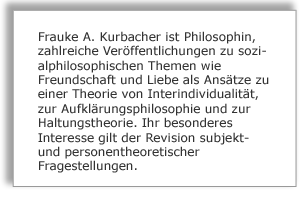 Im abendländischen Kontext wird mehr denn je eine Kritik des christlichen Liebesbegriffs benötigt. Wenn ethische Wertvorstellungen, wie säkularisiert unsere westlichen Gesellschaften auch immer sein mögen, ja mehr noch, wenn ganze Denkfiguren auf christlich geprägten Vorstellungen von Liebe beruhen, dann bedarf es ihrer kritischen, philosophischen Analyse, um sich über die eigenen Denkgrundlagen aufzuklären, und zwar selbst dann, wenn die Ergebnisse beunruhigende, ja bedenkliche sein sollten.
Im abendländischen Kontext wird mehr denn je eine Kritik des christlichen Liebesbegriffs benötigt. Wenn ethische Wertvorstellungen, wie säkularisiert unsere westlichen Gesellschaften auch immer sein mögen, ja mehr noch, wenn ganze Denkfiguren auf christlich geprägten Vorstellungen von Liebe beruhen, dann bedarf es ihrer kritischen, philosophischen Analyse, um sich über die eigenen Denkgrundlagen aufzuklären, und zwar selbst dann, wenn die Ergebnisse beunruhigende, ja bedenkliche sein sollten. Die ‚Sündigkeit‘ des Selbst erschließt sich für Augustinus aus dem privativen, von Gott abgetrennten Charakter, auf Basis dessen aber zugleich Freiheit und Individualität in negativer und konstruktiver Weise erst in und durch diese Distanz hervortreten.
Die ‚Sündigkeit‘ des Selbst erschließt sich für Augustinus aus dem privativen, von Gott abgetrennten Charakter, auf Basis dessen aber zugleich Freiheit und Individualität in negativer und konstruktiver Weise erst in und durch diese Distanz hervortreten. Entscheidende Überlegungen hierzu bringt Hannah Arendt, wenn auch nicht sehr ausdrücklich, eben in ihrer bisher immer noch mehr gescholtenen als gelesen und reflektierten Dissertation zum Liebesbegriff bei Augustinus vor.
Entscheidende Überlegungen hierzu bringt Hannah Arendt, wenn auch nicht sehr ausdrücklich, eben in ihrer bisher immer noch mehr gescholtenen als gelesen und reflektierten Dissertation zum Liebesbegriff bei Augustinus vor. Bei Thomasius begegnet die Thematik von Selbst- und Anderen-Kenntnis und Gottesperspektive ebenfalls. Letztlich ist die Vorstellung einer Art besonderer Erkenntnis in der Liebe wohl bei allen dreien nicht uninspiriert durch jene paulinischen Zeilen im Korintherbrief, die auf das noch derzeitige Erkennen und Schauen „in Spiegeln“, „dann aber von Angesicht zu Angesicht“ zurückzuführen sind.
Bei Thomasius begegnet die Thematik von Selbst- und Anderen-Kenntnis und Gottesperspektive ebenfalls. Letztlich ist die Vorstellung einer Art besonderer Erkenntnis in der Liebe wohl bei allen dreien nicht uninspiriert durch jene paulinischen Zeilen im Korintherbrief, die auf das noch derzeitige Erkennen und Schauen „in Spiegeln“, „dann aber von Angesicht zu Angesicht“ zurückzuführen sind.