
50 Jahre danach: Kunst und Kirche |
Kunsthistorische und theologische NeubewertungenBefreiung der Künste zur ProfanitätEveline Valtink
Im folgenden soll insbesondere auf Kurt Marti und seinen 1957 in der Zeitschrift „Evangelische Theologie“ erschienenen Aufsatz unter dem Titel „Christus, die Befreiung der bildenden Künste zur Profanität“[1] eingegangen werden, da er mit grundlegenden Thesen von Wolfgang Schöne koinzidiert ohne direkt auf Schöne zu antworten. Dies tut aber Kurt Lüthi in seinem Aufsatz zur Modernen Malerei[2] aus dem Jahr 1963, dem wir hier kurz den Vortritt vor Kurt Marti lassen:
Lüthi greift hier die Argumentation Schönes auf, dass die Kunst (bereits im 19. Jahrhundert, aber vollends im 20. Jahrhundert) zum Ende der Abbildlichkeit gekommen sei. Lüthi bringt diese Aussage Schönes nun in den Zusammenhang des 2. Gebotes und dessen Ablehnung der Objektivierbarkeit Gottes ein und zeigt so, dass es eine Koinzidenz zwischen der notwendig endenden Bildgeschichte Gottes im Abendland mit dem Bilderverbot des Alten Testamentes gibt. Als sei die Kunst endlich in der Geschöpflichkeit bzw. in der Welt, in der Profanität angekommen, in die sie eigentlich schon immer hineingehört hat, so, als habe sie zwischenzeitlich in der Entfremdung von sich selbst gelebt. Wilhelm Vischer fragt im Hinblick auf das 2. Gebot: „Ist mit dem Verbot der religiösen Kunst den Auserwählten des Herrn alles künstlerische Schaffen untersagt? Im Gegenteil: dadurch, dass der Kunst und dem Künstler die Weihe verweigert wird, werden sie beide von einer Entfremdung befreit.“[4] Vischer fasst das Schöpfungswerk Gottes als das vollkommene Kunstwerk auf. Darum: „Es wäre schwer verständlich, wenn der Schöpfer, der dieser Künstler ist, dem Menschen, den er als sein Ebenbild geschaffen hat nicht auch das Bedürfnis und die Fähigkeit künstlerischer Mittel verliehen hätte . Das zweite Wort des Dekalogs löst den Bann und jeden magischen Zwang und lädt die Befreiten des Herrn zu dem Spiel der Kunst.“[5] Ikone Gottes ist nicht mehr ein Abbild, das ein Urbild repräsentierte, sondern Ikone Gottes „ist der Mensch von Fleisch und Blut, so wie er lebt, die Ikone Gottes im Tempel der Welt.“[6] - „Ebenbild Gottes ist zuerst der Mensch Jesus von Nazareth und dann der in ihm erneuerte Mensch“.[7] Kurt Marti ist es zu verdanken, dass er unserer Themenstellung zu einer ganzheitlich- biblischen Einordnung verholfen hat. So lenkt er seinen Blick zunächst auf den Befund des Alten Testamentes. Im Alten Israel, so legt er dar, hören wir von den bildenden Künsten einmal im Zusammenhang mit Bundeslade, Stiftszelt und Tempel und deren Bau und Ausstattung und andererseits im Zusammenhang mit der Herstellung von Gottes- und Götzenbildern. „Die an Stiftszelt, Tempel und ihre Geräte gewandte Kunst gilt der alttestamentlichen Überlieferung als geboten, die an Gottes- und Götzenbilder gewandte Kunst als verboten … So ist von Kunst und Kunsthandwerk fast nur im Zusammenhang mit Stiftszelt und Tempel positiv die Rede. Kristallisationspunkt der Künste ist der Kultbau. Von dieser Sakralaufgabe her empfangen die Künste ihre Legitimation und Würde.“(371) Mit dem Bilderverbot hingegen grenzt sich Israels Glaube von den Religionen seiner Umwelt ab, die bekanntermaßen einen üppigen Bilderkult pflegten. Israel jedoch sollte einem Gott dienen, der in keiner Weise vergegenständlicht werden kann. Als lebendiger Gott transzendiert der Gott Israels alle Vergegenständlichungen. So erinnert das Gebot immer neu an Gottes Lebendigkeit. Aus der theologischen Bedeutung des Kultzentrums ergibt sich also die Kristallisation der Künste im Sakralbereich. Ausführlich werden zum Beispiel in Ex 25-31 Anweisungen für die Ausstattung des Stiftszeltes gegeben. „Mittelpunkt von Stiftszelt und Tempel ist ursprünglich die Bundeslade, über welcher Gott residiert … Gott wohnt aber nach dieser alttestamentlichen Vorstellung nicht statisch im Kultbau. Sein Wohnen ist ein Akt. Es gefällt ihm, seinem Volke je und je im Tempel zu begegnen, ohne dass er aber im geringsten im Tempel fixiert wäre“ (371) Gott selber bleibt in seiner Freiheit und Lebendigkeit unverfügbar, aber man kann ihm Raum schaffen, in dem er Wohnung nehmen kann, wenn er will. Marti verweist darauf, dass der Tempel schon im antiken Judentum an Bedeutung verloren und dass sich das religiöse Leben mehr und mehr in die Synagogen verlagert hatte. Auch Jesu unterschiedliche Äußerungen zum Tempel zeigen seine kritische Haltung zum Jerusalemer Tempel. Die Aufforderung Jesu an die Juden, den Tempel abzureißen, so dass er – Jesus – ihn in drei Tagen wiedererstehen lassen könne, bezieht Jesus bereits auf den Tempel seines Leibes (Joh. 2, 19-22). Dies führt nun zur entscheidenden Aussage von Kurt Marti hin: „War bis zu Jesus Christus Gottes aktuelle irdische Residenz …eine lokale Residenz (Stiftszelt, Tempel), so wählt Gott von nun an eine personale Residenz (Jesus Christus) … Nach neutestamentlicher Auffassung ereignet sich die Begegnung mit Gott von nun an nicht mehr in einem Tempel, sondern in der Person Jesu Christi.“ (372) Die Zweiteilung der Welt in eine sakrale und eine profane Sphäre wird in Christus endgültig aufgehoben, und den Künsten wird von daher ihr sakraler Kulminationspunkt entzogen, sie verlieren ihre sakrale Mitte. „Jesus Christus ist das prinzipielle, d.h. theologische Ende jeden Sakralraums und jeder Möglichkeit dazu… Die Gemeinde braucht keinen Tempel mehr, weil sie selber, wo immer sie sich auch versammelt, der neue Tempel ist: ´Wisset Ihr nicht, dass Ihr Gottes Tempel seid?´ (1.Kor.3,16…) ….´Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen´ (Matth.18, 10)“ (373). So gibt es also keine heiligen Räume mehr, sondern nur noch die Versammlung der heiligen, christlichen Gemeinde. Seit es Gott gefallen hat, nicht mehr in einem Raum, sondern in einem Menschen Wohnung zu nehmen, ist die sakrale Kunst im alten Sinn zu ihrem Ende gekommen. Die Künste sind in die Profanität verwiesen. Daraus erklärt sich auch die prinzipielle Kunstindifferenz des Neuen Testamentes, die es nach Marti nicht zu entschuldigen, sondern zu interpretieren gilt. Sie ist als Befreiung zu interpretieren, als Befreiung der bildenden Künste zur Profanität. Der Unterschied zwischen heiliger und weltlicher Kunst wird von daher theologisch irrelevant. Deshalb, weil Kunst nun ganz und gar weltlich sein darf, eine menschliche Tätigkeit und Element der Weltgestaltung, gelten für Kunst im christlichen Kontext nach Marti auch keine anderen Kriterien als für Kunst überhaupt. „Christliche Kunst hat keinen Anspruch auf Sonderbehandlung und Sonderbewertung. Sie ist grundsätzlich nichts anderes und nicht mehr als die profane Kunst. Umgekehrt ist von dieser Sicht aber auch die Sakralisierung der profanen Kunst ausgeschlossen, etwa in Richtung auf eine idealistische Kunstreligion und eine von dieser ´heilig´ gesprochenen Kunst.“ (374f.) Hans-Eckehard Bahr, der in seinem Buch „Poiesis. Theologische Untersuchung der Kunst“ die Grundgedanken von Kurt Marti aufgreift und weiterführt, schreibt: „Auch die Kunst, die von Christen entworfen wird, steht nicht mehr im ´heiligen´ Raum, sondern ist ganz und gar ´weltlich´ und unterliegt den Sachgesetzen, die für jede Kunst normativ sind. Umgekehrt verfehlt die profane Kunst, wenn sie zur Sakralbedeutung hinaufgesteigert wird, die humane Welt-Wirklichkeit, die in Christus prinzipiell entheiligt ist. Christus bedeutet also die Freigabe der der wirklichen, der profanen Welt als Spielraum der Kunst.“[8] Es ist aufschlussreich, dass sowohl der Kunstwissenschaftler Wolfgang Schöne wie auch der Theologe Kurt Marti ihre Texte mit einem Verweis auf Hans Sedlmayrs Buch „Verlust der Mitte“ beenden, von dem sie sich jeweils entschieden abgrenzen. Sedlmayr ist eben einem – mittelalterlichen - Weltbild verhaftet, das die Sphären heilig und profan nicht trennt, sondern vermischt. Und darin trifft er sich mit vielen Zeitgenossen, die Kurt Marti im Visier hat, wenn er abschließend schreibt: „Am Vorwurf, der gegen jede neue, überlieferte Gesetze stürzende Manifestation der Kunst erhoben wurde, und wird, ihr sei nichts mehr ´heilig´, ist etwas durchaus Richtiges, nur ist er als Vorwurf verfehlt, denn die grundsätzliche Profanität der Künste führt notwendigerweise zum Sturz der immer neu sich etablierenden, illegitimen ´Heiligkeiten´. Wenn es heute den Anschein hat, wir bewegten uns auf einem Trümmerfeld … gestürzter ästhetischer ´Heiligkeiten, zerbrochener ästhetischer Gesetzestafeln, so ist das nicht einfach dem ´Verlust der Mitte´ zuzuschreiben – das hieße, die Dinge unerlaubt simplifizieren – sondern es ist dies ebenso sehr ein Zeichen dafür, dass der Mensch aufgerufen ist, Herr über die Kunst zu sein und sich immer wieder von neuem als solcher zu beweisen und zu bewähren.“ (375) Anmerkungen[1] Marti, Kurt (1958): Christus, die Befreiung der bildenden Künste zur Profanität. In: Evangelische Theologie (8), S. 371–375 [2] Lüthi, Kurt (1963): Moderne Malerei. In: Kurt Marti, Kurt Lüthi und Kurt von Fischer (Hg.): Moderne Literatur, Malerei und Musik. Drei Entwürfe zu einer Begegnung zwischen Glaube und Kunst. Zürich [u.a.]: Flamberg, S. 169–332. [3] Ebd., S. 277. [4] Wilhelm Vischer, „Du sollst dir kein Bildnis machen“; zit. nach Lüthi, a.a.O., S. 252. [5] Wilhelm Vischer, Ebd. [6] Wilhelm Vischer, Ebd. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/71/ev06.htm
|
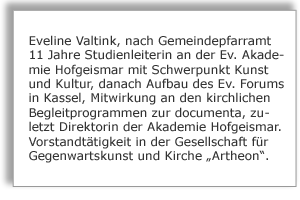 Auf die von Schöne umfangreich dargelegte zeit- und kunstgeschichtliche
Auf die von Schöne umfangreich dargelegte zeit- und kunstgeschichtliche