
CONTAINER |
CharmeoffensiveEine NotizAndreas Mertin
Peter Schüz, Thomas Erne (Hg.) (2011), Der religiöse Charme der Kunst. Paderborn: Schöningh 2011 Die Einladungskarte zum gemeinsamen stilvollen Treffen trägt jedenfalls folgenden Text:
Und damit ist auch ganz gut die Intention des Herausgebers Thomas Erne umschrieben. Und es gehört zu den Stärken des Buches, dass im Verlauf der Lektüre mehr und mehr deutlich wird, dass genau diese Hoffnung auf eine weiterführende Leistung des Begriffes „Charme“ für die Theorie von Kunst und Religion bzw. Kunst und Kirche nicht eingelöst werden kann, ja, dass die Mehrzahl der Beiträger mit guten Gründen an dem differenzierten Modell einer allenfalls nachträglichen Bezugnahme religiöser Erfahrung auf die vorgängige Kunsterfahrung festhält. Nach der Lektüre des Buches weiß man, dass die charmante Bezauberung der Kunst durch die Religion (der ästhetische Charme der Religion) wie auch die Bezauberung der Religion durch die Kunst (der religiöse Charme der Kunst) keine tragfähigen Modelle der Verhältnisbestimmung sind. Und diese Erkenntnis sollte man nicht gering schätzen. ZwischenbemerkungDas kardinale Problem der Bestimmung von ästhetischer Erfahrung mit religiösen Begriffen hat der amerikanische Philosoph John Dewey bereits 1934 in seinem Werk „Art as Experience“ beschrieben. Er verhandelt im Kapitel über die Perzeption unter der Rubrik Kategorienverwechslung bzw. Verwirrung der Werte die Neigung, bei der Beschreibung ästhetischer Erfahrung auf Begriffe aus anderen Erfahrungen, insbesondere der religiösen Erfahrung zurückzugreifen:
Die Gefahr besteht in der nicht sorgsam durchgeführten Wahrnehmung der Besonderheit der ästhetischen Erfahrung: „Letztlich geht alle Verwirrung der Werte von der gleichen Quelle aus: Vernachlässigung der wesentlichen Bedeutung des Mediums“ (John Dewey, Kunst als Erfahrung. S. 370). Unbestritten ist aber auch für Dewey, dass intensive ästhetische Erfahrung ein Gefühl auslöst, dass man religiös nennen kann. Er beschreibt das so:
Das „religiöse Gefühl, das eine intensive ästhetische Perzeption begleitet“ ist vielfach empirisch wahrnehmbar und bis heute auch dort spürbar, wo Religion keine Rolle mehr spielt. Die Frage ist, was es bedeutet und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Ich verstehe das hier vorgelegte Buch über den religiösen Charme der Kunst so, dass es diesen dauerhaften Attraktionen im Beziehungsgefüge nachgehen will und lese Deweys Text von 1934 als deutliche Warnung vor der Gefahr, einer Kategorienverwechslung zu erliegen. *** Thomas Erne benennt im einleitenden Aufsatz noch einmal die Probleme der Beziehung von Kunst und Religion respektive von ästhetischer und religiöser Erfahrung. Dabei rekuriert er aber von vorneherein auf einen Ästhetik-Begriff, der eher an Baumgarten als an Kant anschließt. Das wird deutlich, wenn er schreibt: „Gelebte Religion gibt es daher nicht ohne Religionsästhetik.“ Das daher bezieht sich auf die Erkenntnis, dass gelebte Religion immer eine bestimmte Form der Darstellung braucht. Die Frage ist jedoch, was Ästhetik und Darstellung miteinander verbindet. Aus der Notwendigkeit der Darstellung ergibt sich eben noch nicht die Notwendigkeit einer ästhetischen Reflexion im Sinne der Kunstreflexion. Dafür würde auch der mindere Begriff des Ästhetischen im Sinne des Designs reichen. Meines Erachtens hätten wir viele Probleme in der Diskussion gar nicht, wenn Theologen einsehen würden, dass es ihnen gar nicht um Kunst, sondern um Design geht: eben um die beste bzw. eine zeitangemessene Form der Darstellung christlichen Glaubens. Erne jedenfalls erläutert anschließend, warum er im Begriff des Charmes eine Möglichkeit sieht, die alten Bestandsaufnahmen des letzten Jahrhunderts vorwärts zu neuen Konstellationen zu bringen. Zu den „Charmebedingungen“, die er benennt, gehört erstens eine stressfreie Autonomie, zweitens eine gemeinsame Gattung und drittens eine spezifische Differenz. Nun gibt es schon, wie später noch auszuführen sein wird, erhebliche Bedenken in der Konstatierung der zweiten Charmebedingung, nämlich der gemeinsamen Gattung. Sowohl Georg Simmel wie viele Jahre später Thomas Lehnerer haben vehement bestritten, dass sich Kunst und Religion im Sinne einer gemeinsamen Gattung konstellieren lassen: „Dort wo Kunst ihren Selbstbezug ausformuliert, wo sie ihre Autonomie zur Geltung bringt und dadurch als Totalität sich ausweitet, wo sie m.a.W. ihrem Begriff radikal folgt, ist sie bestimmte Negation von Religion“ (Th. Lehnerer, Leserbrief, Kunst und Kirche 3/87, S. 230.). Ich habe freilich schon Bedenken, wenn umstandslos vom „ästhetischen Zauber“ eines Gottesdienstes gesprochen wird. Wäre er wirklich ästhetisch im modern-künstlerischen Sinne, wäre es aus prinzipiellen Erwägungen heraus kein Gottesdienst mehr, wenn es ein Gottesdienst(!) ist, kann es aus ebenso prinzipiellen Erwägungen heraus nicht mehr freies Erkenntnisspiel sein. Insofern sehe ich auch die erste Bedingung einer „stressfreien Autonomie“ als nicht gegeben an. Ich bin daher grundsätzlich skeptisch, ob die Charme-Bemühungen unter derartigen Voraus-Setzungen tatsächlich überhaupt zum Tragen kommen können. Es mag das Problem der Religion sein, sich darum zu sorgen, wie man Transzendenzerfahrungen vergegenwärtigen kann – das Problem der Kunst ist es nicht, da mit der Kunst die immanente Transzendenzerfahrung bereits gemacht wird, denn es ist die Bedingung der Möglichkeit von Kunsterfahrung. Da ist die Kunst ganz selbstgenügsam. Martin Seel geht in seinem Text den „Transzendenzen der Kunst“ nach und weist schon einleitend darauf hin, dass er die religiöse Transzendenz der Kunst für ein Epiphänomen hält, wenn auch für ein bedeutsames. Als grundlegende Transzendenzen benennt er die zeitliche Transzendenz (im Sinne der Verdichtung), die räumliche Transzendenz und die kognitive und ethische Transzendenz. Im Blick auf die „religiöse Transzendenz“ rät Seel aber zur Vorsicht. Letztlich bestimmt er das Verhältnis als eines der Nachgängigkeit, der Deutung: „Meine These lautet nun, dass eine religiöse Lebensführung dieser auf Selbsttranszendenz hin angelegten Potentialität des Menschen eine bestimmte Deutung verleiht. Sie stellt einen besonderen Modus der Realisierung dieser Struktur einer nicht-egomanen Selbstbestimmung dar und somit eine besondere Form der Spiritualität. Sie ist ein besonderer Stil eines freizügigen Sichbestimmenlassens und eröffnet damit ein besonderes Weltverhältnis, aus dem heraus gelebt oder zu leben versucht wird.“ Dem wird man meines Erachtens kaum widersprechen können, denn es beschreibt das, was Thomas Erne an anderer Stelle einmal als „religiöse Erfahrungen mit ästhetischen Erfahrungen machen“ beschrieben hat. Aber eben in dieser Reihenfolge. Wilhelm Gräb kommt in seinem Beitrag „Kunst – die ansprechende Sprache der Religion“ zunächst Thomas Ernes Vorschlag der Verwendung des Charmebegriffs weit entgegen, insoweit er sich offenkundig durchaus eine stressfreie Autonomie wie eine gemeinsame Gattung (des Sichtbar-Machens) vorstellen kann. Aber dann fügt er ohne Missverständnisse hinzu: „Freilich, die religiös deutbaren Transzendenzerfahrungen, in die zeitgenössische Kunst führt, sind immanente Transzendenzerfahrungen. Nicht die gegenständlichen Vorstellungen einer transzendenten (Heils-)Wirklichkeit werden veranschaulicht, sondern alltagsweltliche, wiewohl existentiell angehende Erfahrungen der Selbsttranszendenz, des Sich-Entzogenseins, der Wellfremdheit, der Grenzüberschreitung, der Sinnerweiterung und auch der Sinnzerstörung. Aber auch diese immanenten Transzendenzen können andere, aus den alltäglichen Funktionszusammenhängen und Verzweckungen des Daseins herausführende Räume bauen und andere, sinnlich affizierende, in die existentielle Sinnreflexion führende, alle Sinne beeindruckende Raumatmosphären schaffen.“ Aber es bleibt eben bei der schon von Martin Seel beschriebenen sekundären Bezüglichkeit. Gräb ergänzt: „Diese immanenten Transzendenzerfahrungen, in die Bilder und Installationen der autonomen Kunst führen, haben oft eine religiöse Aura bei sich. Dann ziehen sie umso leichter auch Motive religiöser Deutungstraditionen auf sich. Die religiöse Deutung wird ihnen dennoch nicht nur von außen zugeschrieben, sofern sie aus der ihnen eigenen performativen Kraft eine für die religiöse Deutung offene ästhetische Erfahrung machen lassen.“ Liest man das genau, dann greift Gräb die Beschreibung von Dewey auf und verweist darauf, dass ästhetische Erfahrung eine Dichte aufweist, die offen für eine religiöse Deutung ist. Wenn man das – wie Gräb vorschlägt - als den „religiösen Charme“ der Kunst bezeichnet, dann bezeichnet dieser letztlich nichts anderes als die Polyvanz des ästhetischen Objekts, die eben auch religiöse Valenzen in der religiösen Deutung zum Vorschein kommen lassen kann. Klaus Sachs-Hombach macht in seinem Text „Mystik und Religion im Medium des Bildes“ deutlich, wie schwierig und problematisch die heutige religiöse Rede von der Deutungskultur ist, denn als religiöse Bilder bezeichnet er nur explizit religiöse Bilder (also solche mit christlicher Ikonographie) und religiöse Bilder im weiteren Sinne (und hier meint er religiöse Themen und Titelgebungen). Das ist aber weitaus enger als es die theologischen Kollegen intendiert hatten, die den Begriff der religiösen Bilder ja auf alle religiös deutbaren Bilder erweitern wollen. Aber vielleicht nimmt Sachs-Hombach hier die Religionen ja ernster als deren Vertreter. Jedenfalls schlussfolgert er: „Bildkommunikation ist als visuelle Charakterisierung wesentlich eine Form der Zeigehandlung. Religion ist durch ihren Bezug auf Transzendentes wesentlich eine Form der Kontingenzbewältigung. Beide Bereiche lassen sich vermitteln durch die religiösen Bilder, denen es um eine Veranschaulichung des Transzendenten geht.“ In dieser nüchternen Bestandsaufnahme geht Kunst dann eben doch nicht über die vertraute Form der Visualisierung hinaus. So wird realistisch beschrieben, was der Fall ist, aber es ist eben nicht besonders weiterführend im Blick darauf, inwieweit Kunst grundsätzlich religiösen Charme versprüht oder Religion grundsätzlich ästhetischen Charme. Denn als Kontingenzbewältigung ist Religion nun gerade nicht ästhetisch charmant. Reinhard Hoeps misst in seinem Beitrag über „Bildtheologie jenseits der Inhaltsdeutung“ den Raum „zwischen christlichen Bildkonzepten und Kunst der Moderne“ aus und fragt sich gibt es den religiösen Charme der Kunst und gibt es den ästhetischen Charme der Religion? Es zeichnet seine Reflexionen aus, dass sie erfrischend ehrlich die oft desillusionierenden Gespräche von Theologen mit Künstlern charakterisieren. „Der religiöse Charme der Kunst beruht darauf, dass ihre Werke - zumeist keineswegs beiläufig, sondern vermöge der ihnen grundlegenden bildlichen Disposition - deutend, kommentierend, intervenierend auf zentrale Fragestellungen der Theologie ausgreifen ... Das Bild will weniger einen Sachverhalt zur Darstellung bringen als eine Erfahrung eröffnen.“ Diese Antwort auf die Frage nach dem „religiösen Charme der Kunst“ befriedigt mich aber nicht ganz. Ich vermute, das ist der Tatsache geschuldet, dass wir im Bereich der Bildenden Künste noch nicht so weit sind. Im Bereich der Literatur und der Sprache, sind wir hier wesentlich weiter. Wolfgang Harnisch hat mit seiner Gleichnistheorie (Die Gleichniserzählungen Jesu) gezeigt, wie unverhofft nahe sich ästhetische Theorie und theologische Theoriebildung kommen können. Freilich ist er dabei der ästhetischen Theorie sehr weit entgegengekommen. Im Blick auf den ästhetischen Charme der Religion verweist Hoeps auf Arbeiten von Mark Wallinger, etwa dessen Werk „Ecce homo“ vom Trafalgar Square 1999. Aber der ästhetische Charme der Religion kann doch nicht darin liegen, dass Künstler weiterhin religiöses Material als außerästhetisches Substrat heranziehen und der sinnlich-reflexiven Bearbeitung unterziehen. Wie Christoph Menke in seinem Buch „Die Souveränität der Kunst: Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida“ gezeigt hat, wird der Materialgehalt in der künstlerischen Bearbeitung geradezu vernichtet. Insofern ist aus dem Vorkommen von religiösen Substraten noch wenig abzuleiten. Von den weiteren Beiträgen greife ich nur noch einen exemplarisch heraus: Gunter Scholtz hält sich in seinen Ausführungen an Schleiermacher und Hegel, die „Kollegen im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts an der Berliner Universität“. In zwölf sehr klar akzentuierten Thesen macht Scholz Schritt für Schritt deutlich, wie prekär eine Verhältnisbestimmung von Kunst und Religion unter dem Begriff des Charmes in historischer Perspektive (also hier im Blick auf Hegel und Schleiermacher) aussieht und wie produktiv dennoch philosophisch über Kunst und Religion nachgedacht wurde. Schon die erste These freilich lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: „Für Schleiermacher und Hegel hat der Kern der christlichen Religion gar nichts mit Kunst oder Ästhetik zu tun.“ Zwar habe das Christentum durchaus eine spezifisch religiöse Kunst hervorgebracht, aber es sei eben doch nur eine „lockere Verbindung“, denn man streite sich über Trinität doch ganz anders als über Bilder. [An dieser Stelle könnte man durchaus auch eine abweichende Position vertreten, den historisch erweist sich Bilderstreit als zuverlässiger "Krisenindikator der Theologie" (Christoph Dohmen). Immer wenn die Register der Theologie neu geordnet werden, wird über Bilder gestritten.]. Historisch trennen sich Kunst und Religion im 18. Und 19. Jahrhundert. „Versteht man unter Säkularisierung den Rückzug der Religion auf ihr eigenes, genuines Terrain und die Freigabe säkularer Kultursphären, dann sahen Schleiermacher und Hegel in diesem Vorgang keine Gefahr für das Christentum, sondern im Gegenteil den typischen Charakter der neueren, durchs Christentum bestimmten Geschichte. Auch die Entstehung der Ästhetik und des ästhetischen Sinnes kann als Ergebnis dieses Prozesses verstanden werden.“ Ob das Erhabene dann wirklich eine Kategorie ist, über die eine Neu-Konstellierung von Kunst und Religion denkbar wird, wüsste ich freilich nicht zu entscheiden. Die entsprechenden Reflexionen – nicht zuletzt von Lyotard – sind mir noch nicht überzeugend genug. In einem gewissen Sinne auffällig übereinstimmend mit Scholtz erster These ist Georg Simmels Beobachtung zu Kunst und Christentum vom Anfang des 20. Jahrhunderts: „An und für sich haben Religion und Kunst nichts miteinander zu tun, ja sie können sich in ihrer Vollendung sozusagen nicht berühren, nicht ineinander übergreifen, weil eine jede schon für sich, in ihrer besonderen Sprache, das ganze Sein ausdrückt.“ (Georg Simmel, Das Christentum und die Kunst (1907), in: Das Individuum und die Freiheit. Essais, Berlin 1984, S. 120-129, hier S. 129.) Die Frage ist, was man gewinnt, wenn man über diese Erkenntnis hinausgeht. Es gehört für mich zu den positiven Erträgen des Buches, dass Scholtz uns auf den Boden der Tatsachen zurückholt. BilanzDie schwache Rede vom religiösen Charme der Kunst, insofern man darunter versteht, dass die Kunst als Ort sinnlich-reflexiver Auseinandersetzung für Theologen attraktiv ist, kann nicht bestritten werden. Wir haben eine nun fast 1800 Jahre währende äußerst kontroverse Auseinandersetzung in der christlichen Theologie darüber, was Bilder eigentlich leisten. Die starke These vom religiösen Charme der Kunst, insofern man darunter versteht, dass ein Kunstwerk in einem spezifischen Sinne eine religiöse Wahrheit artikuliert, die außerhalb dieses ästhetischen Vollzuges sonst so nicht gemacht werden kann, wurde auch mit den Texten dieses Buches nicht plausibler. Ebenso wenig einsichtig wurde mit den Beiträgen, was Jürgen Habermas in seiner Friedenspreisrede 2001 von den Theologen im Blick auf die Gesellschaft forderte: ihre religiösen Erkenntnisse so zu re-formulieren, dass vernünftige Menschen, die nicht die religiösen Voraussetzungen teilen, dennoch einen Erkenntnisgewinn davon haben. Was also hat eine Gesellschaft vom imaginierten „religiösen Charme der Kunst“? Hier bin ich nicht schlauer geworden. Ich sehe die Möglichkeit eines Gewinns für die Theologie, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen, sehe aber nicht, inwiefern dies die Rede von der Kunst in der Gegenwart voranbringt. Die schwache Rede vom ästhetischen Charme der Religion, wenn man darunter versteht, dass Elemente des Religiösen in der Kunst der Gegenwart auftauchen, kann nicht bestritten werden. Ausstellungen wie „Medium Religion“ im ZKM haben gezeigt, dass es hier eine beeindruckende Kontinuität gibt. Die starke These vom ästhetischen Charme der Religion, insofern man darunter versteht, dass die Theologie und die Religion kunst-ästhetisch erkenntnisproduktiv (und nicht nur Materiallieferant des außerästhetischen Substrats) sind, ist mir auch nach Lektüre des Buches nicht einsichtig. Mit anderen Worten, dort, wo es auch niemand bestreiten mag, vermag das Buch zu überzeugen. Dort aber, wo es darauf ankommt, auf der Grenze zwischen zeitgenössischer Religion und zeitgenössischer Kunst, sehe ich hier keinen Fortschritt. Ganz im Gegenteil. Die Wahl des Begriffes „Charme“ evoziert eine positive Voreingenommenheit in der Sache, die nicht sachadäquat ist. Weder ist das Gespräch über Kunst und Religion heute auf der Höhe der Theologie noch auf der Höhe der Kunst. Aber was nicht ist, kann ja irgendwann einmal werden. ***
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/80/am409.htm
|
 "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" heißt ein Film von Luis Buñuel aus dem Jahr 1972. Die Handlung des Films fasst die Wikipedia so zusammen: „Eine Gruppe von sechs Angehörigen der Bourgeoisie - bestehend aus zwei reichen französischen Ehepaaren, einer jungen Frau sowie dem korrupten Botschafter von Miranda - plant ein stilvolles Essen in kleinem Kreis, das jedoch aufgrund ständiger Zwischenfälle und Missverständnisse immer wieder verschoben werden muss. Mal kommen die Gäste am falschen Tag, mal müssen die Gastgeber noch miteinander schlafen, woraufhin die anderen Gäste nach 20 Minuten vergeblichen Wartens ratlos wieder abziehen. Diese Haupthandlung spaltet sich in zahlreiche Nebenstränge auf, in denen unter anderem Geistliche, Gefängniswärter, Kommissare, Terroristen, Gangster und melancholische Soldaten eine Rolle spielen.“ Und sie ergänzt zum Hintergrund: „Das Universum, das die Bourgeoisie mit ihrem diskreten Charme bewohnt, ist insofern ein aus den Fugen geratenes Universum, das ständig von traumatischen Ereignissen bedroht ist. So endet jeder der Träume im individuellen Trauma eines der Träumenden. Stilistisch schwankt der Film dadurch zwischen der Grundstimmung einer Komödie und Versatzstücken unter anderem aus dem Horrorfilm.“
"Der diskrete Charme der Bourgeoisie" heißt ein Film von Luis Buñuel aus dem Jahr 1972. Die Handlung des Films fasst die Wikipedia so zusammen: „Eine Gruppe von sechs Angehörigen der Bourgeoisie - bestehend aus zwei reichen französischen Ehepaaren, einer jungen Frau sowie dem korrupten Botschafter von Miranda - plant ein stilvolles Essen in kleinem Kreis, das jedoch aufgrund ständiger Zwischenfälle und Missverständnisse immer wieder verschoben werden muss. Mal kommen die Gäste am falschen Tag, mal müssen die Gastgeber noch miteinander schlafen, woraufhin die anderen Gäste nach 20 Minuten vergeblichen Wartens ratlos wieder abziehen. Diese Haupthandlung spaltet sich in zahlreiche Nebenstränge auf, in denen unter anderem Geistliche, Gefängniswärter, Kommissare, Terroristen, Gangster und melancholische Soldaten eine Rolle spielen.“ Und sie ergänzt zum Hintergrund: „Das Universum, das die Bourgeoisie mit ihrem diskreten Charme bewohnt, ist insofern ein aus den Fugen geratenes Universum, das ständig von traumatischen Ereignissen bedroht ist. So endet jeder der Träume im individuellen Trauma eines der Träumenden. Stilistisch schwankt der Film dadurch zwischen der Grundstimmung einer Komödie und Versatzstücken unter anderem aus dem Horrorfilm.“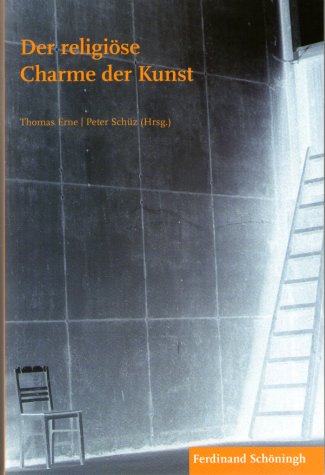
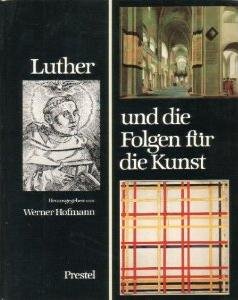 P.S.: Auch wenn der Hamburger Bahnhof in Berlin zu finden ist, so ist die Hamburger Kunsthalle doch nicht in München situiert – bei aller wünschenswerten Verbreitung Hamburger Freiheiten. Die berühmte und folgenreiche Ausstellung „Luther und die Folgen für die Kunst“ unter Leitung von Werner Hofmann fand von November 1983 bis Januar 1984 in der Hamburger Kunsthalle statt und keinesfalls in München wie Erne in seinem Text meint. In München erschien nur der Katalog. Aber das erkennt man sofort, wenn man ihn aufschlagt.
P.S.: Auch wenn der Hamburger Bahnhof in Berlin zu finden ist, so ist die Hamburger Kunsthalle doch nicht in München situiert – bei aller wünschenswerten Verbreitung Hamburger Freiheiten. Die berühmte und folgenreiche Ausstellung „Luther und die Folgen für die Kunst“ unter Leitung von Werner Hofmann fand von November 1983 bis Januar 1984 in der Hamburger Kunsthalle statt und keinesfalls in München wie Erne in seinem Text meint. In München erschien nur der Katalog. Aber das erkennt man sofort, wenn man ihn aufschlagt.