
CONTAINER |
‘Haustierphilosophie‘– oder zur Überwindung des Untiers im MenschenEine kleine Bemerkung zur ‚Philosophie des Zwischenmenschlichen‘ bei Martin BuberFrauke A. Kurbacher Martin Buber ist für eine Philosophie des Zwischenmenschlichen bekannt. Doch selbst das Menschliche speist sich nicht zuletzt vom Anderen seiner selbst, weswegen sein Ansatz treffender mit einer ‚Philosophie des Zwischen‘ zu bezeichnen ist. In Bubers einschlägiger Schrift zur Interpersonalität „Ich und Du“ von 1923, die kennzeichnend für sein ganzes Philosophieren ist, findet sich eine Passage, an der die Offenheit der Ich-Du-Konstellation auf sehr eigene, nämlich sympathisch befremdliche Art deutlich hervorsticht.[1] Und zwar wird dort, an einer kleinen Stelle, die den Blick zwischen einem Haustier und einem Menschen zum Gegenstand hat, weder säkular das interpersonale Verhältnis zwischen Ich und Du untersucht, noch ein transzendentes, religiöses, sondern der Philosoph der dialogischen Philosophie reflektiert vom Tier her auf das Menschliche. Nun handelt es sich in der Anthropologie bei dem Abgleich zwischen Mensch und Tier geradezu um einen ‚Klassiker‘ herangezogener Schemata zur Bestimmung der Besonderheit des Menschen, der allerdings angesichts der sich zeitlich anhäufenden Unrühmlichkeiten in der Menschheitsgeschichte, was die Wahrung der Welt und ihrer Geschöpfe anbelangt, eher – und zurecht – aus der Mode gekommen ist. Ja, das Unmenschliche am Menschen wurde als spezifisch Menschliches in einer Weise bewußt, die eine kritische philosophische Anthropologie im 20. Jahrhundert auf den Plan rief.[2] Die teilweise mehr als erschreckenden Irritationen, die ‚der Mensch‘ sich selbst zu liefern vermag, blieben nicht ohne Folgen. So wurde die einst stolze – zumeist über den λογος, das Sprechen und das Sprachvermögen vorgenommene Abgrenzung vom Tier zunehmend in wachsender Kenntnis der Tier- wie der Menschenwelt mehr oder minder kleinlaut fallengelassen. – Buber greift gleichwohl in Erörterung eines Kernpunktes seiner Philosophie: der Begegnung, auf das Tier zurück, nimmt jedoch dabei einen entscheidenden Perspektivwechsel vor. Die signifikante Stelle in ihrem für moderne Leser einigermaßen gewöhnungsbedürftigen Stil, sei hier aus diesem Grund in Gänze wiedergegeben:
Ich sehe zuweilen die Augen einer Hauskatze. Das domestizierte Tier hat nicht etwa von uns, wie wir uns zuweilen einbilden, die Gabe des wahrhaft ‚sprechenden‘ Blicks empfangen, sondern nur – um den Preis der elementaren Unbefangenheit – die Befähigung, ihn uns Untieren zuzuwenden. Wobei nun aber in ihn, in seine Morgendämmerung und noch in seinen Aufgang, ein Etwas aus Staunen und Frage gekommen ist, das dem ursprünglichen, in all seiner Bangigkeit, doch wohl gänzlich fehlt. Diese Katze begann ihren Blick unbestreitbar damit, mich mit dem unter dem Anhauch meines Blicks aufglimmenden zu fragen: ‚Kann das sein, daß du mich meinst? Willst du wirklich nicht bloß, daß ich dir Späße vormache? Gehe ich dich an? Bin ich dir da? Was ist das da von dir her? Was ist das da um mich her? Was ist das an mir? Was ist das?!‘ (‚Ich‘ ist hier eine Umschreibung für ein Wort der ichlosen Selbstbeziehung, das wir nicht haben; unter ‚das‘ stelle man sich den strömenden Menschenblick in der ganzen Realität seiner Beziehungskraft vor.) Da war der Blick des Tiers, die Sprache der Bangigkeit, groß aufgegangen – und da ging er schon unter. Mein Blick war freilich andauernder; aber er war der strömende Menschenblick nicht mehr. Der Weltachsendrehung, die den Beziehungsvorgang einleitet, war fast unmittelbar die andre gefolgt, die ihn endet. Eben noch hatte die Eswelt das Tier und mich umgeben, ausgestrahlt war einen Blick lang Duwelt aus dem Grunde, nun war sie schon in jene zurückgeloschen. Um der Sprache dieses fast unmerklichen Geistsonnen-Aufgangs und –Untergangs willen erzähle ich die winzige Begebenheit, die mir etliche Male widerfuhr. An keiner andern habe ich so tief die Vergänglichkeit der Aktualität in allen Beziehungen zu den Wesen erkannt, die erhabne Schwermut unsres Loses, das schicksalshafte Eswerden alles geeinzelten Du. Denn sonst gab es zwischen Morgen und Abend des Ereignisses seinen ob auch kurzen Tag, hier aber flossen Morgen und Abend grausam ineinander, das lichte Du erschien und schwand: war die Bürde der Eswelt wirklich dem Tier und mir einen Blick lang abgenommen worden? Ich konnte mich immerhin noch darauf besinnen, das Tier aber war aus dem Stammeln seines Blicks in die sprachlose, fast gedächtnislose Bangigkeit zurückgesunken.“
Schon Friedrich Nietzsche hat, wie kaum ein anderer, die Dürftigkeit menschlicher Existenz im Vergleich zum Tier zu fassen vermocht. Entgegen klassischer Anthropologie, die hochgemut und freudig definitorische Grenzziehungen zur Animalität in solcher Weise vorgenommen hat, die das Menschliche in gefeierten Abstand und sichere Positionen der Überlegenheit brachte, lernt sich mit Nietzsche etwas über all dieses, was den Menschen ob ihrer vermeintlichen Überlegenheit mangelt. Der Vollbesitz aller Kräfte, allen voran der rationalen, haftet dem Menschen nun als Mangel wie Makel an, wie eine existentielle Unwucht und Unruhe, die weder zu befrieden noch zu versöhnen ist, und die Grenzziehung zum Tier wirft nur noch deutlichere Schlaglichter darauf: „Betrachte die Herde, die an dir vorüberweidet: sie weiß nicht, was Gestern, was Heute ist, springt umher, frißt, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblicks, und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig. Dies zu sehen geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschentums sich vor dem Tiere brüstet und doch nach seinem Glücke eifersüchtig hinblickt – denn das will er allein, gleich dem Tiere weder überdrüssig noch unter Schmerzen leben, und will es doch vergebens, weil er es nicht will wie das Tier. Der Mensch fragt wohl einmal das Tier: warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Tier will auch antworten und sagen: das kommt daher, daß ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte – da vergaß es aber auch schon diese Antwort und schwieg: so daß der Mensch sich darob verwunderte.“[6]
Aber in der Darstellung Nietzsches besteht der Kummer, neben dem, sich mit dem Mensch- als einem Nicht-Tier-sein abfinden zu müssen, auch gerade darin, dass es zu einem ‚Zwischen‘ gar nicht kommt, und gar nicht kommen kann. Die Konzeption bei Martin Buber trifft hingegen genau diesen Punkt des ‚Zwischen‘. Mit „Bangigkeit“ umschreibt Buber den situativen Zustand oder vielleicht sogar den fragilen Grundmodus des Tiers, in dem vieles fraglich und irritierbar scheint. Es ist Bangigkeit und nicht menschliche Furcht oder gar existentielle Angst, die das Humane für sich sogar im Sinne einer Kenn- und Auszeichnung reklamiert. Gerade aber in solcher „Bangigkeit“, die wir im leichten Erzittern der Ohren, im Aufflackern des Augenlichts, einer kurzen Spannung von Haut und Haaren mitzuspüren vermögen, ist der menschliche Umstand, in dem nicht gerne etwas Existentielles ins Bewußtsein gehoben oder gar in den Zustand der Reflexion gebracht wird, nicht weniger getroffen. Diese „Bangigkeit des Werdens“ in seiner Offenheit teilen wir offenbar mit dem Tier. Und mehr noch, das, was Buber hier reflektiert, deutet für ihn auf Beziehungen überhaupt, das beschriebene, flüchtige und gleichwohl berührende Moment ist konstitutiv für Bezüglichkeit. Begegnung ist ein Phänomen des Zwischen und keines bleibenden, dauernden Besitzes oder einer Sicherheit, die des Wagnisses nicht bedarf.
Das Untier im Menschen wird nicht überwunden, ebenso wenig wie das Tier im Tier. Aber an solche Grenze gekommen, gestoßen zu sein, bedeutet viel, bedeutet Begegnung, Einfühlung, Offenheit. Von dieser Grenze, vom Zwischen der Kreatürlichkeit her wird Hoffnung auf ein Menschliches jenseits des Untiers spürbar. Bei Buber sind für einen kleinen Augenblick beide, Haustier wie Mensch, in eine Schwere und existentielle Traurigkeit zurückgeworfen. In dieser aber tritt ihnen entgegen aller Dumpfheit eines bloßen Existierens in der Begegnung für eine kurze Weile eigene Eigen- und Andersheit vor Augen, und es geschieht damit etwas, was sich nur mit ‚Lebendigkeit‘ umschreiben lässt. Es ist wohl solch eine beziehungshafte Lebendigkeit, in der zu leben wir wünschen. Allesamt. Anmerkungen[1] Das Denken des Interpersonalen ist in komplexer Weise im gesamten philosophischen Werk von Buber entfaltet. In seinem Nachwort geht Buber selbst auf die langwierige Entstehungsgeschichte seines Hauptwerks „Ich und Du“ und den ihnen zugrunde liegenden Gedanken ein. Siehe: Martin Buber: Das dialogische Prinzip. 11. Aufl. Gütersloh 2009. S. 122ff. Die besagte und im Text zitierte Stelle zur ‚Haustierphilosophie‘ findet sich auf S. 98ff. Es ist etwas unüblich eine Widmung für einen theomag-Artikel zu platzieren, aber zumindest in dieser ersten Fußnote möchte ich erwähnen, dass diese Gedanken nicht zuletzt im Austausch mit Ingrid und Hans Kurbacher und dem zugelaufenen Mausi-Maus entstanden sind, auch den mit Sarah Ambrosi lang gehegten Plan einer „Haustierparty“ möchte ich als Motivation zur philosophischen Auseinandersetzung mit dem Thema nicht unerwähnt lassen. [2] An dieser Stelle sei selbstverständlich Helmuth Plessner genannt, der nicht nur die philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts mitbegründet und entscheidend geprägt, sondern auch verschiedentlich zum Aspekt des ‚Unmenschlichen‘ gearbeitet hat. Helmuth Plessner: „Das Problem der Unmenschlichkeit“ (1967). In: Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Günter Dux, Odo Marquardt u. Elisabeth Ströker. Bd.: Conditio humana. Werke. Frankfurt a. M. 1983. S. 329-337. Verwiesen sei an dieser Stelle auch auf Sarah Kofmans diesbezüglichen Überlegungen zur Unmenschlichkeit als Insignum des Menschlichen. Siehe bes. hierzu ihre Schriften Paroles suffoquées (Paris 1987) und auch Autogriffures und meinen Artikel zu Kofmann in: Metzler Lexikon jüdischer Philosophen. Hrsg. v. Andreas B. Kilcher u. Otfried Fraisse. Stuttgart 2003. S. 459-462, bes. S. 461. [3] Für die Bestiarien sei hier exemplarisch auf eine zeitgenössische Aufnahme derselben, die Bilder von Walten Ford, die in der Ausstellung „Bestiarium - Walton Ford“ im Hamburger Bahnhof vom 23. Januar bis zum 23. Mai 2010 in Berlin zu sehen waren, verwiesen, bei den Fabeln auf jene Jean de LaFontaines (Fables von 1668), bei den Comics auf Gary Larson und bei der Thematisierung in der leichten Muse auf Max Raabes Lied „Rinderwahn“. Die Walton-Ford-Ausstellung hat wegen ihrer traditionellen Thematik und auch Umsetzung Fragen nach ihrer Aktualität hervorgerufen. Im Pressetext zur Exposition wird in diesem Sinn in nicht weiter reflektierter Weise die Verleugnung eigener Natürlichkeit als Problem des modernen Menschen genannt. [4] Hannah Arendts ‚Zwischen‘ ist ausdrücklich und allein im Interpersonalen angesiedelt und entwickelt. Es bezieht sich im Besonderen auf das Handeln und Sprechen und später auch auf das Urteilen. „Handeln und Sprechen bewegen sich in dem Bereich, der zwischen Menschen qua Menschen liegt“. Arendt unterscheidet hierbei zwischen „verschiedene[m] Zwischen“, ein erstes, das sich auf den eher objektiven Aspekt einer in verschiedenem Interesse mit einander geteilten Welt bezieht, und einem zweiten Zwischen, das die letztliche Unverfügbarkeit dieses gemeinsam ergriffenen Raums bezeichnet. Siehe hierzu: Dies.: Vita activa oder Vom tätigen Leben. 4. Aufl. München/Zürich 2006. S. 224f. Auch im Spätwerk wird dieser Gedanke wieder aufgegriffen. Hannah Arendt: Vom Leben des Geistes. Bd. 1 u. 2. Hrsg. v. Mary McCarthy. München/Zürich 1998. Eine Veranstaltung der Guardini-Stiftung, ein Triangel-Kolloquium vom 13. Mai 2006 in Berlin trug den schönen und treffenden Titel: „Hannah Arendt – Denkerin des Zwischen“. Auch wenn Arendts Gedanken zum Zwischen dezidiert interpersonal verortet sind, ist gleichwohl von einem Einfluss Bubers, als exponiertem Denker für ein konstruktives philosophisches Beziehungsdenken, auszugehen. [5] Jean-Paul Sartre: L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique. Paris 1943. Dt.: ders.: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Hrsg. v. Traugott König. 7. Aufl. 2001. Siehe bes. das Kapitel: „Der Blick“. S. 457-538. Da Sartre das Bewusstsein als in sich differenziertes aus An-sich (en-soi) und Für-sich-Sein (pour-soi) darstellt, und erst in einem weiteren Schritt als ein Für-andere-Sein (être pour-autrui), ergibt sich die Problematik des Zurückwerfens in eine bloße Objektsphäre bereits für das je einzelne Subjekt. Sartres Ansatz einer Interpersonalitätstheorie wird bis heute vielfach wahrgenommen und diskutiert. Letztlich ist bei aller Kritik selbst eine konstruktive Wendung, wie bei Axel Honneth, dessen interpersonale Philosophie der Anerkennung im Rückgriff auf Hegel entworfen wird, nicht ohne Sartres Intervention der Blickphilosophie im 20. Jahrhundert denkbar. [6] Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“. In: Ders.: Werke in sechs Bänden. Hrsg. v. Karl Schlechta. 5. Aufl. München/Wien 1980. Bd. 1. S. 211. [7] Die Thematik des Fremden mitsamt der Unterscheidung zwischen radikal Fremdem und relativ Fremdem ist maßgeblich von Bernhard Waldenfels entwickelt und behandelt worden. Siehe exemplarisch ders.: Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt a. M. 2006. Zur Dialogizität, insbesondere auch bei Buber, hält Waldenfels nicht zu unrecht kritische Distanz, da sie aus seiner Sicht zu unhinterfragt von Gemeinsamem ausgehe. Im obigen Beispiel einer Konfrontation des Menschen mit dem Tier scheint jedoch im Verständnis eines Zwischen eine elementare Differenz, ja sogar Kluft bedacht, die zugleich den Grund einer Anmutung von Begegnung und Gemeinsamkeit bildet und gleichwohl nicht einfach als harmonistisch gelten kann. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/80/fk14.htm
|
 „Die Augen des Tiers haben das Vermögen einer großen Sprache. Selbständig, ohne einer Mitwirkung von Lauten und Gebärden zu bedürfen, am wortmächtigsten, wenn sie ganz in ihrem Blick ruhen, sprechen sie das Geheimnis in seiner naturhaften Einriegelung, das ist in der Bangigkeit des Werdens aus. Diesen Stand des Geheimnisses kennt nur das Tier, nur es kann ihn uns eröffnen, – der sich eben nur eröffnen, nicht offenbaren läßt. Die Sprache, in der es geschieht, ist, was sie sagt: Bangigkeit – die Regung der Kreatur zwischen den Reichen der pflanzenhaften Sicherung und des geistigen Wagnisses. Diese Sprache ist das Stammeln der Natur unter dem Griff des ersten Geistes, ehe sie sich ihm zu seinem kosmischen Wagnis, das wir Mensch nennen, ergibt. Aber kein Reden wird je wiederholen, was das Stammeln mitzuteilen weiß.
„Die Augen des Tiers haben das Vermögen einer großen Sprache. Selbständig, ohne einer Mitwirkung von Lauten und Gebärden zu bedürfen, am wortmächtigsten, wenn sie ganz in ihrem Blick ruhen, sprechen sie das Geheimnis in seiner naturhaften Einriegelung, das ist in der Bangigkeit des Werdens aus. Diesen Stand des Geheimnisses kennt nur das Tier, nur es kann ihn uns eröffnen, – der sich eben nur eröffnen, nicht offenbaren läßt. Die Sprache, in der es geschieht, ist, was sie sagt: Bangigkeit – die Regung der Kreatur zwischen den Reichen der pflanzenhaften Sicherung und des geistigen Wagnisses. Diese Sprache ist das Stammeln der Natur unter dem Griff des ersten Geistes, ehe sie sich ihm zu seinem kosmischen Wagnis, das wir Mensch nennen, ergibt. Aber kein Reden wird je wiederholen, was das Stammeln mitzuteilen weiß.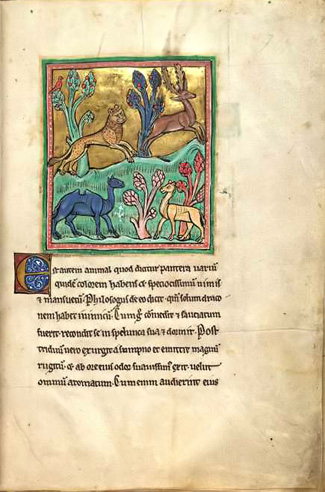 Was Buber hier beschreibt ist nicht einfach der ebenfalls sehr anrührende Spiegelblick, wie wir ihn aus Bestiarien seit dem Mittelalter, aus Fabeln der Neuzeit oder zeitgenössischen Comics oder Liedern der leichten Muse kennen, der unser Verhalten mit seinen Fehlern und Marotten sozusagen im Gewand des Tiers deutlicher und mit einer der Brechung eigenen Komik zum schmunzelnden Nachdenken vorführt.
Was Buber hier beschreibt ist nicht einfach der ebenfalls sehr anrührende Spiegelblick, wie wir ihn aus Bestiarien seit dem Mittelalter, aus Fabeln der Neuzeit oder zeitgenössischen Comics oder Liedern der leichten Muse kennen, der unser Verhalten mit seinen Fehlern und Marotten sozusagen im Gewand des Tiers deutlicher und mit einer der Brechung eigenen Komik zum schmunzelnden Nachdenken vorführt. Es ist eine ‚Phänomenologie des Zwischen‘, wie wir sie ansonsten in philosophisch anthropologischer und politischer Weise vielleicht in solcher Ausdrücklichkeit nur bei Hannah Arendt finden, und dort ist sie anders hergeleitet und trägt deutlich andere Konturen.
Es ist eine ‚Phänomenologie des Zwischen‘, wie wir sie ansonsten in philosophisch anthropologischer und politischer Weise vielleicht in solcher Ausdrücklichkeit nur bei Hannah Arendt finden, und dort ist sie anders hergeleitet und trägt deutlich andere Konturen. Nichts dergleichen findet sich in Bubers hier vorgebrachter Vorstellung. Buber geht es um einen kommunikativen Blick, in dem das Da- und So-Sein allererst je gewonnen werden. Erst dieses Zwischen setzt die Beteiligten in Freiheit und damit in die Möglichkeit, daß sich ihr Leben vollzieht, was der auch als Religionsphilosoph bekannte Denker etwas aufgeladener als „Schicksal“ umschreibt. Dem Tier geht in diesem Blick in Bubers Beschreibung etwas über sein Tiersein hinaus, am ihm wird und dem Haustier selbst auch eine Offenheit gewahr, die sich im „sprechenden Blick“ entäußert. Der Blick selbst, dieses phänomenologisch so schwer zu Fassende, wird in seiner Sprachlichkeit bis hin zu seiner haptischen Qualität der Berührung, – sein Ort zwischen Ideellem und Materialem – , ernst genommen. Buber belegt es auch mit der Kennzeichnung des „Stammelns“, eines ohnehin seit Parmenides sehr philosophischen Zustandes, in dem unter anderem einem Staunen über das bloße Dasein all dessen, was ist, Ausdruck verliehen wird. Es ist ein nahezu philosophisches Haustier, das zwar nichts offenbart, aber „eröffnet“, dem Staunen und Fragen zugesellt sind. Was sich zwischen Tier und Mensch hier ereignet, geschieht wechselseitig und doch jenseits von Zähmung oder Verwilderung. Wenngleich beides kurz in diesem Aufeinandertreffen aufglimmt, so könnte doch gar nicht mehr ausgemacht werden, ob einer hier gezähmt und der andere verwildert wäre, es spielt keine Rolle mehr. Dem Menschen aber tritt in dieser ‚Begegnung‘ mit dem Haustier, – denn das ist sie als annähernde Ich-Du-Relation, sein Untier-sein schmerzlich hervor.
Nichts dergleichen findet sich in Bubers hier vorgebrachter Vorstellung. Buber geht es um einen kommunikativen Blick, in dem das Da- und So-Sein allererst je gewonnen werden. Erst dieses Zwischen setzt die Beteiligten in Freiheit und damit in die Möglichkeit, daß sich ihr Leben vollzieht, was der auch als Religionsphilosoph bekannte Denker etwas aufgeladener als „Schicksal“ umschreibt. Dem Tier geht in diesem Blick in Bubers Beschreibung etwas über sein Tiersein hinaus, am ihm wird und dem Haustier selbst auch eine Offenheit gewahr, die sich im „sprechenden Blick“ entäußert. Der Blick selbst, dieses phänomenologisch so schwer zu Fassende, wird in seiner Sprachlichkeit bis hin zu seiner haptischen Qualität der Berührung, – sein Ort zwischen Ideellem und Materialem – , ernst genommen. Buber belegt es auch mit der Kennzeichnung des „Stammelns“, eines ohnehin seit Parmenides sehr philosophischen Zustandes, in dem unter anderem einem Staunen über das bloße Dasein all dessen, was ist, Ausdruck verliehen wird. Es ist ein nahezu philosophisches Haustier, das zwar nichts offenbart, aber „eröffnet“, dem Staunen und Fragen zugesellt sind. Was sich zwischen Tier und Mensch hier ereignet, geschieht wechselseitig und doch jenseits von Zähmung oder Verwilderung. Wenngleich beides kurz in diesem Aufeinandertreffen aufglimmt, so könnte doch gar nicht mehr ausgemacht werden, ob einer hier gezähmt und der andere verwildert wäre, es spielt keine Rolle mehr. Dem Menschen aber tritt in dieser ‚Begegnung‘ mit dem Haustier, – denn das ist sie als annähernde Ich-Du-Relation, sein Untier-sein schmerzlich hervor.
 Wenn Bubers dialogisches Prinzip von der „zwiefachen“ Haltung des Menschen ausgeht, die er mit den „Grundworten“ Ich-Du und Ich-Es umschreibt, die in jeder Verwendung des Ichs, in jeder Bezugnahme auf das Selbst gleichsam die Möglichkeit der Offenheit und die der Zweckgerichtetheit bezeichnen, und er zugleich anthropologisch von den zwei Grundprinzipien „Urdistanz“ und „Beziehung“ ausgeht, dann stellt diese Situation mit dem gezähmten und doch fremd bleibenden Haustier jenes Zwischen heraus, das für den interpersonalen Ansatz von Buber signifikant ist und ihn stark macht, gerade auch weil es sich hier nicht um ein Verhältnis zwischen Personen handelt. Das Zwischen, die Begegnung, der Blick, in dem sich beides manifestiert, hat gestaltende Kraft, schöpferische Potenz, die sich nicht nur aus Negation, Konkurrenz oder Nichtung begreift. Beide, Tier und Mensch, scheinen nicht nur – für den gläubigen und religiösen Denker Buber – als von einem Kreator geschaffene Kreaturen auf, sondern werden in der ihnen selbst eigenen Kreativität erhellt, in der nicht mehr und nicht weniger als eine Beziehung, ein kurzes Miteinander in Ebenbürtigkeit aufblitzt. Das unfassbare Glück solchen Augenblicks berührt sogleich in seinem Vergehen tief Trauriges, das ihm innewohnt. Das melancholische Moment macht der unumgehbare Rückfall in die jeweilige Kreatürlichkeit aus, jene hier im „Blick“ vermittelte wie geborgene Erkenntnis, die die damit Konfrontierten so jäh wie schleichend überfällt: Die Gewissheit, der oder dasjenige Andere nie sein zu können. Es ist jene Erfahrung, mit einer Fremdheit in Berührung gekommen zu sein, die radikal unüberwindbar nie ganz vergehen wird und doch der Begegnung eignet.
Wenn Bubers dialogisches Prinzip von der „zwiefachen“ Haltung des Menschen ausgeht, die er mit den „Grundworten“ Ich-Du und Ich-Es umschreibt, die in jeder Verwendung des Ichs, in jeder Bezugnahme auf das Selbst gleichsam die Möglichkeit der Offenheit und die der Zweckgerichtetheit bezeichnen, und er zugleich anthropologisch von den zwei Grundprinzipien „Urdistanz“ und „Beziehung“ ausgeht, dann stellt diese Situation mit dem gezähmten und doch fremd bleibenden Haustier jenes Zwischen heraus, das für den interpersonalen Ansatz von Buber signifikant ist und ihn stark macht, gerade auch weil es sich hier nicht um ein Verhältnis zwischen Personen handelt. Das Zwischen, die Begegnung, der Blick, in dem sich beides manifestiert, hat gestaltende Kraft, schöpferische Potenz, die sich nicht nur aus Negation, Konkurrenz oder Nichtung begreift. Beide, Tier und Mensch, scheinen nicht nur – für den gläubigen und religiösen Denker Buber – als von einem Kreator geschaffene Kreaturen auf, sondern werden in der ihnen selbst eigenen Kreativität erhellt, in der nicht mehr und nicht weniger als eine Beziehung, ein kurzes Miteinander in Ebenbürtigkeit aufblitzt. Das unfassbare Glück solchen Augenblicks berührt sogleich in seinem Vergehen tief Trauriges, das ihm innewohnt. Das melancholische Moment macht der unumgehbare Rückfall in die jeweilige Kreatürlichkeit aus, jene hier im „Blick“ vermittelte wie geborgene Erkenntnis, die die damit Konfrontierten so jäh wie schleichend überfällt: Die Gewissheit, der oder dasjenige Andere nie sein zu können. Es ist jene Erfahrung, mit einer Fremdheit in Berührung gekommen zu sein, die radikal unüberwindbar nie ganz vergehen wird und doch der Begegnung eignet.