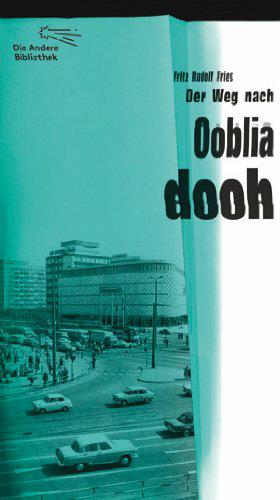Religion und Politik |
Erinnere Dich!BuchempfehlungenAndreas Mertin Nachrichten von der Anderen BibliothekIn der Anderen Bibliothek sind im letzten Jahr einige Bücher erschienen, die von gebrochenen Biographien künden: Ein Schriftsteller, der zum militanten Aktivisten wurde; drei Schriftstelle, die je auf ihre Weise auf die Vernichtung einer ganzen Kultur reagieren mussten; und ein Schriftsteller, der einen aufregenden zeitdiagnostischen Roman geschrieben hat, dem aber aufgrund seiner Opposition zum wie auch seiner punktuellen Verstrickung mit dem Staatsapparat die angemessene Anerkennung versagt blieb. Alles in allem: überaus aufregende Lektüren. Klappentext: "Ein Gesellschaftsroman über den Untergang des bürgerlich-jüdischen Odessa zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine Wiederentdeckung – Die »Buddenbrooks« am Schwarzen Meer. Im Jahr 1935 unternimmt Vladimir Jabotinsky, streitbarer Mitbegründer der zionistischen Bewegung und brillanter Feuilletonist, eine imaginär-romanhafte Reise in das alte Odessa, in dem er 1880 geboren wurde, seine Kindheit und jungen Jahre verbrachte. Die Fünf: eine elegische Erinnerung an eine vergehende Welt, verkörpert in den fünf Geschwistern der Familie Milgrom, die in den politisch-kulturellen Wirren ihrer Zeit, zwischen revolutionärer Gewalt und Assimilation, heranwachsen. Das damalige Odessa ist noch eine kosmopolitisch tolerante Stadt am Schwarzen Meer, ein Vielvölkergemisch, in dem das Ukrainische und das Russische, das Jüdische und das Deutsche, das Armenische und das Griechische nebeneinander existieren. Durchdrungen vom Parfüm dieser sinnlichen, vitalen und polyglotten Prosa, begegnet uns in Vladimir Jabotinskys Roman vom Verfall einer Familie ein intimes Odessa mit seinen Plätzen, Straßen und Cafés – ein theatralisches, tragisches Menschenschauspiel. Es sind die letzten Tage von Odessa." An diesem Roman, der sehr schnell nach seinem Erscheinen zur Erfolgsausgabe wurde, sind drei Dinge bemerkenswert: Zum einen die Schilderung des kulturellen, gesellschaftlichen und jüdischen Lebens in Odessa am Beginn des 20. Jahrhunderts. Es ist ja heute schwer, sich das Leben vor der Shoa in Europa überhaupt nur vorzustellen. Was war normal, wo kündigte sich das Entsetzen schon an, wie fand es Eingang in die alltägliche Wirklichkeit? Davon berichtet dieser Roman authentisch und lässt wenig aus. Der Roman entfaltet in unterschiedlicher Intensität das Schicksal von fünf Personen, die sich differenter kaum entwickeln könnten. Der Roman liest sich über weite Strecken spannend und interessant (vor allem wenn man konsequent jeweils die Querverweise nachschlägt), hat aber auch Längen und manche sprachliche Wiederholung (etwa wenn der Autor immer wieder betont, er erinnere sich nicht genau und könne die Ereignisse deshalb nicht exakt wiedergeben). Dennoch ist es eine interessante Schilderung des Lebens in Odessa in den Wirren am Anfang des 20. Jahrhunderts, einer Zeit in die wir nur begrenzt Einblick haben. Das Zweite, was dieses Buch interessant macht, ist die Biographie seines Autors, der sich nach und nach aufgrund der historischen Erfahrungen radikalisierte.
Hellsichtig sah Jabotinsky bereits Anfang der 30er-Jahre die fatale Situation des Judentums: „Es gibt keine Zukunft in der Diaspora. Alle Juden werden dort vernichtet werden. Die sogenannten neuen Kräfte, die sich weltweit erheben, werden das jüdische Volk nicht retten. Die einzige sichere Zuflucht ist Eretz Israel, und wenn wir unser Volk retten wollen, müssen sie jetzt auswandern! Wenn wir die Diaspora nicht liquidieren, wird sie uns liquidieren!“ Das alles spielt im Roman „Die Fünf“ natürlich allenfalls am Rande eine Rolle, es geht um das Eingedenken des bürgerlich-jüdischen Lebens in Odessa am Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Dritte, was dieses Buch interessant macht, ist seine überaus erfolgreiche Wiederkehr als Roman in der Gegenwart. Offenkundig muss ein latentes Interesse vorhanden sein, sich mit der Vorgeschichte der Vernichtung der Juden im 20. Jahrhundert, mit dem Umschlag von der scheinbaren bürgerlichen Normalität in das Grauen auseinanderzusetzen. Ich hoffe jedenfalls, dass der Roman nicht nur als Unterhaltungsroman gelesen wird. Klappentext: „Die Erinnerung an Jiddischland: Der Roman über die Magie einer Sprache, einer Kultur, eines Volkes In ihrem römischen Palais, wie außerhalb der Zeit, hütet Sulamita, eine alte Dame, das Gedächtnis – an ein verlorenes Land, ein versunkenes Atlantis, wo zwischen den beiden Weltkriegen in Warschau die Poesie regierte; verfasst in Jiddisch, dieser unvordenklich alten Sprache, Muttersprache von 11 Millionen Menschen vor dem letzten Krieg. Die Waise Pierre sucht das Gespräch mit Sulamita – auf der Suche nach seiner verlorenen Vergangenheit, den eigenen Ursprüngen, nur mit dem Namen seiner polnischen Großmutter im Lebensgepäck. Sulamita antwortet ihm aus dem Palast der Erinnerung. Wir folgen dem Werdegang von drei Dichtern, »Sternschnuppen« am Himmel von Warschau, die sich entschieden hatten, die alte Sprache Jiddisch einheimisch zu machen: Peretz Markish (1895–1952), Melekh Rawicz (1893–1976) und Uri Zvi Grinberg (1896–1981). Drei Dichter, die sich über alle Kontinente zerstreuten. Damals waren sie jung, hatten ihre Geliebten und den Ruhm in ihrer Sprache – bis zur Katastrophe, in der alles verschwand, das Land und die Bücher, die Körper und die Seelen. »Im Palast der Erinnerung« wird alles wieder lebendig, erwachen die Geschichten, Anekdoten, Briefwechsel, Gedichte; es wiedererwachen alte Landschaften, Polen, Weißrussland, die Ukraine, Österreich-Ungarn – es leuchtet in Prosa und Poesie die Sprache eines alten Europa.“ In der Sache – wie begreift man das, was das 20. Jahrhundert an Grauen bestimmt hat, wie wurde es möglich und wie hat es in zeitgenössischer Perspektive ausgesehen – finde ich „Im Palast der Erinnerung“ von Gilles Rozier wesentlich überzeugender und aufschlussreicher als „Die Fünf“ von Jabotinsky. Das Buch ist aber auch schwieriger zu rekapitulieren, aber man liest es mit deutlich mehr Gewinn. Am Beispiel von drei Biographien wird ein Teil der Geschichte der jiddischen Literatur und der damit verbundenen Kultur rekonstruiert. Die Rahmung des Ganzen ist wunderbar (im wörtlichen Sinne) geschrieben und konstruiert: Die Erkundung der eigenen Herkunft im Gespräch mit der Bewohnerin des Palastes der Erinnerung in Rom. Zum Autor: Gilles Rozier (* 1963 in La Tronche im Arrondissement Grenoble) ist ein französischer Schriftsteller und Übersetzer. Er lernte Hebräisch und Jiddisch bei Rachel Ertel und arbeitete zunächst in einer Pariser Kaufhauskette. Die Begeisterung für diese Sprachen führte ihn zur Promotion in jiddischer Literatur. Er ist Direktor des Pariser Hauses für jiddische Kultur. (Wikipedia, Art. Gilles Rozier)
von denen letzterer wie der schon vorgestellte Vladimir Jabotinsky bei der radikalen Terrororganisation Irgun mitarbeitete. Und es geht um das Jiddische, jene tausend Jahre alte Sprache der ashkenasischen Juden in Europa. Jiddisch ist „eine aus dem Mittelhochdeutschen hervorgegangene westgermanische, mit hebräischen, aramäischen, romanischen, slawischen und weiteren Sprachelementen angereicherte Sprache“. Vor allem geht es den beschriebenen Schriftstellern um ihre Poesie, ihre Fähigkeit, das Leben auszudrücken, um den expressiven Gestus: »Expression, Expression, immer habt ihr nur dieses Wort im Mund. Aber wir verstehen euer Gewäsch nicht. Expression ... Wüstes Zeug schreibt ihr, das verstehen wir. Ihr wollt alles sagen dürfen, aber hört euch doch an! Ist das eure Revolution?« Und Uri-Zwi entgegnete lachend: »Begreift ihr nicht, dass von heute an ein Tisch ein Bett sein wird und eine Hand eine Nase? Ein Schuh wird zur Wanduhr, und der Bauch einer Frau ist der Altar des Opferpriesters!« (S. 195) Im Paalast der Erinnerung ist eine lohnenswerte Lektüre! Klappentext: »I knew a wonderful princess in the land of Oo-bla-dee.« Einer lautmalerisch verfremdeten und verspielten Songzeile des Bebop-Jazzers Dizzy Gillespie entstammt das Sehnsuchtsmotiv der jugendlichen Rebellen Arlecq und Paasch: Die Außenseiter träumen von »dekadenter« Musik und von Westlektüre, von einem Land, das nicht die DDR der Jahre 1957/58 ist. Phantasie ohne Grenzen; Arlecchino und Pasquariello. Der Weg nach Oobliadooh, das fulminante literarische Debüt des damals 31-jährigen Fritz Rudolf Fries, spanisch aufgewachsener polyglotter und phantastisch verspielter Einzelgänger in der Leipziger Provinz, führte nicht auf den Weg nach Bitterfeld – in die sozialistische Literatur, vielmehr in die sprachartistische Moderne der Weltliteratur. Das virtuose Romanschelmenstück von Fritz Rudolf Fries kam – natürlich – nicht durch die Zensur, es erschien auf Vermittlung Uwe Johnsons in Frankfurt am Main. Bei Amazon gibt es eine wunderbare „Rezension“ dieses Buches noch zu der früheren Ausgabe im Suhrkamp-Verlag. Unter der Überschrift „grauenhaft, hat keinen Stern verdient“ schreibt ein C. Meyer 2007: „Im Rahmen des Studiums muss ich diesen Roman lesen und ich finde ihn einfach grauenhaft. Der Einstieg in den Roman fällt schwer, da Fries sehr bruchstückhaft erzählt und sich der Leser die Geschehnisse selbst zusammen setzen muss. Dies erschwert den Leseprozess ungemein, so dass man nach den ersten Seiten schon sehr gernevt von diesem komischen Schreibstil ist. Man erhält einen groben Überblick über die Figuren, das war aber schon alles, ansonsten passiert nicht wirklich etwas was von Interesse wäre. Ich kann dieses Werk nicht weiterempfehlen!“ Wenn man das liest, weiß man sofort, dass man einen besonderen, sprachlich ausgefeilten Roman vor sich hat und ist – so geht es jedenfalls mir – sofort geneigt, ihn zu bestellen und zu lesen. Dass nur wenige Kunden diese „Rezension“ hilfreich fanden, verstehe ich nicht, macht doch der Rezensent gleich am Anfang auf seinen Horizont aufmerksam. Er wollte leicht verdauliche Kost und keine Erzählung, die er sich erst selbst zusammensetzen muss. Und tatsächlich ist der Einstieg in den Roman atemberaubend. Wie die Sprache sich dem Rhythmus des Geschehens anpasst, wie man aufpassen muss, dass man in der Hektik der Großstadt nicht die Übersicht verliert. Wie man dann merkt, dass dieses Buch gesättigt von Anspielungen und Zitaten ist – das alles ist wirklich faszinierend und macht das Werk lesenswert. Selbstverständlich werden einem die Erträge nicht in den Schoß gelegt, sondern man muss dem Rhythmus des Ganzen schon folgen. Wer sich aber darauf einlässt, wird belohnt. Die Verbindung mit den anderen beiden Romanen liegt in dem biographischen Umstand, dass 1996 bekannt wurde, dass der Autor IM der Stasi war. Das verstellt offensichtlich manchen die Fähigkeit, Literatur als Literatur zu lesen. Er sieht nur noch die Nachgeschichte und nicht mehr das Werk selbst. Es ist so, als wenn man Werke wie die von Caravaggio nach dessen Lebensstil beurteilen würde, oder den Roman von Jabotinsky nach dessen späterer politischer Karriere. Letztlich geht es darum, sich das literarische Urteil zu ersparen. Das Buch von Fries ist aber auch heute noch eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Literatur, eine Verbindung von Sprache und Musikalität, von Zeitgenossenschaft und Tradition.
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/82/am429.htm
|
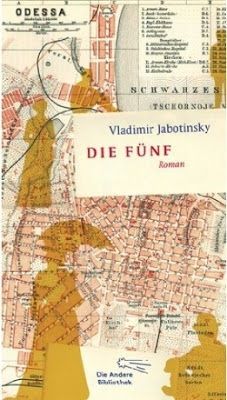
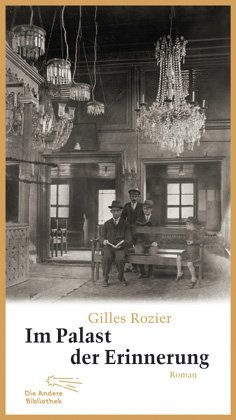
 Im Kern geht es aber um das Leben und Schreiben von
Im Kern geht es aber um das Leben und Schreiben von