Ein schlichtes Herz?
Ironisch-sarkastische Kirchen- und Religionskritik bei Gustave Flaubert
Hans-Jürgen Benedict
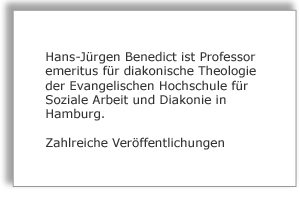 1. Emmas Liebesreligion – eine fatale Schwärmerei 1. Emmas Liebesreligion – eine fatale Schwärmerei
Gustave Flaubert hat in seinen Romanen und Erzählungen den Bereich von Kirche und Religion nicht ausgespart. Im Gegenteil, er weist ihm seinen Platz zu, fast in einer Art system(theoret)ischer Darstellung von Gesellschaft. Die kirchliche Lebenswelt kommt wie selbstverständlich vor, neben Politik, Rechtswesen, Wirtschaft, Kultur. Unbeteiligt beschreibt Flaubert in Madame Bovary die Religiosität der Heldin, von ihrer religiös-romantischen Schwärmerei als junges Mädchen bis zu ihrem verzweifelten Versuch, Trost und Hilfe beim Pfarrer zu finden, als gegen Ende des Romans die ungelösten Konflikte über ihr zusammenschlagen. Das System Religion kann aber das Problem aus dem Bereich Ökonomie nicht lösen. Denn bei Flaubert ist die Geldgesellschaft bereits voll etabliert, auch in der Provinz in der Gestalt des Händlers und Wechslers, der bezeichnenderweise L’Heureux heißt. Er treibt Emma geschickt in immer größere Verschuldung, je stärker ihre Jagd nach Liebe Fehlschläge erleidet. Emma bildet ihre Glücksvorstellung an den Bildern von Seligkeit, Rausch und Leidenschaft, die sie in den Romanen ihrer Mädchenzeit in der Klosterschule kennengelernt hatte, nachdem die religiöse Schwärmerei verflogen war. Die Liebesschwärmerei der katholischen Religiosität und die der Trivialliteratur sind benachbart, weil sie beide Illusionen einer Scheinwelt beschwören. Der katholische Glaube ist poetisch, weil er Seelenregungen und Gefühle reizt und das durch sinnliche Reize unterstützt – Weihrauch, Kerzen, Andachtsbilder. Aber die Liebe zu Gott, zu dem süßen Heiland Jesus, der Jungfrau und den Heiligen lässt Emma unbefriedigt, auch wenn sie bis zuletzt immer wieder Zuflucht zu diesen Tröstungen sucht. Flaubert versucht diese Gefühlslage so objektiv wie möglich zu erfassen, aber es scheint, als ironisiere oder persifliere er die katholische Religion als Opium für das Volk, besonders für die Frauen. Wirklicher und illusionärer Trost liegen nahe beieinander.
Wirkliche Sensation verschafft Emma erst die ehebrecherische Liebe zu Rodolphe. In ihr erfüllt sich alles, was sie zuvor illusionistisch erträumt und was sie in der Ehe mit Charles Bovary vermisst hatte. Aber auch hier erfolgt der Absturz, weil dem männlichen Liebhaber das Leben mit einer so schwärmerischen Frau zu riskant ist. Glück ist hier nicht durch Liebe erfüllte Lücke des individuellen Daseins, sondern illusionistische Steigerung eines unglücklichen Gefühls. Man sollte meinen, dass sie diesen Schock nicht überlebt. Als sie mit ihrem Mann eine Aufführung der Donizetti-Oper Lucia di Lammermoor in Rouen besucht, kehrt ihre jugendliche Schwärmerei zurück. Aber der Vorschein von Glück in der Kunst ist nur die Eröffnung zu einem neuen Liebesabenteuer mit dem Jurastudenten, es beginnt interessant genug in der Kathedrale als riesigem Boudoir, um in der Kutsche seine erste Erfüllung zu finden. Der Ehebruch in dem rumpelnden Gefährt (das sehr klein war, wie wir in Barnes Flauberts Papagei[1] erfahren) war Anlass für die Anklage gegen Flaubert. Die Sensation des heimlichen Liebesglücks nutzt sich aber auch hier bald ab. Ihre Verschuldung wird ruchbar. Der Pfarrer, den Emma in ihrer Verzweiflung aufsucht, versteht sie nicht und ergeht sich in allgemeinen Trost- und Beruhigungsformeln. Einen Ausweg bietet nur der Selbstmord, der mitleidslos-realistisch geschildert wird.
Nachdem Geld und Liebe als Glücksmedien versagt haben, kehrt sie nach der letalen Einnahme des Gifts in den Schoß der Kirche zurück, empfängt die letzte Ölung und sieht wie der Erzmärtyrer Stephanus den Himmel offen. Eine Persiflage ekstatischer Seligkeitserfahrung.
2. Wirklich „ein schlichtes Herz“? Der Heilige Geist als Papagei
Eine Ausnahme von dieser ironischen Darstellung des Glaubens scheint die Erzählung Ein schlichtes Herz (Un Coeur simple) aus den Drei Erzählungen (Trois Contes) zu machen.[2] Flaubert hat dazu selber Anlass gegeben, indem er in einem Brief an Madame des Genettes vom 19. Juni 1876 schrieb:
„Die Geschichte eines schlichten Herzens ist nichts weiter als der Bericht über ein unscheinbares Leben, das eines armen Mädchens vom Lande, welches fromm aber nicht mystisch ist, hingebungsvoll ohne Exaltiertheit und zart wie frisches Brot. Sie liebt nacheinander einen Mann, die Kinder ihrer Herrin, einen Neffen, einen Greis, den sie pflegt, dann ihren Papagei; als der Papagei tot ist, lässt sie ihn ausstopfen, und als sie selbst im Sterben liegt, verwechselt sie den Papagei mit dem heiligen Geist. Das ist keineswegs ironisch, wie Sie annehmen, sondern im Gegenteil sehr ernst und sehr traurig.“ Und dann ganz persönlich: „Ich will Mitleid erregen, die empfindsamen Seelen zum Weinen bringen, da ich selbst eine bin. Ja, leider! Am letzten Samstag bei der Beerdigung von George Sand bin ich in Schluchzen ausgebrochen, als ich die kleine Aurore umarmte, und dann den Sarg meiner alten Freundin sah.“[3]
Und am Schluss des Briefes dann allerdings mit leicht spöttischer Selbstkritik auf die geplanten weiteren zwei der Drei Erzählungen:
„nach dem heiligen Antonius der heilige Julianus, (will sagen Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien; HJB) danach Johannes der Täufer (will sagen Herodias; HJB), ich komme aus dem Heiligen nicht heraus.“[4]
Ist das noch der Schriftsteller, der bislang die verlogenen moralistischen Haltungen der Bürger in der Provinz immer kritisiert hatte. Will er in Ein schlichtes Herz tatsächlich ein Dienstmagdschicksal sentimentalisch schildern, dessen literarisch rührselige Aufbereitung durch Lamartine er früher entschieden abgelehnt hatte? Wird er zum reuigen Büßer, der Abstand nimmt von seiner ironischen Distanz zur Religion, weil er im Alter vereinsamt - erst stirbt die Mutter, dann zwei gute Freunde und 1876 sterben die wichtigen Freundinnen, seine frühere Geliebte Louise Colet und George Sand?
Dagegen spricht jedoch, was er anlässlich des Todes von George Sand an Madame des Genettes schrieb:
„George Sand hat keinen Priester empfangen und ist völlig unbußfertig gestorben. Doch hat Madames Clesinger um des Schicks willen an den Bischof von Bourges telegrafiert und um eine katholische Beisetzung gebeten. Der Bischof hat geflissentlich mit Ja geantwortet (…) ich habe den Doktor Favre und den guten Alexandre Dumas in Verdacht, daß sie kräftig zu dieser Gemeinheit oder Rücksicht auf die Konvenienzen beigetragen haben…“[5]
Flaubert bewundert diesen starken Geist (esprit fort) der George Sand, die nicht zu Kreuze kriecht. Gleichzeitig zeigt er aber auch Achtung für die schlichte Herz der Magd und wehrt sich durch seinen Kommentar gegen den Verdacht, er wolle sie „durch Ironie zur Karikatur verzerren.“[6]
Zunächst ist die Erzählung Ein schlichtes Herz noch etwas ausführlicher wiederzugeben, als es in Flauberts lakonischer Zusammenfassung geschieht. Felicite heißt die Dienstmagd, die die Heldin der Erzählung ist. Sie dient bei der Witwe Aubain in Pont L’Eveque mit ihren Kindern Paul und Virginie. Eine treue, fleißige und gewissenhafte Magd ohne Ansprüche, in Flauberts unübertrefflichem Kurzportrait:
„Für hundert Franc im Jahr versah sie Küche und Haushalt, nähte, wusch, bügelte, konnte ein Pferd anschirren, das Geflügel mästen, Butter schlagen und blieb ihrer Herrin treu, die indes keine angenehme Person war.“ (9) – „Jahraus, jahrein trug sie ein Schultertuch aus Kattun, das im Rücken mit einer Nadel festgesteckt wurde, eine Haube, die ihr das Haar verdeckte, graue Strümpfe, einen roten Rock und über ihrer Jacke eine Latzschürze wie die Krankenschwestern im Spital. Ihr Gesicht war hager und ihre Stimme schrill. Mit fünfundzwanzig hielt man sie für vierzig: seitdem sie fünfzig geworden war, konnte man ihr Alter gar nicht mehr bestimmen – und angesichts ihrer steten Schweigsamkeit, mit ihrer aufrechten Haltung und ihren gemessenen Gebärden schien sie ein frau aus Holz, die auf eine automatische Weise funktionierte.“ (13)
Sie war ein Waisenkind, wurde Hütemädchen, mit 18 Jahren Viehmagd, da umwarb sie ein junger Mann, der ihr die Heirat versprach und sie dann sitzenließ.
„Das war ein grenzenloser Schmerz für sie. Sie warf sich zu Boden, stieß Schreie aus, rief zum lieben Gott und wimmerte ganz allein auf dem Feld, bis die Sonne aufging.“ (18f)
Nach dieser unglücklich verlaufenen Liebesgeschichte ging sie nach Pont L‘Eveque und es traf sich, dass Madame Aubain gerade eine Köchin suchte. Die beiden Kinder Paul und Virginie werden schnell Objekte ihrer großen Fürsorge.
Ihr Alltag ist streng geregelt. Nur selten bricht eine Abwechslung das „eiserne Gehäuse“ ihres Dienstalltags auf. Dazu gehört, dass Felicite ihren Schützling, die zarte Virginie, zum Katechismusunterricht in die Kirche begleiten darf. Was sie dort erfährt, ist gewissermaßen eine Art nachgeholte christliche Erziehung bzw. Einweisung ins Christentum (Zitat 35, 37)
„Der Pfarrer stand am Pult. Auf einem Fenster der Apsis schwebte der Heilige Geist über der Jungfrau Maria. Ein anderes zeigte sie kniend vor dem Jesuskind. Der Pfarrer gab zunächst einen Abriss der biblischen Geschichte … um des Heiligen Geistes willen“.
In wenigen Sätzen gelingt es Flaubert, die Schlichtheit der biblischen Geschichten und des Evangeliums zu evozieren. Ihr Alltag und der der Bibel überschneiden sich. Probleme aber hatte die Magd mit dem heiligen Geist.
„Sie hatte Mühe ihn sich vorzustellen, denn er war nicht nur Vogel sondern auch Feuer und andere Male wieder ein Hauch. Ist es vielleicht sein Licht, fragt sie sich, das nachts über dem Rand der Moore flimmerte, sein Atem, der die Wolken treibt, seine Stimme, die den Glocken ihren Wohlklang verleiht?“
So sinniert sie, begreift nichts von den Dogmen, die der Pfarrer zu erklären versucht, schläft ein, wacht auf vom Holzschuhgetrappel der Kinder. Sie ist völlig mit ihrem Schützling Virginie identifiziert, fastete und beichtete wie sie, erlebt ihre Erstkommunion als wäre es die eigene.
„Sie war in Aufregung wegen der Schuhe, des Rosenkranzes, des Gesangbuchs, der Handschuhe, mit welchem Zittern half sie der Mutter das Kind anzukleiden.“
Flaubert beschreibt das Ritual.
„Als Virginie an der Reihe war, beugte sich Felicite vor, um sie zu sehen, und dank jener Einbildungskraft, die die wahre Zärtlichkeit verleiht, schien es ihr, als sei sie selbst dieses Kind; seine Gestalt wurde zur ihrigen, sein Kleid umhüllte sie, sein Herz schlug in ihrer Brust. Und in dem Augenblick, wo es den Mund öffnete und die Augen schloß, schwanden ihr fast die Sinne.“ (39)
Bei ihrer eigenen Kommunion am nächsten Morgen ist das religiöse Erleben lange nicht so intensiv. Die kleine Virginie wird wegen eines besseren Sprachunterrichts dann in eine Klosterschule gegeben. Für die Mutter wie die Magd ein schwerer Verlust. Ein wichtiger Teil ihrer alltäglichen Verrichtungen fällt weg.
Ähnlich identifiziert ist Felicite mit ihrem Neffen Viktor. Die Fürsorge, die sie ihm angedeihen lässt, nimmt zu. Doch dann muss er, wir schreiben das Jahr, 1819 zur See fahren und geht schließlich auf eine lange Fahrt, nach Amerika. Sie will ihn in Le Havre verabschieden, kommt jedoch einen Augenblick zu spät, um ihm Lebewohl zu sagen. Auf dem Rückweg kommt sie am Kalvarienberg vorbei, „sie wollte Gott das anbefehlen, was sie am meisten liebte. Und sie betete lange stehend, mit tränenüberströmten Gesicht, die Augen zu den Wolken erhoben.“ Nach sechs Monaten ohne Nachricht von ihrem Neffen erhält sie einen Brief, in dem ihr sein Tod mitgeteilt wird. Man hatte ihn wegen des Gelbfiebers zu stark zur Ader gelassen, woran er starb. Auch der kränkelnden Virginies Kräfte lassen nach. Sie stirbt an einer Lungenentzündung. Felicite, wieder zu spät gekommen, hält die Totenwache.
„Sie küßte sie mehrere Male, und sie wäre nicht übermäßig erstaunt gewesen, wenn Virginie sie wieder aufgeschlagen hätte; für Seelen ihrer Art ist das Übernatürliche ganz selbstverständlich.“ (59)
Die Jahre gehen in ihrem gleichen Rhythmus dahin „ohne weitere Ereignisse als die Wiederkehr der großen Feste: Ostern, Himmelfahrt, Allerheiligen.“ (63) Mit ihrer Herrin verbindet sie die andächtige Erinnerung an Virginie, und einmal in ihrem Schmerz um die Verstorbene „umschlangen sie einander und taten ihrem Schmerz in einem Kuß genüge, der sie einander gleich machte.“ (65) In ihrer Herzensgüte pflegt sie Cholerakranke, Soldaten, Polen und schließlich einen verlotterten Alten.
Dann kommt die Juli-Revolution von 1830. Pont L‘Eveque erhält einen neuen Präfekten, einen ehemaligen Konsul in Amerika, er kommt mit seiner Frau und der Schwägerin mit drei Töchtern. „Man sah sie auf ihrem Rasen, in wallende Blusen gekleidet. Sie besaßen einen Neger und einen Papagei.“ (63) Es ist das Zeitalter des Kolonialismus, der Papagei sein Symbol. Von der Frau des Präfekten, der versetzt wird, erhält Frau Aubain den Papagei, namens Lulu .
„Sein Körper war grün, die Spitzen seiner Flügel rosa, seine Stirn blau und seine Kehle golden. Er hatte die lästige Angewohnheit in seine Stange zu beißen, rupfte sich die Federn aus, warf seinen Unrat umher, verspritzte das Wasser seines Bades.“
Madame Aubain, die er damit ärgerte, schenkte ihn für immer Felicite, für die er auch eine Erinnerung an ihren in Amerika gestorbenen Neffen ist.
„Sie machte sich daran ihn zu unterrichten; bald sprach er nach: Reizender Junge. Zu Diensten, mein Herr. Gegrüßet seist du Maria.“
Der Papagei wird ihr ein und Alles. Als er einmal verschwunden ist, sucht sie ihn tagelang, erkältet sie sich und wird zunehmend taub. Als der Papagei eines Tages tot von der Stange fällt, lässt sie ihn ausstopfen. Er bleibt auch so ihr Idol. Dann stirbt auch ihre Herrin. „Sie hatte das Gefühl, das gehöre sich nicht.“ Das Haus steht zum Verkauf an, sie hat Angst, dass Lulu und sie die behagliche Kammer verlassen müssen.
„Sie umfing ihn mit einem angstvollen Blick, flehte zum Heiligen Geist und nahm dabei die götzendienerische Gewohnheit an, ihre Gebete kniend vor dem Papagei zu sprechen.“ (87)
Schließlich erkrankt Felicite ernsthaft, es geht mit ihr zu Ende. Es war die Zeit, als man das Fronleichnamsfest vorbereitete und die Reihe an ihr war, den Altar am Wege der Prozession zu schmücken, der an ihrem Haus vorbeiführte. Sie bittet um die Erlaubnis, den ausgestopften Papagei auf den Altar stellen zu dürfen. Trotz der Proteste der Nachbarinnen erlaubt es der Pfarrer. Und nun beschreibt Flaubert, wie gleichzeitig mit dem Todeskampf von Felicite die Fronleichnamsprozession näherkommt. Der Altar, der aufgebaut ist, wird genau geschildert.
„Lulu zeigte, unter Rosen verborgen nur seine blaue Stirn gleich einem Plättchen aus Lapislazuli … Die Schläge ihres Herzens verlangsamten sich, einer nach dem anderen, wurden von Mal zu Mal undeutlicher, sanfter, wie eine Quelle versiegt, wie ein Echo verhallt; und als sie ihren letzten Atem aushauchte, glaubte sie in dem Himmel, der sich auftat, einen riesigen Papagei zu erblicken, der über ihrem Haupte schwebte.“ (95)
Was tut Flaubert, der neutrale unparteiische Erzähler, hier? Macht er sich über die Vision der Sterbenden lustig? Will er den Glauben an den heiligen Geist durch die Papagei-Vision parodieren? Oder will er sagen: immerhin hatte sie im Sterben durch diese Verwechslung einen Trost? Erfuhr die Magd in der Verehrung des Fetischs Papagei in ihrer Schlichtheit und Beschränktheit zumindest eine Beruhigung? Es sei an die Worte Flauberts erinnert: „Und als sie im Sterben liegt, verwechselt sie den Papagei mit dem heiligen Geist. Das ist keineswegs ironisch, sondern im Gegenteil sehr traurig und ernst. Ich will Mitleid erregen.“ Was ist es wirklich?
In einer hochspannenden Interpretation spüren von Kleffens/Stoll der ikonographischen Vorlage für das Sterben von Felicite mit der Papageienerscheinung nach. Einerseits ist natürlich die Verkündigungsszene das Vorbild, in der wie im Kirchenfenster von Pont L‘Eveque der Heilige Geist als Taube über der Jungfrau Maria zu sehen ist. Siehe, ich bin des Herrn Magd, sagt Maria. Insofern ist Felicite in ihrem aufopfernden Dasein wie in ihrer Simplizität an Maria als Vorbild orientiert. Und die Geschichte ihres Sterbens und ihrer Vision des Heiligen Geistes als Papagei ist gewissermaßen die Vermählung mit dem himmlischen Bräutigam im Moment ihres Sterbens.


 Diese Szene hat aber noch andere ikonographische Vorbilder. Da sind zum einen Gemälde, die eine Frau mit Papagei zeigen, etwa bei Courbets berühmtem Gemälde „Frau mit Papagei“, aber auch bei Dante Gabriel Rossetti und Delacroix. Diese Szene hat aber noch andere ikonographische Vorbilder. Da sind zum einen Gemälde, die eine Frau mit Papagei zeigen, etwa bei Courbets berühmtem Gemälde „Frau mit Papagei“, aber auch bei Dante Gabriel Rossetti und Delacroix.
Was aber ist das Vorbild für die Liebesvereinigung mit dem himmlischen Bräutigam? Einerseits ist auf dem Antlitz der Sterbenden jene Ekstase auszumachen, von der Theresa von Avila spricht, höchster Lohn für die Versenkung in Gott sei die Entrückung.
Zum andern sind ikonographisch die vernichtenden Überschattungen der Frau durch Zeus belegt, sowohl in Leda mit dem Schwan, aber besonders in der Semele-Legende. In der Darstellung des Renaissancekünstlers Antoine Carons stößt der Jupiter-Adler auf die entsetzte Semele, um ihr den Todesstoß zu versetzen. Die Vereinigung mit dem himmlischen Bräutigam als Todeserfahrung ist zugleich die Vernichtungserfahrung.

„Gleich jenen Künstlern inszeniert Flaubert seine ‚Frau mit Papagei als Sterbende‘, die in einer Vision sich selbst als Daliegende und über sich eine gigantische Vogelfiguration Gottes erblickt.“ (ebd, 337)
Diese ist aber ein Trugbild des Todes.
„Der friedliche Schein, der Felicites Sterben umhüllt, ist Flauberts listig-parodistischer Nachvollzug“ jener in den volkstümlichen Andachtsbildern von Epinal „propagierten Idylle.“ (ebd, 338).
Kurz: das Bild selbst – „die Ikone und ihre szenisch-dramatische Entfaltung in der Liturgiefeier (Kommunion, Fronleichnamsfeier usw), das die Ekstase zur Voraussetzung der Teilnahme am Heilsgeschehen erhebt, erweist sich als trügerische Instanz, von deren Nachahmung nur der Tod zu erwarten ist.“ (ebd, 339).
Eine bestechend-detektivische Deutung der Schlusspassage von Ein schlichtes Herz, die aber nur mit der Kenntnis der Bildwerke nachzuvollziehen ist. Der einfachen Lektüre wird sie sich eher so darstellen, wie Flaubert sie kommentiert hat, als eine mild getönte Parteinahme mit der armen Magd, die noch in ihrem Tod sich mit den vom Glauben bereitgestellten Tröstungsbild Taube - Heiliger Geist - Papagei betrügt und doch derart illusionistisch getröstet stirbt. Zu beachten ist aber, dass die Fronleichnamsfeier beim Erstrahlen der Goldsonne, so nennt der Erzähler die die Hostie einschließende Monstranz, zu ihrem Höhepunkt gelangt. Nicht die Symbolgestalt des toten Gottessohns, sondern die Anbetung des schieren Goldes triumphiert, es ist der neue Fetisch der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. (346)
Nachzutragen ist die Deutung, die Julian Barnes in seinem hochgelobten Roman Flauberts Papagei der Schlüsselszene in Un coeur simple angedeihen lässt. Der englische Arzt und Flaubert-Liebhaber Geoffrey Braithwaite fährt nach Rouen, um auf den Spuren seines Idols dem Werk näherzukommen. Sowohl in dem Museum des Hotel-Dieu, dem Krankenhaus, in dem Flauberts Vater tätig war, wie in dem kleinen Flaubert-Museum in Croisset (wo Flauberts Haus stand) wird ihm der Papagei aus Un coeur simple präsentiert. Und beide Male mit dem Anspruch, dies sei der Papagei, den Flaubert auf seinem Schreibtisch stehen gehabt habe. So erklärt das Museum in Rouen: „Von G.Flaubert beim Museum von Rouen entliehener Papagei, der während der Niederschrift von Un coeur simple auf seinem Schreibtisch stand.“ Flaubert bekannte in einem Brief: „sein Anblick beginnt mir auf die Nerven zu gehen. Aber ich behalte ihn, um mein Hirn mit der Idee des Papageientums zu füllen.“ (Wahrscheinlich, so Barnes, ist keiner von beiden das Original, denn das Naturhistorische Museum in Rouen hatte, als sich die Gedenkstätten lange nach Flauberts Tod ihren Papagei holten, 50 Papageien zur Auswahl. Man orientierte sich zwar an Flauberts Beschreibung: „sein Körper war grün, die Spitzen seiner Flügel rosa, seine Stirn blau und sein Kehle goldgelb“ und demnach war die Hotel-Dieu-Version die originalere, aber die Farben können sich, so ein Flaubert-Experte in Barnes Roman, auch im Laufe der Zeit verfärbt haben; also kann es auch sein, dass keiner von beiden Flauberts Papagei ist). Barnes sieht in der Papageien-Szene ein auf das vollkommenste beherrschte Beispiel Flaubertscher Groteske. Und noch mehr – er sieht Parallelen zwischen dem vorzeitig gealterten Flaubert und der rechtzeitig gealterten Felicite. Diese ist im völligen Gegensatz zu Flaubert unfähig sich auszudrücken. Aber hier kommt ihr der Papagei zu Hilfe, „das zum Ausdruck fähige Tier, ein seltenes Geschöpf, das menschliche Laute erzeugt. Nicht umsonst verwechselt Felicite Loulou mit dem heiligen Geist, der die Gabe des Zungenredens verheißt.“ (21) Also folgert Barnes bzw. sein Held Braithwaite: „Felicite + Loulou = Flaubert. Nicht ganz; doch man könnte behaupten, dass er in beidem steckt. Felicite birgt seinen Charakter; Loulou birgt seine Stimme. Man könnte sagen, der Papagei, die Verkörperung geschickter Lauterzeugung ohne viel Hirn, sei das reine Wort.“ (ebd)
Flaubert war von der tragischen Unzulänglichkeit des Wortes überzeugt, wie ein berühmter Satz aus Madame Bovary zeigt:
„Das menschliche Wort ist wie ein gesprungener Kessel, auf dem wir Melodien trommeln, nach denen Bären tanzen können, während wir doch die Sterne rühren möchten.“
Flaubert ist nicht nur der vollendete Stilist, der lange an seinen Sätzen feilte, er ist auch der Autor, der die Sprache für unzureichend hielt. So ist die Worte-Imitation des Papageis „des Romanciers indirektes Eingeständnis versagt zu haben.“ (23) Sartre hat Flaubert in diesem Sinn Passivität der Sprachnachahmung vorgeworfen. „Vielleicht (schwebte)“, als er nach dem Schlaganfall auf dem Sofa im Sterben lag, „über ihm ein riesiger Papagei – diesmal kein Willkommensgruß vom heiligen Geist, sondern ein Lebewohl vom Wort.“ (23) Der Papagei als Emblem der Unfähigkeit und der Vernichtung also auch hier, in Barnes Roman, der sich desillusionierend Flauberts Leben und Schreiben nähert.
3. Die Antworten des katholischen Glaubens auf dem Prüfstand.
Bouvard und Pecuchet
 Flaubert war ein Gegner der katholischen Restauration unter Napoleon III. Sein letztes Werk Bouvard et Pecuchet, ist eine gnadenlose Abrechnung mit dem Bürgertum und seinem angeblichen Fortschrittsdenken. Es handelt von zwei Pariser Beamten, der eine Witwer, der andere Junggeselle, die sich an einem heißen Sommertag in Paris zufällig treffen und sich anfreunden. „Wie schön wäre es doch auf dem Lande“, ruft der eine aus, der andere stimmt zu. Und so beschließen die beiden Biedermänner, sich ein Landgut kaufen, um die Enzyklopädie von Diderot praktisch zu überprüfen und dabei alle möglichen Dummheiten zu begehen und zu entdecken, dass die bürgerliche Aufklärung ihnen keine Frage zufriedenstellend beantworten kann. Jemand hat gesagt, Bouvard und Pecuchet sei „eine Art Faust in zwei Personen“[7]. Die ersten Sätze im großen Faustmonolog enthalten alles, was diesem Roman als Plan zugrunde liegt und dann satirisch entfaltet wird. „Habe nun ach, Juristerei, Philosophie und Medizin, und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühn. Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor.“ Oder zugespitzt formuliert: „Bouvard und Pecuchet ist die Geschichte Fausts, wenn dieser zugleich ein Dummkopf gewesen wäre.“[8] „Eine Art Enzyklopädie, die zur Posse wird“ (Flaubert), ein Roman, für den er, wie er sich rühmte, 1500 Bücher gelesen hatte. Flaubert war ein Gegner der katholischen Restauration unter Napoleon III. Sein letztes Werk Bouvard et Pecuchet, ist eine gnadenlose Abrechnung mit dem Bürgertum und seinem angeblichen Fortschrittsdenken. Es handelt von zwei Pariser Beamten, der eine Witwer, der andere Junggeselle, die sich an einem heißen Sommertag in Paris zufällig treffen und sich anfreunden. „Wie schön wäre es doch auf dem Lande“, ruft der eine aus, der andere stimmt zu. Und so beschließen die beiden Biedermänner, sich ein Landgut kaufen, um die Enzyklopädie von Diderot praktisch zu überprüfen und dabei alle möglichen Dummheiten zu begehen und zu entdecken, dass die bürgerliche Aufklärung ihnen keine Frage zufriedenstellend beantworten kann. Jemand hat gesagt, Bouvard und Pecuchet sei „eine Art Faust in zwei Personen“[7]. Die ersten Sätze im großen Faustmonolog enthalten alles, was diesem Roman als Plan zugrunde liegt und dann satirisch entfaltet wird. „Habe nun ach, Juristerei, Philosophie und Medizin, und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühn. Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor.“ Oder zugespitzt formuliert: „Bouvard und Pecuchet ist die Geschichte Fausts, wenn dieser zugleich ein Dummkopf gewesen wäre.“[8] „Eine Art Enzyklopädie, die zur Posse wird“ (Flaubert), ein Roman, für den er, wie er sich rühmte, 1500 Bücher gelesen hatte.
Für die beiden Helden sind die Bücher, die sie zu Rate ziehen, existentiell wichtig. Ideen sind für sie wie Personen einer wirklichen Welt. Sie setzen sich mit ihnen direkt und real auseinander, denn sie sind immer so engagiert und selbst-experimentell dabei, als ginge es um Leben oder Tod für sie. Sie kommen so von einem Bereich des Lebens zum nächsten und werden dabei nicht klüger, sondern begehen immer wieder den alten Fehler, die Ideen der Bücher zu wörtlich zu nehmen. Scheitern sie mit einem Versuch, kommen sie eher zufällig zur nächsten Sparte. Man könnte dies Verhalten heute in der Sachbuch-. und Ratgeberliteratur entdecken, die vom Durchschnittsbürger intensiv benutzt wird. Denkbar wäre ein ähnlicher Roman über ein Ehepaar, dass die Beziehungs- und Eheratgeber sowie Bücher zur Kindererziehung benutzt und von einem Scheitern in das nächste stolpert.
Die Rundreise durch das Reich bürgerlicher Dummheit beginnt mit der Landwirtschaft. Es folgen Naturwissenschaften, dann die Archäologie und Geschichte, die Literatur, die Politik, die Liebe. Die beiden nächsten und vorletzten Stationen sind die Philosophie und die Religion als weltanschaulich-religiöse Erkundungen in einer Welt, die für Flaubert als Anhänger des Philosophen Spencer letztlich nicht erkennbar ist. Kapitel VIII beginnt nach dem vorherigen Verzicht auf die Liebe („Keine Frauen mehr“) mit einem Gegenmittel, der Gymnastik und dem Turnen als einer Art praktischer Lebenskunst. Als sie merken, dass das Turnen für Leute ihres Alters zu gefährlich ist, Bouvard verletzt sich bei einer Übung im Garten, beschäftigen sie sich mit der Mode des Tischrückens, die damals in Europa und Amerika grassierte. Zunächst darüber belustigt, nehmen sie selber daran teil. Als sie es allein versuchen, kommt kein Geisterklopfen. Enttäuscht wenden sie sich ab und entdecken das Magnetisieren nach Mesmer, erwerben sogar mir ihren Heilmethoden einen gewissen Ruf in der näheren Umgebung. Dann folgt der Spiritismus, zunächst als Lektüre von Swedenborgs Reisen in die Geisterwelt ferner Sterne. Bouvard „kamen sie vor wie die Wahnvorstellungen eines Irren“, aber „vielleicht gibt es eine Zwischeninstanz zwischen uns und dem Jenseits“. Vielleicht gibt es eine Urkraft, die sich beeinflussen lässt. Wie Faust ergeben sie sich der praktisch der Magie: „Um besser in Trance zu geraten, machten sie Nacht zum Tage, fasteten, und da sie aus (ihrer Magd) Germaine ein empfindliches Medium machen wollten, setzten sie sie auf halbe Kost“, bis diese „das Schlürfen ihrer Schritte mit ihrem Ohrensausen und den eingebildeten Stimmen, die sie aus den Wänden dringen hörte, (verwechselte)“ (246). Sie besorgen sich einen alten Schädel und versuchen es mit Totenbeschwörung, meinen auch etwas zu hören, aber es ist nur die alte Magd, die sich unter Gemurmel im Zimmer nebenan bekreuzigt hat. Sie versuchen es mit dem Wünschelrutenlaufen. Eine zufällige Selbsthypnose Bouvard durch seinen glänzenden Mützenschirm bringt sie darauf, dass Trance eine materielle Ursache haben muss. Was ist Materie, was der Geist, fragen sie sich, wie der Einfluß des einen auf das andere. Sie suchen Rat bei Voltaire, bei Bossuet und Fenelon, doch die sind zu langatmig, dann bei den Materialisten (La Mettrie, Locke). Ist die Seele unsterblich? Ja, sagt Pecuchet, nein Bouvard: „Da unsere Seele einen Anfang hat, muss sie auch ein Ende haben, und da sie von den Organen abhängig ist, mit ihnen verschwinden.“ (254) Pecuchet bringt Gott ins Spiel. Aber wenn Gott gar nicht existiert? kontert Bouvard. Pecuchet zitiert den Gottesbeweis des Descartes.
Und kommen so über die Gottesfrage in die Philosophie, versuchen es zunächst mit Spinoza im Original, Gott ist die Substanz, die aus und durch sich selbst ohne Ursache und nur als Ausdehnung und Denken existiert: „Die Ausdehnung umschließt unsere Welt, ist jedoch ihrerseits von Gott umschlossen, der alle möglichen Welten umfaßt…es war ihnen, als trieben sie nachts durch eisige Kälte in einem Ballon, fortgerissen in endloser Fahrt, einem Abgrund von bodenloser Tiefe zu – rings um sie her nichts als das Unfaßbare, Regungslose, Ewige. Das war zuviel für sie. Sie gaben es auf.“ (257) Dann versuchen sie es mit dem Leitfaden der Philosophie für den Schulgebrauch, mit Leibniz, Descartes, Locke, Hegel, (mit dessen Gedanken vom Tod Gottes,sprich den notwendigen Durchgang des Geistes durch das Negative, sie den am Gartenzaun vorbeikommenden Pfarrer ärgern – „keine Gotteslästerung! Nur zum Heil der Menschheit hat er die Leiden auf sich genommen.“ (269) und Berkeley. Sie bleiben von den Antworten der großen Geister unbefriedigt, da treffen sie bei einem Spaziergang auf den Kadaver eines Hundes, der von Würmern wimmelt. „So werden wir auch eines Tages sein“, sagt Bouvard stoisch. Sie sprechen über den Tod. „Ebensogut könnte man gleich ein Ende machen.“ Sie prüfen die Frage des Selbstmord („wenn er Gott beleidigte, würde er dann in unsere Macht stehen?“) und wählen als Todesart das Erhängen. Pecuchet befestigt zwei Stricke an dem Querbalken des Dachbodens. Am Abend des 24.Dezemer geraten sie einen Streit, Pecuchet stürmt auf den Dachboden und steigt auf den Stuhl unter dem Seil, Bouvard hinterher, doch der Selbstmordversuch in der Heiligen Nacht mißlingt, denn „ wir haben ja unser Testament noch nicht gemacht.“ Sie treten an die Dachluke, blicken nach draußen und sehen Lichter, die größer wurden und sich der Kirche näherten. „Neugier trieb die beiden dorthin, es war die Mitternachtsmesse“. Eine Szene ähnlich der im Faust I, wo die die Versuchung des Selbstmords durch die Töne der Osternachtmesse aufgehoben wird. „O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder“, heißt es im Faust. Und bei flaubert: „Alle beteten hingerissen von der gleichen Freude und sahen auf dem Stroh des Stalles den Leib des Gotteskindes wie eine Sonne leuchten. Dieser Glaube der anderen rührte Bouvard trotz seiner Vernunftgläubigkeit und Pecuchet trotz der Verhärtung seines Herzens.“ Nach der Wandlung „erscholl lauter Jubelgesang, die beiden wurden unwillkürlich mitgerissen und es war ihnen zumute, als dämmre eine Morgenröte in ihrer Seele auf.“
Damit endet das Philosophiekapitel und es beginnt der köstliche Abschnitt über die theoretische Erkundung und praktische Erprobung der Religion. Das heißt, die beiden versuchen hier gläubig zu werden und einen frommen Lebenswandel zu führen. Es beginnt mit der mit Bibellektüre, zunächst das Neue Testament, an dem sie die Liebe zu den Niedrigen, das Eintreten für die Armen und die Reinheit des Herzens begeistert (wie sie in den Jesusromanen von Renan und anderen entfaltet wurde). Sie lesen die Nachfolge Christi (von Thomas a Kempis), das irdische Leben erscheint hier so jammervoll. Sie greifen zu den alttestamentlichen Propheten Jesaja und Jeremia und sind von ihnen erschüttert. Am nächsten Tag gehen sie zur Messe, was Aufsehen im Ort erregt, nehmen Kontakt zu Pfarrer Jeufroy auf, der ihnen empfiehlt die Vorschriften der Kirche zu befolgen. Sie versuchen es. Soll man fasten oder nicht, was nützt die Beichte, wie geht man mit den Versuchungen der Fleischeslust um, wie meidet man die Todsünden? Liebe verlangt Opfer, Pecuchet kasteit sich selber. Dann kommt ein Devotionalienhändler auf den Hof – sie tauschen Objekte aus ihrem „Mittelalter-Museum“ gegen allerlei religiösen Krimskrams: einen Johannes der Täufer aus Wachs, die heilige Jungfrau mit blauem Mantel und Sternenkrone. Pecuchet, der frömmelte, nahm durch den Umgang mit dem Pfarrer, ein geistliches Gehabe an, das ihn aber bald selbst anwidert. Bouvard lässt sich mit zu einer Maienandacht nehmen und erlebt eine pantheistische Aufladung seines verkümmerten religiösen Gefühls. „Gott offenbarte sich in seinem Herzen in Gestalt der Vogelnester, der Klarheit der Quellen, der Wohltat des Sonnenscheins“ (286) Schließlich entschließt sich Pecuchet zu einer Marienwallfahrt zur Madonna von Delivandre, fragt Bouvard, ob er mit kommt, der antwortet: „Ich bin doch kein Einfaltspinsel“, fährt aber doch mit - in einem Einspänner, denn eine Wallfahrt zu Fuß (40 km) ist ihnen zu anstrengend. Sie vertiefen sich in die Geschichte des Ortes, nehmen an einer Messe teil, Bouvard reißen die Litaneien der Jungfrau (Du Allerreinste etc..) zu ihr hin, er „ erträumt sie sich auf einem Wolkenberg, Engel zu ihren Füßen, den Gottessohn an ihrer Brust, die Mutter der zärtlichen Liebe, angerufen von allen Bekümmerten dieser Welt, das Idealbild des Weibes, das in den Himmel erhoben ist“ (289) Sie sind jedoch angewidert von dem Geschäft mit den Devotionalien. Zurück auf ihrem Hof entschließt sich Bouvard, anlässlich der Erstkommunion der Kinder des Orts am Abendmahl teilzunehmen. Der große Augenblick ist da. Aber was ist die Folge? „Zu wiederholten malen war ihm versichert worden, das Sakrament werde ihn umwandeln: nun lauerte er ein paar Tage auf den Blütenlenz in seiner Seele. Doch blieb er immer der gleiche. Wie? Das Fleisch des Herrn geht ein in unser Fleisch und hat keinerlei Wirkung zur Folge …“ (296). Pecuchet stellt seine Frömmigkeit öffentlich zur Schau, liest auf der Straße Psalmen, man nennt ihn einen Tartuffe. Dann aber geht er den Weg der Verinnerlichung des Glaubens, versteht die Dogmen symbolisch, nimmt Zuflucht zur mystischen Literatur, ist aber enttäuscht. von ihren Plattheiten. Bouvard hingegen greift zu dem Buch von Hervieu Kritik des Christentums, das die Dogmen in Frage stellt und historische Bibelkritik betreibt, er streitet darüber mit dem Pfarrer, über die Erbsünde, die Dreieinigkeit: Dessen „päpstische Sicherheit“ ärgert ihn. Auch Pecuchet legt dem Pfarrer die Widersprüche der Bibel vor und nimmt, unzufrieden mit dessen Auskünften, seine Zuflucht zu transzendental-philosophischen und mythologischen Gedankengängen. Der Mann in der Soutane rief immer, wenn er am Ende seiner Argumente war: „das ist ein Mysterium.“ Der Pfarrer versucht ihm zu entfliehen, doch Pecuchet geht ihm nach und verwickelt ihn eines Abends auf der Landstraße in ein langes und köstliches Gespräch über die Märtyrer. Während eine Gewitterwolke aufzieht, streiten sie über die Zahl der Märtyrer, wie viel hat es wohl gegeben, 20 Millionen, viel zu hoch, ein scharfer Windstoß fegt vorüber, Pecuchet bestreitet die Legende von der thebäischen Legion und die 11000 Jungfrauen der heiligen Ursula, die ersten Regentropfen fallen, die Katholiken haben mehr Juden, Moslems und Protestanten umgebracht als alle Römer zuvor, der Regen prasselt so stark herab, dass die Tropfen vom Boden wieder aufspringen, auch die Inquisition wandte die Folter an, Damen von hohem Stand wurden in antiken Freudenhäusern bloßgestellt, an Pecuchets Mantel war kein Faden mehr trocken, das Wasser floss ihm den Rücken hinunter, doch der Streit geht weiter, die Protestanten mussten auf Schneefeldern in die Verbannung wandern, die heilige Julia wurde zu Tode geprügelt, von den Ecken des pfarrherrlichen Hutes ergoss sich die Flut wie aus den Wasserspeiern einer Kathedrale. Aber der Streit eskaliert und sie schlagen sich die Grausamkeiten der jeweils anderen Seite weiter um die Ohren. Und selbst als der Regen nachlässt, kehrt keine irenische Stimmung ein. Nebenbei bemerkt muss Bunuel seine Inspiration für sein kirchen- und religionskritisches Opus magnum, den Film Die Milchstraße, von Flaubert bezogen haben. Die dogmengeschichtlichen Gespräche unter Kellnern und Jägern über die Zweinaturenlehre und die Transubstantiation ähneln doch sehr den Dialogen von Pfarrer Jeufroy, Pecuchet und Bouvard.
Einmal noch suchen sie den Pfarrer auf, der gerade beim Nachtisch ist und ihnen zwei Gläser mit Rosolio kredenzt. Es wird über Wunder diskutiert. Bei Gott ist alles möglich, und die Wunder sind ein Beweis für die Wahrheit der Religion. Aber es gibt doch Naturgesetze. Er durchbricht sie, um zu belehren, zu bessern. Aber es gibt doch falsche Wunder. Ja, sicher, aber wie soll man sie von den echten unterscheiden. Und so fort. Bouvard kippt seinen Rosolio hinunter.
„Kurz und gut, die früheren Wunder sind nicht besser erwiesen als die von heutzutage und sie werden mit denselben Gründen verteidigt wie die der Heiden.“
Der Pfarrer wirft vor Zorn seine Gabel auf den Tisch „Ein Atheist, der Gott lästert, ist mir lieber als der krittelnde Skeptiker.“ Auf dem Heimweg ist Pecuchet traurig, denn er hatte gehofft, Glaube und Vernunft zu versöhnen. Sie brechen den Verkehr mit dem Pfarrer ab.
Inzwischen waren zwei Waisenkinder in dem Dorf aufgetaucht, Victor und Victorine, die der Graf bei sich aufgenommen hatte. Sie erweisen sich als undankbar, stehlen usw. Der Graf will sie wieder ins Waisenhaus stecken, da nehmen Bouvard und Pecuchet sich ihrer an.
„Sie schafften sich mehrere Werke über Erziehung an und legten ihr System fest. Jeder metaphysische Gedanke war auszuschließen, und unter Anwendung der experimentellen Methode mußte man der Entwicklung der Natur folgen.“ (325)
Es beginnt das letzte Kapitel der fausti(roni)schen Prüfung bürgerlicher Dummheiten, das über Erziehung und ihr Scheitern. Flaubert starb vor Abschluss des Romans an einem Schlaganfall im Mai 1880. Der Roman erschien postum im März 1881.
Man merkt dem Religionskapitel Flauberts Horror vor Dogmatikern, Metaphysikern und Philosophen an. Bei der Lektüre der theologischen Schriften, die er lesen muss für das Theologiekapitel, ruft er aus:
„Was für ein Haufen von Dummheiten. Was für eine Unverfrorenheit! Was mich empört, sind jene, die den lieben Gott in der Tasche haben und einem das Unbegreifliche mit dem Absurden erklären. Was für ein Hochmut so ein Dogma ist.“ Und weiter: „Nachdem ich in letzter Zeit eine Reihe katholischer Bücher gelesen habe, habe ich die Philosophie Lefevres zur Hand genommen, (‚das letzte Wort der Wissenschaft‘): gehört in die Latrinen geworfen. Das ist meine Meinung. Alles Ignoranten, alles Scharlatane, alles Idioten, die immer nur eine Seite des Ganzen sehen …“[9]
Urteile voller Verachtung über eine apologetische Literatur, die wahrscheinlich nichts Besseres verdient. Man muss sich wundern, dass es Flaubert trotz dieser Verachtung für das katholische Schrifttum seiner Zeit (über das evangelische hätte er vielleicht etwas milder, aber nicht grundsätzlich anders geurteilt) gelungen ist, in seinem Roman die Erkundung des Systems Religion und Glauben so unterhaltsam und amüsant vorzuführen. Die drei Hauptfiguren dieses Kapitels, die beiden Romanhelden und der Pfarrer sind in ihren Disputen so borniert, hilflos und widersprüchlich, dass man als Leser fast Mitleid mit ihnen hat und zugleich über sie lachen muss Sie handeln nach dem Gesetz, nachdem sie angetreten sind
Und die Themen sind ja so dankbar für eine ironisch-sarkastische Darstellung. Die Kirchengeschichte ist natürlich auch „ein Mischmasch von Irrtum und Gewalt“ (Goethe), Herrschaftsinteressen und Hofintrigen in Byzanz und Rom bestimmenden Lauf der Dinge. Voller Absurditäten ist die Dogmengeschichte der ersten Jahrhunderte mit ihren Versuchen, mit Hilfe antiker Philosophie Inkarnations- und Trinitätslehre auszuformulieren, der Sohn „wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater“, Homoousios also und nicht Homoiousios, der Heilige Geist, „der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht“ das berühmte filioque, oder doch nur aus dem Vater?, in einer Terminologie, die heute nur noch hymnisch oder ironisch (s. Bunuels bereits erwähnten Film Die Milchstraße) nachvollziehbar ist. Dann „das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind“ (Goethe). Die umfangreiche katholische Heiligentradition mit ihren pathetischen Frühzeit der Märtyrer, die vielen Sekten, Gnostiker, Nestorianer, Pelagianer etc., die Kämpfe zwischen Kaiser und Papst im Mittelalters, die Geschichte der Selbstdarstellung der Renaissance-Päpste in der Kunst, die Marienerscheinungen, die Frömmigkeitspraxen mit ihren Entzückungen und Absurditäten, die Religionskriege nach der Reformation und so weiter, ein ergiebiges Material, in dem Bouvard und Pecuchet sich bedienen, mal ernsthaft suchend, mal provozierend. Heinrich Heine konnte in den katholischen Symbolen noch die poetische Qualität derselben bewundern (etwa in der Jungfrauengeburt) und zuckte vor der destruktiven Häme zurück, weil er als romantischer Dichter ja selber mit Unwahrscheinlichkeiten und Übersteigerungen der Poesie hantierte, wenn auch stets ironisch gebrochen. (Ich vermute übrigens, dass Flaubert Heines Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland gelesen hat, manches scheint mir die Kenntnis dieses für die Franzosen geschriebenen Werks vorauszusetzen.) Flaubert aber ist angewidert von der Dummheit der Autoren, die so selbstgewiss über Gott und den Glauben reden, als hätten sie ihn in der Tasche, als könne das man Unbegreifliche in Dogmen fassen und mit Absurditäten erklären. Er lässt seine Helden die christlichen Ideen sprichwörtlich umzusetzen versuchen und dabei scheitern. Die Differenz zwischen beiden ist dabei interessant. Pecuchet ist der mehr zur Frömmigkeit tendierende äußerliche Nachahmer, während Bouvard skeptisch bleibt, aber eine Neigung zu einem enthusiastischen Pantheismus hat. Er schätzt in den Symbolen das Poetische, in der Marienverehrung die Anbetung der Frau, in der Papstherrlichkeit die Selbstvergötterung, die er auch für seine Person sich vorstellen kann. Stets werden die Symbole und Sakramente an ihrem Anspruch gemessen, sie geben nicht her, was sie verheißen (etwa der Genuss des Abendmahls).
Man kann aber nicht sagen, dass Flaubert sie grundsätzlich verhöhnt. Ihre Anstrengungen, Sinn in der Religion zu erfahren, werden auch ernsthaft dargestellt. Das Eingeständnis der Differenz zwischen Verheißung und Erfüllung wäre also ein Weg, um mit dieser Enttäuschung umzugehen statt des üblichen „man muss dran glauben“. Andererseits hat auch Bouvard und Pecuchets hartnäckiger Versuch, Glaube und Vernunft/Wissenschaft zu versöhnen, etwas ebenso Verbohrtes wie die antimodernistische Haltung des Katholizismus in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Pfarrer Jeufroy ist die Beschränktheit in Person, er vertritt, was die Kirche lehrt, ist ein hilfloser Apologet. Wenn er nicht weiter weiß, sagt er stets: „das ist ein Mysterium.“ Aber das Mysterium des Glaubens selber vermag er nicht zu erfassen, weil er eben die Dogmen unkritisch verteidigt. Ein später Reflex auf diesen Pfarrer ist Pierre Bourdieus Essay „Das Lachen der Bischöfe“. Immer wenn er mit Geistlichen diskutiert und sie fragt nach ihrer Einstellung zum Geld, zur Liebe, lächeln sie und sagen dann den Satz: „Bei uns ist das ganz anders.“ Was aber das andere ist, das können sie eigentlich nicht sagen. Ihr Lächeln ist das unbewusste Eingeständnis dieser Verlegenheit. Das hilflose Lächeln der Priester hat bis heute nicht aufgehört.[10]
Kurz vor seinem Tod hat Flaubert Maupassants Novelle Boule des Suif gelesen und sie als Meisterwerk gelobt. Hier wird erzählerisch die Realisation eines unabgegoltenen christlichen Glaubensinhalts eingelöst – das Abendmahl zwischen Verschiedenen in der Postkutsche, gestiftet von einer Prostituierten. Dieser Weg narrativer Realisation scheint mir verheißungsvoll.[11]
Anmerkungen
[1] Barnes, Julian (1987): Flauberts Papagei. 1. - 6. Tsd. Zürich: Haffmans.
[2] Flaubert, Gustave (1982): Drei Erzählungen. Trois contes. Frankfurt am Main: Insel
[3] Zit in: Cora von Kleffens/Andre Stoll, Erläuterungen; in: Flaubert, Gustave (1982): Drei Erzählungen. Trois contes. Frankfurt am Main: Insel, S. 297
[6] Von Kleffens/Stoll, 303
[7] zit. bei Borges, Verteidigung des Romans in: Flaubert, Bouvard und Pecuchet, Zürich 1979, 425
[8] Fagues zit. bei Borges, 425
[9] zit. Raymond Queneau in: Bouvard und Pecuchet, 391f
[10] Bourdieu, Pierre (2004): Das Lachen der Bischöfe. In: Pierre Bourdieu und Hella Beister: Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 186ff.
[11] Ich plane eine Fortsetzung dieses Artikels mit Maupassants Erzählungen, und zwar: Fettklösschen oder das Abendmahl in der Postkutsche, Jüngstes Gericht am Beispiel von Die Kleine Roque. „Wegen Erstkommunion geschlossen“. Hurenfrömmigkeit in Das Haus Tellier.
|

