
Religion und Politik |
Karlsruhe ist nicht MiamiWolfgang Vögele In seinem gerade erschienenen Roman „Back to Blood“ erzählt der mittlerweile zweiundachtzigjährige amerikanische Autor Tom Wolfe nicht nur die Geschichte des kubanisch-stämmigen Polizisten Nestor Camacho. Camacho ist ein freundlicher Bodybuilder, der zuerst einen kubanischen Flüchtling von der Mastspitze einer Segelyacht rettet, dann mit einem Kollegen spektakulär mehrere schwarze Drogendealer in einem crack house verhaftet und schließlich einem osteuropäischen Ring von Kunstfälschern auf die Schliche kommt.
Tom Wolfe lässt mit einem hinterhältigen Lächeln den Kapitalismus siegen. Bei der Art Basel-Miami Beach wird es sein wie beim olympischen Basketball-Finale: Der amerikanische Milliardär gewinnt gegen den exilierten russischen Oligarchen. Art Advisors müssen sich nicht lange damit aufhalten, die interessanten Stände und Galerien herauszusuchen. Ihnen reicht es, auf der Liste der teilnehmenden Künstler drei oder vier Kreuze malen. Sie weiß, was gerade angesagt ist. Sobald sich die Eingangstore öffnen, verwandelt sich das Gedränge der Schlange mit Kunstinteressierten in einen gnadenlosen und kurzatmigen Wettlauf der Milliardäre zu den besten, vielversprechendsten Galerien. Kriterium des Kaufs ist nicht die Ästhetik, sondern die Gewinnsteigerung. Namen und Signaturen bestimmen über den Geldbeutel. Der Blick auf Bilder und Skulpturen bleibt flüchtig. Es macht dem stets in einen weißen Anzug gekleideten Tom Wolfe spürbar große Freude, seinen Lesern mit Hilfe des weiblichen Art Advisors mitzuteilen, wie hippe und teure Kunst heute entsteht, nämlich „no hands“, ohne Pinsel, Meißel, Palette, ohne dass der Künstler je mit dem Kunstwerk in Berührung gekommen ist. Das ist das am meisten zeitgenössische Kunstkonzept. Verloren gegangen ist der Künstler als Urheber, Schöpfer, Macher. Außer der Idee trägt der Künstler nichts zum Werk bei. In jedem Fall muß es die eigene eingescannte Unterschrift tragen. Das ist Wolfes ironische und paradoxe Pointe des Kreativen: Der Schöpfer hat sein Werk nie in der Hand gehalten, und dennoch trägt es seine Handschrift. Und beim Verkauf streicht er den Gewinn ein. So entsteht in den begeistert gelangweilten Worten der schrill gekleideten Kunstberaterin ein Kreis- und Leerlauf von Kunst, in dessen wahnwitzigen Drehungen weder Bedeutungen, handwerkliche Fertigkeiten noch Stil eine Rolle spielen. Es entsteht ein kreativer Geldkreislauf, in dem die Grenze zwischen Fälschung und Original mehr oder weniger transparent wird. Im grellen Licht von Übertreibung und Ironie, auch im Licht der subtropischen Sonne Miamis erscheint die Kunstwelt als überdrehter Zirkus, bei dem niemand mehr die ineinander verhakten Bühnen von Geld, Klatsch und Kunstwerken richtig unterscheiden kann. Im gleißenden Mittagslicht wirft die Kunstwelt harte Schlagschatten, über die sich Wolfe nach allen literarischen Kräften lustig macht.
In Karlsruhe fehlt die brennende südländische Sonne, stattdessen weht früh im März noch ein empfindlich kühler Wind, der eher an die Ästhetik des Eiskunstlaufs denken lässt und den Geschmack von Schneeflocken in sich trägt. Die Kunstwerke fangen nicht bei einer Million Euro an, das Ganze bleibt überschaubar und, trotz einer Rekordbesucherzahl von über 50 000, weitgehend frei von Gedränge. Kunstmessen haben ja stets etwas Unübersichtliches und Maßloses. Wer ohne viel Geld, aber mit eigenen Gedanken und nicht ohne Blick für die Zusammenhänge von Kunst und Religion durch die Gänge läuft, kann sich ein buntes Bild vom gegenwärtigen Zustand der Kunst zusammensetzen, auch wenn sich in Karlsruhe eher das, was verkäuflich, als das, was avanciert ist, findet. Das Karlsruher Kunstdorf kommt nicht ohne Kirche aus, und diese steht mitten in Messehalle Vier: Der Offenburger „Heimat“-Künstler Stefan Strumbel hat eine nach hinten offene Kapelle gebaut, eine Heimat-Kapelle, mit originalen langen Kirchenbänken aus dunklem Holz – Sitzgelegenheiten, die Einzelbesucher und geführte Gruppen gerne annehmen, um dann nach vorne zu schauen und zwischen zwei buntfarbigen Glasfenstern einen Altar zu sehen, auf dem in greller Leuchtschrift das Wort „Heimat“ prangt. Daneben steht eine Messdienerin im uniformierten Hosenanzug der Karlsruher Messe und verkauft „Liebe, Glaube, Hoffnung“, das heißt ein Skizzenbuch, das wie eine Bibel aufgemacht ist, eine bemalte Kerze und ein Kruzifix mit einem kecken roten Dach wie bei einem Schwarzwaldbauernhof. Im Zentrum der Kreuzesbalken ist ein zweites Mal „Heimat“ zu lesen. Strumbel hat Erfahrung mit Kirchen, er hat ja schon die Kapelle in Kehl-Goldscheuer gestaltet. Seine Ästhetik lebt vom Grellen, vom Übertriebenen, vom Auffälligen. Er nimmt den normalen Heimatkitsch wie Bollenhut und Schwarzwalddach und dreht die Schraube noch eine ästhetische Umdrehung weiter. Bei Strumbel geht die Kunst eine merkwürdige Allianz mit dem Christentum ein. Wer den Kitsch so gnadenlos übertreibt dieser Künstler, der führt zum einen den Kitsch und die Kunst-Religion ad absurdum. Zum anderen stellt er aber auch rigoros – ein letztes Mal? – die Frage nach dem Glauben. Denn was da als Kapelle so grell und schrill in die Mitte gerückt wird, das kann nicht ohne Sinn und Bedeutung sein. Wenn die Besucher Altäre, Kapellen, Gesangbücher und Kirchenbänke bei einer Kunstmesse dulden, welchen Gebrauch machen sie davon? Strumbels Methode ist einfach: Er lässt kein Mittel aus, um das selbstverständlich und langweilig gewordene symbolische Reservoir der Liturgie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken: Farben aus den Töpfen der Werbung, Formen von Bollenhüten über Schwarzwaldtrachten bis zu Totenköpfen und Kreuzen. Man kann die Kapelle Unserer Lieben Frau von der Heimatkunst witzig finden, aber damit wird man dem Künstler nicht ganz gerecht. Er verfügt über ein Instrumentarium der Beleuchtung des Gewöhnlichen, das den an Museen, Ausstellungen und Kunstbänden geschulten Gewohnheiten des Betrachters, der sowieso nur auf das Außergewöhnliche, Schrille und Grelle reagiert, etwas nachhaltig Widerständiges entgegenzusetzen weiß. Wer, nach der kleinen Andacht in Strumbels Kapelle ermutigt, weiter nach Kunst sucht, die sich mit dem religiösen Themen beschäftigt, der findet den Widerpart der offenen und einladenden Schwarzwaldkapelle in Giacomo Manzùs (1908-1991) überlebensgroßer Statue „Grande Cardinale in Piedi“. Eingehüllt in seinen weiten Mantel präsentiert sich der Kardinal verschlossen, in sich gekehrt, so als ob er gerade aus dem Konklave zurückgekehrt sei, nicht sicher, ob er auch dem richtigen Kandidaten für die Papstwahl die Stimme gegeben hat. Alles an der Kardinalsfigur weist nach oben, nicht auf den Kopf, sondern auf den spitz zulaufenden Hut - und darüber hinaus in den Himmel. Ein Mensch, der zur Form, zum Dreieck geworden ist, Teil der Welt, aber doch auch der Welt entrückt, der sich auf einem geistlichen Weg befindet, eine Richtung, in der ihm nicht jeder zu folgen vermag. Ist das katholische Kunst – jenseits von Kurienskandal und Missbrauchsvorwürfen? Der Kardinal steht weniger für die Amtskirche als für den Menschen, der nach Gotteserfahrung sucht und sich dabei und dafür von allem Entertainment und aller Zerstreuung entfernt hat. Diese unbedingte Ernsthaftigkeit jenseits der ängstlichen, auf vorschnellen Erfolg ausgerichteten klerikalen Anpassungsleistungen an das Säkulare macht ihn attraktiv. Das würde sich vor jedem Ordinariat und vor jedem Konsistorium als Verpflichtung zu ernsthaftem Glauben sehr gut ausmachen. Aber auch auf der Kunstmesse wirft der Kardinal einen strengen Blick auf das Gewimmel der Besucher und auf den Wirrwarr der Galerienstände. Oder ignoriert er sie doch? Wer nun meint, Religion sei ein wichtiges Gegenwartsthema der Kunst, der täuscht sich. Grundsätzlich ist es schwer, auf solch einer Messe Tendenzen, Richtungen, Suchbewegungen auszumachen. Wenn mir etwas auffällt, dann sind es die vielen bemalten Holzskulpturen, die für den in sich gekehrten Kardinal Manzùs eine auffällige Eskorte bilden. Am meisten überzeugen die lebensgroßen, realistischen Figuren des Südtirolers Aaron Demetz. Mit dem Kardinal haben sie die Verschlossenheit und den Ernst, den ins Leere gehenden Gesichtsausdruck gemeinsam, auch wenn dahinter bei Demetz nicht unbedingt ein religiöses Motiv stehen muss. Demetz zeigt zum einen lebensgetreue Abbildungen von Menschen, zum anderen aber erscheinen diese Menschen durch die Natur des Materials bearbeitet, verformt, verändert. Einige der Holzplastiken sind in Harz getaucht, andere in verkohltem Holz gearbeitet. An der nächsten Skulptur ist der nackte Rücken über und über mit aufgehobelter Holzwolle besetzt. Bei einer Figur sitzt an der Stelle des Kopfes eine Art Koralle, vielleicht ein wuchernder Pilz oder eine Flechte. Trotz aller Kunstgespräche in den Galeriekojen drumherum erzeugen Demetz‘ rätselhafte Figuren an dem Platz, an dem sie stehen, eine Aura der Stille, des Verweilens. Mit ihrem verklärten Blick schaffen sie es, den Betrachter in ihre eigene Welt hineinzuzuziehen, an einen utopischen Ort in der Zukunft, in dem die Natur sich wieder zurücknimmt, was der Mensch davor genommen hat. Diese Verbindung einer ganz eigenen Schönheit mit einem Geheimnis, das sich von Oberflächlichkeit und Täuschung befreit hat, gibt den einzelnen Figuren wie dem Ensemble etwas Magisches und Einnehmendes, Schwebendes, das aber eben nicht mit Rausch und Eskapismus, sondern mit Reflexion und Meditation zu tun hat. Demetz stellt die Fragen nach dem Wesen des Menschen in einer feindlich-freundlichen Natur, und er dringt dabei tiefer als andere. Daneben wären andere zu nennen, die mit Figuren aus Holz, bemalt oder unbemalt, beeindrucken können: Evelyn Weinzierls weiß und blau bemalte Frauengestalten, Jan Thomas‘ vielköpfige Holzmonster. Dazu kommen Silvia Siemes‘ Frauenfiguren aus Keramik und Volker März‘ bemalte Brustporträts mit auf den Kopf gesetzten kleinen Figuren. Siemes‘ wie Weinzierls Arbeiten überzeugen durch eine Mischung aus Einfachheit und Konzentration. Man könnte diese Figuren, die oft allein und für sich selbst stehen, als einsame Menschen missdeuten. Stattdessen aber stehen sie für sich selbst, sie haben eine Qualität der Gelassenheit gewonnen, an denen viele der Kunstmessenpassanten zu Unrecht achtlos vorübergehen. Gerade weil sie so gelassen sind, halten sie jeder Kunstbetrachtung stand. Man kann ja über das philosophische Konzept der Subjektivität, über den Untergang des Individuums so viel reden wie man will, die alte anthropologische Frage nach dem, was einen Menschen bleibend ausmacht, ist nicht totzukriegen. Künstlerisch stellt sich diese Frage als Frage nach dem Gesicht, nach dem Porträt, nach der Gestalt eines Menschen. Das erklärt auch die anhaltende Faszination für skulpturale Darstellungen des Menschen in der Kunst. Neben unbekannteren Künstlern sind auch bekannte Galerien und bekannte Maler vertreten, zum Beispiel der Leipziger Papstmaler Michael Triegel, der von der Leipziger Galerie Schwind vertreten wird. Von ihm ist ein groß- und hochformatiges Bild mit dem Titel „Wahrheit“ ausgestellt. Es zeigt eine nackte junge Frau in der Dunkelheit. Sie scheint dem Betrachter entgegenzugehen. In der rechten Hand hält sie ein Licht, kleine Flämmchen, die auf ihrer Handfläche tanzen. Vor ihr steht ein nervöser, unruhiger Windhund, der an diesen Flämmchen schnüffeln will. Triegel, dem ein katholischer Realismus zum Vorwurf gemacht wird, gehört sicherlich nicht zu den Künstlern, die ihrem Assistenten die eigenen Ideen diktieren und es damit gut sein lassen. Wie er malt, nimmt farblich, formal und gestalterisch die besten Traditionen der Renaissance-Malerei wieder auf und stellt sie neu zur Debatte. Die philosophischen Fragen, die er damit aufwirft, sind im besten Sinne alt-europäisch. Die Wahrheit ist plötzlich wieder das „Ewig-Weibliche“ (Goethe, Faust II), das die, die nach der Wahrheit suchen, hinauf-, hinunter- oder hinauszieht. Neulich musste ich mir in einer Podiumsdiskussion vorhalten lassen, die Wahrheit sei nur deshalb weiblich, weil das ihr grammatisches Genus sei. Triegel liefert den anschaulichen Beweis, dass da "alteuropäisch" doch mehr dahintersteckt. Gleichzeitig ist die Wahrheit nur ein Flämmchen, das physiologisch keine Frau lange in der Hand halten kann. Das Flämmchen braucht Nahrung, um zum Feuer, zu Licht und Aufklärung zu werden. Wem die – malerische wie philosophische – Tradition fremd geworden ist, der muss sie neu entdecken. Und Triegel macht sich zum piktorialen Diener dieser Ideen. Der zu einfach gestrickte Vorwurf des Neo-Konservatismus ist Teil desjenigen Klischees, von dem der Maler sich zu Recht absetzen will. Die bisher genannten Künstler haben ihre Arbeiten jenseits von Aktualität, Mode und Entertainment angesiedelt, jenseits eines mainstreams, der in seiner beständigen Wiederholung und Gleichförmigkeit ermüdet. Das gilt nicht für H.A.Schult und dessen weit gereiste trash people. Wie die Grabmals-Armee der chinesischen Terrakotta-Krieger in der Nähe von Xi’an sind sie aufgestellt, jede einzelne aus einer anderen Müllsorte produziert. Nun sind sie in Angriffsformation auf großformatigen Fotos vor dem Matterhorn und den Sehenswürdigkeiten der Welt zu erblicken – und am letzten Wochenende in leibhaftiger Gestalt in einer der Karlsruher Messehallen. Der aus Cola-Dosen gepresste Müllmensch mit seinen unförmigen Armen und seinen säulenförmigen Beinen ist aus den achtlos weggeworfenen Überresten geschaffen, die der Mensch zurücklässt. Dem eignet – in aller Vorsicht – ein Moment konventioneller Kulturkritik (mit einem gerüttelten Maß an grün-bürgerlicher Korrektheit). Auf der anderen Seite ist Schult ein Hofnarr der Konsumgesellschaft, der virtuos mit dem Medium des happenings und der Kunstaktion zu spielen weiß, auch wenn die große Zeit dieser Kunstrichtung vorüber scheint. In Karlsruhe saß er persönlich und gelangweilt neben seiner Müllarmee. Vielleicht war zu wenig los für ihn. Not enough action. Vielleicht hätte man Schults Müllmänner neben die vielen Pappelholz-Damen im Ballkleid oder im Badeanzug stellen sollen. Ich bin überzeugt, es wäre eine spannungsvolle Beziehung entstanden. An einer Rückwand im Außenbereich eines Galeriestands entdeckte ich dann eher zufällig ein großformatiges Bild von Jonathan Meese, wild, unbekümmert und chaotisch, mit einer Reihe von Merksätzen und Sprechblasen. Einer davon lautete: „Religiöse Menschen sind leider eine Beleidigung des Tierreiches.“ Tiere haben ja bekanntlich keine Religion, aber, misstrauisch geworden, scheint mir der Verdacht nicht auszuräumen, der Satz sei auf dem sehr schmalen Grat formuliert, wo zwischen Sinn, Bedeutung, Quatsch und Tiefgang gar nicht mehr richtig zu unterscheiden ist. Völlig quer zu den hier in den Vordergrund gerückten Darstellungen von Menschen, Köpfen und Gesichtern stehen die malerischen Farbkompositionen Hanspeter Münchs, dessen großformatige manchmal abstrakte, manchmal an Blumen erinnernde Bilder ganz auf die Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Wirklichkeit verzichten und statt dessen neue Seh-Welten erschließen, die in immer neuen Wendungen das dem Auge zugängliche Farbspektrum variieren. Es ist ein kirchlicher und künstlerischer Skandal, dass Münchs sehr gelungene Paramente für die Karlsruher Christuskirche immer noch nicht auf deren Altar liegen. Das Niveau der zu ihrer Ablehnung aufgebrachten Argumente liegt in der Nähe derjenigen Stammtische, mit denen Altäre keinesfalls verwechselt werden sollten. Wer sich darüber beschwert, dass ein rotes Parament nicht rot genug und ein weißes nicht weiß genug ist, der muss sich fragen lassen, ob er von wirklich von der „bunten Gnade Gottes“ (1Petr 4) das verstanden hat, was man darüber in farblicher Hinsicht sagen kann. Hier wird plötzlich eine Kunstform zur Provokation gemacht, die nie eine solche sein wollte. Provokation und Irritationen lösen auch die Porträts von Elena Steiner aus. Die dargestellten Personen treten gleichsam aus der Leinwand heraus in die dritte Dimension, weil sie reale Plastikpuppen in den Händen halten oder weil in ihrem Oberkörper eine Fülle von kleinen roten Nadeln stecken. Die Malerei kommt dem Betrachter realistisch entgegen, das klassische, flache Bild löst sich auf, bleibt aber dennoch einer Ästhetik verhaftet, die an mittelalterliche Heiligendarstellungen erinnert. Der profane Mensch hat den Heiligenschein abgestreift, aber in seiner Darstellung leuchtet noch etwas von dem auf, was im gemalten Heiligen einmal verehrt wurde. Steiner irritiert den Betrachter durch den Doppelcharakter ihrer Bilder: Zum realistischen, beinahe fotografischen Gehalt des Porträts kommt etwas Surreales, Auffälliges, Schrilles hinzu, das sich nicht innerhalb der Alltagswahrnehmung verrechnen lässt. Die Porträtierten auf den Bildern treten im wahren Sinne des Wortes aus diesen heraus, sie kommen den Betrachtern bedrohlich entgegen. Nach all den Kardinälen, Puppen, vielköpfigen Monstern und wahrheitssuchenden Frauen, auch nach dem Mao, dessen gemalter Kopf aus der Halskrause eines nordelbischen Pastors ragt, sind die Sehnerven beinahe schon ermüdet. Da entdecke ich noch bei der Straßburger Galerie Ritsch-Fisch die Arbeiten des französischen Künstlers Hervé Bohnert. Eine der kleineren Arbeiten trägt den Titel „Christ en Croix“. Zu sehen ist ein Skelett mit Totenkopf, mit ausgestreckten Armen und gebeugten Knien, in der typischen Haltung des Gekreuzigten. So als ob die Menschen vergessen hätten, ihn vom Kreuz abzunehmen. Vom Körper des leidenden Christus bleibt das Skelett, auch wenn sein geistlicher Leib längst auferstanden ist. Der Totenkopf rückt Tod und Sterben in sehr viel größere Nähe zum Kreuz als das sonst üblich ist. Man kann dem ein Element von Ironie entnehmen, das ist aber nicht notwendig. Die Figur des Kruzifixus ist nicht besonders, kaum mehr als ein Handteller. Der Totenschädel ist und bleibt ein Faszinosum, wie kürzlich eine große Ausstellung im Mannheimer Reiß-Engelhorn-Museum zeigte. Hingerichtete Leichname wurden im Mittelalter zur Abschreckung ausgestellt, bis von Fleisch und Knochen nichts mehr übrig war. Der Gekreuzigte hat sich in Gedächtnis und Kultur eingeprägt. Man hat ihn so oft gesehen, daß man dazu neigt, ihn zu übersehen. Irgendwann ist der Hingerichtete ein Skelett, der Bruder des Sensenmanns, der Gevatter Tod, der in den eigenen Alpträumen auftaucht und sich aus unseren utopischen Glücksvorstellungen trotz aller Bemühungen nicht herausradieren lässt. Das Skelett erinnert an den Tod und fragt nach der Zukunft der Auferstehung. Das Skelett ist die Abwesenheit Gottes im Menschen, und man könnte das alles als die ironische Spielerei eines Künstlers abtun, wenn nicht schon in der Bibel die Vorstellung des Skeletts mit der Vorstellung der Auferstehung der Totengebeine verknüpft wäre: „Des HERRN Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des HERRN und stellte mich mitten auf ein weites Feld; das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: HERR, mein Gott, du weißt es.“ (Hes 37,1-3) Das Skelett und der Totenkopf sind die Gegenwart der Abwesenheit Gottes. Sie verweisen auf die Vergangenheit des lebendigen und auf die Zukunft des auferstandenen Menschen. Wie diese Verwandlung geschieht, das bleibt ein Geheimnis. Bisher, so der entsetzte Prophet Hesekiel, weiß nur Gott darüber Bescheid. In Karlsruhe waren Kunstwerke zu sehen, die sich an diesem Geheimnis abarbeiteten. Wo man das sehen oder spüren konnte, lohnte sich eine längere Betrachtung. Und der Unterschied zur Art Basel Miami Beach? Der beschränkt sich auf das Klimatische, empfindlich kühler Winterwind gegen immerwährende subtropische Sonne. Und ja, es gibt keine auf Schwarzwald gestylten Kapellen. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/82/wv01.htm
|
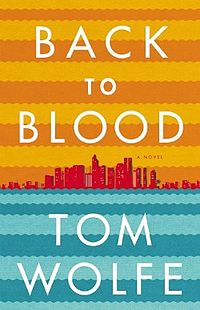 Nestors Ex-Freundin Magdalena, eine Krankenschwester, besucht die Kunstmesse Art Basel-Miami Beach, selbstverständlich nicht an einem der Ausstellungstage für das allgemeine Publikum, sondern bei einer Preview, die Galeristen, Kunstkritikern sowie reichen potenten Käufern aus den Villen und Landsitzen der Umgebung Miamis vorbehalten ist. Während Magdalena mit ihrem gegenwärtigen Lover, einem Psychiater, und dessen reichstem Patienten im Gedrängel der Warteschlange steht, hält eine junge Frau, der art advisor des Milliardärs einen Vortrag über Kunstmessen: Sie weiß die angesagten Namen, kennt die sich bekämpfenden Stilrichtungen, kann für jeden Künstler Preissteigerungen und die Gewinnmargen herunterrattern. Wer bei der Preview Kunst kaufen will, darf die Kaufentscheidung nicht lange abwägen. Denn hinter jedem reichen Käufer lauern weitere Käufer, die das Portemonnaie ohne Skrupel und Zaudern zücken.
Nestors Ex-Freundin Magdalena, eine Krankenschwester, besucht die Kunstmesse Art Basel-Miami Beach, selbstverständlich nicht an einem der Ausstellungstage für das allgemeine Publikum, sondern bei einer Preview, die Galeristen, Kunstkritikern sowie reichen potenten Käufern aus den Villen und Landsitzen der Umgebung Miamis vorbehalten ist. Während Magdalena mit ihrem gegenwärtigen Lover, einem Psychiater, und dessen reichstem Patienten im Gedrängel der Warteschlange steht, hält eine junge Frau, der art advisor des Milliardärs einen Vortrag über Kunstmessen: Sie weiß die angesagten Namen, kennt die sich bekämpfenden Stilrichtungen, kann für jeden Künstler Preissteigerungen und die Gewinnmargen herunterrattern. Wer bei der Preview Kunst kaufen will, darf die Kaufentscheidung nicht lange abwägen. Denn hinter jedem reichen Käufer lauern weitere Käufer, die das Portemonnaie ohne Skrupel und Zaudern zücken. Bei der ART Karlsruhe, die in diesem Jahr zum zehnten Mal auf dem Messegelände in Rheinstetten stattfand, ist das alles anders.
Bei der ART Karlsruhe, die in diesem Jahr zum zehnten Mal auf dem Messegelände in Rheinstetten stattfand, ist das alles anders.