
White Cube |
|
Notizen IEin BlogsurrogatAndreas Mertin Medienmetaphysik / 13. April 2013Als das Rijksmuseum in Amsterdam am 13. April wieder eröffnet wurde, äußerten sich natürlich auch alle Feuilletons in Deutschland zum spektakulären Ereignis, denn 10 Jahre lang war das Museum weitgehend geschlossen und wurde einer Restaurierung unterzogen. Und überraschenderweise waren die journalistischen Reaktionen fast alle religiös konnotiert (was auch daran liegen könnte, dass die Presseinformationen entsprechend gefärbt waren). Glaubt man dem Feuilleton, dann fand in Amsterdam nichts weniger als ein Krieg katholischer mit calvinistischer Ideologie statt, mit triumphalem Ausgang für die katholische Anschauung.
So schrieb der Rezensent der ja auch sonst gerne katholisierenden FAZ, seine Sicht der Geschichte des Museums zusammenfassend folgendes:
Nun aber haben die Restauratoren ihr Handwerk erledigt:
Alles also eine Frage der Religion? Bildfroh opulent (= katholisch) versus grau reduziert (= calvinistisch)? So einfach kann Geschichte sein. Nun zeigt ein kurzer Blick in das Goldene Zeitalter der Niederlande, dass seinerzeit keinesfalls die Katholiken die meisten Bilder besaßen, sondern die ob ihrer Sinnenfeindlichkeit geschmähten Protestanten. Merkwürdig. Aber sie gingen mit Kunst vermutlich anders um, für sie waren Kunstwerke keine Kultbilder, sondern Teile des avancierten bürgerlichen Lebens. Nun aber wird Kunst wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer Eintrittskarte in die bessere Welt. Paul Andreas schrieb in der NZZ:
Ja, das war immer schon der Wunsch, der bürgerlichen Gesellschaft: Kunst, die kein Chaos stiftet (wie die griesgrämige Moderne), sondern der Anbetung dient. Ob das wirklich im 21. Jahrhundert gelingen kann, ohne in die alles vernichtende Eventkultur des 21. Jahrhunderts abzugleiten? Man darf es bezweifeln. Tim Ackermann schreibt in der WELT schon eher zutreffend:
Aber die Kunstreligion kann man herbeischreiben, an dieser Schraube kann man drehen, man kann die Kunstanbetung offensiv pflegen. Was das für die Ästhetik für Folgen hat, dokumentiert vorzüglich Nicola Kuhn in der ZEIT, die uns unter der Überschrift „In der Kathedrale des 21. Jahrhunderts“ postwendend mit Herzensergießungen einer kunstliebenden Klosterschülerin beglückt:
Da fragt man sich doch: Möchten wir das? Niederknien vor der Kunst? Ästhetik war einmal charakterisiert als Kombination von Sinnlichkeit und Reflexion, nicht als kultische Reaktion. Es war Georg Friedrich Wilhelm Hegel, der in den Vorlesungen zur Ästhetik den Ertrag der ästhetischen Debatten des 18. Jahrhunderts so zusammenfasste:
Bazon Brock erzählt wiederholt die Anekdote der alten Frau, deren Altarbild aus der Kirche ins Museum verbracht wurde und die daher nun das Museum aufsuchte, um vor „ihrem“ Altarbild weiter zu beten, was ihr prompt von der Museumsleitung (einer modern denkenden offenkundig) untersagt wurde. Heute, in postsäkularen Zeiten, ist derartiges Verhalten wieder erwünscht. Während man die Religion erfolgreich aus dem Leben verbannt hat, zelebriert man sie im Museum. Und findet es gut so. Ist ja auch viel weniger verbindlich. Der einzige, der lobenswerter Weise auf die religiöse Verklärung der Museumsinszenierung verzichtet, ist, ebenfalls in der WELT, Peter Dittmar:
Ja, es ist eben doch keine barocke Hängung, auf die wir stoßen, sondern eine Variation des White Cube – diesmal in Anthrazit -, dem Erbe reformierten Kirchenbaus. Dem nächsten Besuch in Amsterdam sehe ich nun mit Skepsis entgegen, der manipulativen Suggestion zur Kunstreligion möchte ich nicht erliegen. Aber da besteht für „Calvinisten“ sicher keine Gefahr. Kunstverachtung / 13. April 2013Es gibt Autoren, die machen es einem ob ihrer stupenden Borniertheit einfach. Sie tragen ihre Beschränktheit wie ein Wappen vor sich her: Schaut her, ich verachte alles, was ich nicht verstehe. Ein besonderes Exemplar dieser Gattung ist der selbsternannte italienische Kunst- und Kulturkritiker Francesco Colafemmina, der den Blog Fides et Forma betreibt (was der automatisierte Übersetzungsdienst von Google hoch ironisch mit „formatierter Glaube“ übersetzt). Dieser Autor tut einem schon fast leid, wenn er über alles herzieht, was in der Bildenden Kunst nach Giotto oder Piero della Francesca entstanden ist und nur den Hauch von Modernität zeigt. Vor allem ist er einer planen idealisierenden religiösen Abbildlichkeit verpflichtet, die es in der Kunst so seit gut 500 Jahren nicht mehr gibt. Mit der Kunst der Reichenauer Schule wäre er vermutlich am besten zufrieden gestellt. Erschüttert ist seine Welt nicht erst, seit ein neuer Papst allem Karneval in der Liturgie eine Absage erteilt hat, sondern auch schon, seit Benedikt XVI. sich erdreistete, nicht irgendwelche religiösen Kitschmaler, sondern Maler der Gegenwartskunst in die Sixtinische Kapelle zum Künstlerempfang einzuladen. Nun aber ist noch etwas viel Schrecklicheres passiert: Der Vatikan stellt auf der kommenden Biennale in Venedig Kunst in einem eigenen Pavillon aus und zwar nicht – wie erhofft - irgendwelchen kunsthandwerklichen Schrott a la Rodolfo Papa oder Retro-Kultur des Mittelalters, sondern Exponenten der Moderne und der zeitgenössischen Kunst. Das ist natürlich der blanke Horror! Der Vatikan und ein Bekenntnis zur Moderne! Waren das noch selige Zeiten, als Ende des 19. Jahrhunderts Katholiken die Teilnahme an der Biennale durch den damaligen Patriarchen Kardinal Sarto, dem späteren Papst Pius X. und Erfinder des Antimodernisten-Eides untersagt war! Davon kann man heute als Traditionalist nur träumen. Schon allein die Ankündigung der Teilnahme des Vatikans brachte die Traditionalisten zum entsetzten Aufschrei: „This is welcome news only to those who do not recognize the smell of sulphur.“ Ja, moderne Kunst ist immer noch mit Schwefel behaftet. Wär’s doch nur so. Der gute Kunstkritiker und Kulturpessimist Francesco Colafemmina hetzt jedenfalls gegen den „Leinwandstecher“ Lucio Fontana, dessen „Via Crucis“ der Vatikan ausstellen möchte und deshalb für zugegebenermaßen nicht wenig Geld (2 Millionen wenn die Angaben stimmen) angekauft hat. Aber, so dekretiert der wenig kenntnisreiche, in diesem Falle jedoch zudem begründungslose Colafemmina, es handele sich sowieso nur um „Werke von minderer Qualität“, die im Gegensatz „zum päpstlichen Lehramt des ganzen vergangenen Jahrhunderts stehen (vor allem was die Abstrakte Kunst betrifft).“ Nun sind gerade die Arbeiten von Lucio Fontana zur „Via Crucis“ aus den 40er- und 50er-Jahren nicht einmal annäherungsweise abstrakte Arbeiten. Das, was sich zu den verschiedenen Versionen des „Via Crucis“-Zyklus von Fontana recherchieren lässt, ist beeindruckend, aber keinesfalls revolutionär, was die christliche Ikonographie betrifft. Es ordnet sich nicht umstandslos in das vertraute Bild seiner Werke ein (auch wenn es in dieser Zeit entstanden ist), ist aber eine interessante Auseinandersetzung mit dem Material und dem Sujet. Offenkundig gibt es drei unterschiedliche Formen. Ein Keramikzyklus aus dem Jahr 1947, sowie ein weißer und ein rosa-Zyklus. Lucio Fontana gehört sicher zu den bedeutenden Künstlern des 20. Jahrhunderts, der auf die Entwicklung der Moderne reagierte, indem er der Abstraktion eine neue Dimension eröffnete. Bis heute wird er zu den wichtigsten 100 Künstlern seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gezählt. 1930, also vor mehr als 80 Jahren(!), beteiligte er sich erstmals an der Biennale in Venedig. Wer die Moderne verstehen will, muss sicher den Arbeiten von Fontana nachgehen. Wer aber antimodernistisch ist, bekommt die Krätze. Da ist es nur gut, dass Colafemmina nicht noch auf Fontanas Serie „Fine di Dio“ (Das Ende Gottes) gestoßen ist. [UPDATE 23.05.2013: Nach den neuesten Ankündigungen gehören die Arbeiten von Fontana nicht zu den Werken, die der Vatikan bei der Biennale ausstellt. Da hat sich der traditionalistische Vatikanist wohl geirrt.] Zu den anderen Künstler, die der Vatikan ausstellt, gehört der 1954 geborene US-Amerikaner Lawrence Carroll, von dem Colafemmina auf seinem Blog drei Arbeiten zeigt, die aber nur begrenzt aussagekräftig für dessen Gesamtwerk sind. Caroll gehört sicher zu den bedeutenden Künstlern der heutigen Kunstszene. Er nahm 1989 an der von Harald Szeemann kuratierten Ausstellung Einleuchten in den Hamburger Deichtorhallen teil, war 1992 Teilnehmer der documenta IX unter Jan Hoet, hat 2002 in der Karmeliterkirche in München ausgestellt, und ist seitdem in so jeder nur denkbaren bedeutenden Kunstinstitution mit seinen Werken vertreten. Wenn man das Betriebssystem Kunst auch nur annähernd ernstnimmt, handelt es sich also um eine gute Wahl. Konservative Katholiken sehen das anders. Das sei kein „Ausdruck katholischem Kunst- und Schönheitsempfindens“. Ich wusste nicht einmal, dass es das gibt. Ob es wohl auch ein jüdisches, evangelisches, muslimisches, buddhistisches, hinduistisches oder atheistisches Kunst- und Schönheitsempfinden gibt? Wenn es das aber gäbe, dann machten „Gespräche vor Gemälden“ mit Katholiken künftig keinen Sinn mehr, denn dann müsste man sich erst der Konfession bzw. Religion des Gegenübers versichern, bevor man ihm ansinnt, dem geäußerten Geschmacksurteil zuzustimmen. Aber mit Immanuel Kant hat sich die katholische Tradition noch nie verstanden. Bene esse / 14. April 2013Während der Arbeit an dem zentralen Text für diese Magazinausgabe stieß ich auch auf ein Zitat des Befreiungstheologen E. Dussel, das Matthias Zeindler in einer Anmerkung seiner Studie über Gott und das Schöne (Zeindler, Matthias: Gott und das Schöne. Studien zur Theologie der Schönheit. Göttingen 1993) erwähnt. Dort schreibt er:
Ich habe das gelesen in einer Zeit, in der auch der neu gewählte Papst in Rom demonstrativ auf luxuriöse Ausstattungsgegenstände verzichtete und dazu aufforderte, zu den Armen und Ausgestoßenen zu gehen. Und tatsächlich scheint das ja zumindest auf den ersten Blick auch fast alle Argumente für sich zu haben. Seit den mittelalterlichen Reformbewegungen in der Kirche steht das Ästhetische immer unter einem ethischen Vorbehalt, um nicht zu sagen: unter einem Generalverdacht. Aber mich beschleicht immer ein Unwohlsein, wenn im Konfliktfall ganz in der Tradition Kierkegaards die Ethik gegen die Ästhetik ausgespielt wird. Und das hat zwei Gründe. Erstens: Als junger Mann ist mir diese fragwürdige Kontrastierung einmal sehr eindrücklich geworden. Ich war im Frühjahr 1982 auf einer Reise durch Israel und erhielt dort eine Einladung zu einer Ausstellungseröffnung in Yad Vashem. Und als ich dort ankam, traf ich auf eine Gruppe Überlebender des Konzentrationslagers Theresienstadt, die ihre Kunstwerke und die ihrer dort ermordeten Leidensgenossen ausstellten. Und diese Überlebenden erzählten, wie sie noch den letzten Bissen Brot, der ihnen das Überleben hätte sichern können, gegen Materialien zum Malen, zum Schreiben, zum Komponieren etc. getauscht hätten. Die Kunst war ihnen selbst in dieser extremen Situation wichtiger als das nackte Überleben. Ich bin in meinem späteren Leben vielen Menschen begegnet, die an entscheidenden Stellen saßen und die mir versicherten, selbstverständlich sei die Kunst wichtig, aber im Augenblick gäbe es nicht genug Geld, soziale Probleme usw. und deshalb könne man nichts für die Kunst ausgeben. Dann habe ich immer an diese Gruppe der Überlebenden von Theresienstadt gedacht, die in einer viel zugespitzteren, ja existentiell aussichtslosen Situation auf die Kunst gesetzt haben und Kunst geschaffen haben, weil sie überzeugt waren, dass angesichts von Tod und Elend Kunst Sinn macht und über die begrenzten Lebensumstände hinaus wirksam ist. Mir wurde in Yad Vashem klar, was es heißt, To be an artist in the shadow of death. (Yad Vashem – Martyr’s and Heroes’ Remembrance authority Art Museum, Testimony – Art of the Holocaust. 1982) Und es steht niemandem zu, der nicht in einer vergleichbaren Situation ist, Ethik gegen Ästhetik, das Über-Leben gegen die Kunst auszuspielen. Es geht in der Ethik-Ästhetik-Frage nicht immer um die Luxusgegenstände der Kirche, auf die sicher verzichtet werden kann, sondern es geht elementar um die Frage: wozu leben wir? Und für die Beantwortung dieser Frage ist die Kunst, ist das „bene“ im bene esse unverzichtbar. Zweitens: Bei Henning Luther habe ich einige Jahre später gelernt, dass ethische Fragen immer ästhetisch grundiert sind, ja dass „Verantwortlichkeit allererst aus einer ästhetischen Einstellung hervorgehen kann“, denn „ästhetische Erfahrung, insbesondere die an Objekten der modernen Kunst geschulte Wahrnehmung, kann zu jener Wahrnehmung des Anderen anleiten die nach Levinas den Anderen als Anderen gelten lässt und die die egoistische Selbstbehauptung verlässt, um sich dem Anruf des Anderen zu öffnen. Insofern habe ich pointiert von der Geburt der Ethik aus der Ästhetik gesprochen. Darüber hinaus wohnt m.E. dem ästhetischen Blick bereits implizit eine ethische Dimension inne, insofern er wesentlich den Verzicht auf egoistische Vereinnahmung des Anderen bedeutet, der immer schon ein Stück Gewalt innewohnt.“ (Luther, Henning: Subjektwerdung zwischen Schwere und Leichtigkeit - (auch) eine ästhetische Aufgabe? In: Dietrich Neuhaus und Andreas Mertin (Hg.): Wie in einem Spiegel. Begegnungen von Kunst, Religion, Theologie und Ästhetik, Frankfurt 1999, S. 39 und 50). Daran werde ich mich auch weiterhin orientieren. Kurswechsel / 17. April 2013Als Protestant beobachtet man das aktuelle Geschehen in der katholischen Kirche ja mit einen gewissen Interesse. Vieles, was man da beobachtet, bedarf vermutlich einer intimen Kenntnis der Binnenstrukturen des Katholizismus: wofür welche Orden und welche Bischöfe stehen, was essentiell katholisch ist und was bei den liturgischen Vollzügen eher zu den Adiaphora gehört. Nach und nach festigt sich ein Bild und man meint, etwas Einsicht zu gewinnen. Offensichtlich gibt es eine kleinere Gruppe, die sich romtreu nennt, „wahre“ Katholiken, Verfechter der ursprünglichen Lehre und der Tradition. Und es gibt andere, die sich stärker auf das II. Vatikanum berufen und mehr Eigenständigkeit der örtlichen Diözesen vertreten und manchmal auch eigenwillig oder zumindest kollegial (ich wusste bis dato gar nicht, dass das ein Vorwurf sein kann) gegenüber Rom auftreten. Das erste, was mir aufgefallen ist, mit welch harten Bandagen dabei gekämpft wird. Unter einem Häresie-Verdacht geht gar nichts. Man streitet schließlich um Wahrheit. Wenn jemand sich kritisch zur offiziellen römischen Lehre äußert, dann ist er gleich schon des Teufels verdächtig. Der alte Spruch „dann geh doch rüber ...“ feiert im Katholizismus offenkundig in der Form des „dann werde doch evangelisch ...“ fröhliche Urständ. Und evangelisch meint dabei, oberflächlich, zeitgeistorientiert, sexuell verwahrlost. Selbst renommierte katholische Philosophen können auf derlei ausgrenzende Sprüche nicht verzichten, obwohl sie doch nur aussagen, dass man eventuelle Differenzen im eigenen Lager nicht ertragen kann und mag. Manchmal hat man das Gefühl, das Ganze habe sehr wenig mit Religion und Christentum, und umso mehr mit politischer Einstellung zu tun. Die Übereinstimmung traditionalistischer katholischer Kreise mit den diversen Pro-Bewegungen oder dem PI-Blog ist jedenfalls sehr auffällig. Es ist, als ob sich ein rechtsextremer Wolf mit einem katholischen Schafspelz tarnte. Eines war aber bis vor kurzem immer deutlich: das Rechts-Links-Schema basierte auf der Entgegensetzung romtreu versus romkritisch. Und dann innerhalb von nur einem Tag der Umschlag ins pure Gegenteil. Kaum hatte der neue Papst seine ersten Gesten gemacht bzw. unterlassen, schlug die Stimmung auf den traditionalistischen Blogs ins Gegenteil um. Wo man vorher andere wegen ihrer mangelnden Rom-Treue angegangen war, übte man sich nun im Papst-Bashing. Als Protestant ist man ja kritische Worte gegenüber kirchlichen Hierarchien gewohnt, aber was man jetzt auf manchen Seiten zu lesen bekam, verschlug einem doch die Sprache. Am Anfang war es vielleicht nur Irritation, dass jemand sein Missbehagen gegenüber allzu barocken Auswüchsen der kurialen Inszenierung offen Ausdruck verlieh, aber dann waren alle Schranken plötzlich gefallen. Nach der Fußwaschung am Gründonnerstag meinte mancher Hobby-Traditionalist, den Papst über Liturgie und das wahre Verhalten Jesu gegenüber Frauen und Muslimen (und Frauen, die Muslima sind) aufklären zu müssen. Und als Papst Franziskus sich dann in seinen Äußerungen zum Konzilsjubiläum expressiv verbis von den Traditionalisten abwandte (Zitat: „Mehr noch: es gibt Stimmen, die rückwärts gehen wollen. Das heißt es, halsstarrig zu sein, das heißt es, den Heiligen Geist zu zähmen, das heißt es, töricht und langsamen Herzens zu werden“), da waren alle Dämme gebrochen: „Es hat in der jüngsten Kirchengeschichte wohl noch keinen Papst gegeben, der scheinbar so munter aus dem Bauch heraus und damit höchst missverständlich und leichtfertig daherblubbert wie dieser Mann.“ Die Endzeit schien gekommen, einige sahen den Satan am Werk. Nun gehören zu den Traditionalisten gewisslich keine intellektuellen Menschen, es sind Fundamentalisten, Vertreter einer geschlossenen Gesellschaft, die alles ausschalten wollen, was anders ist als sie. Der Verdacht freilich, die schlimmsten unter ihnen seien wahrscheinlich Konvertiten, ist vom gleichen Niveau wie das „Geh doch rüber ...“. Nein, der Katholizismus hat ein Problem mit seinem Rand. Und man hat viel zu lange Krawallkatholiken wie Matussek, Theo-Ästhetizisten wie Mosebach, Hofberichterstatter wie Badde oder Kulturpessimisten wie Spaemann den Eindruck erwecken lassen, sie wären Vertreter des heutigen Katholizismus. Aber es ist nicht zufällig so, dass alle Genannten sich als Anti-Protestanten profilierten statt katholischen Glauben zu akzentuieren. Es ist, als wenn es die katholische Aufklärung der letzten 50 Jahre nicht gegeben hätte. Das einzige, was etwas protestantisch an diesen Leuten ist, ist der subjektivistische Gestus, mit dem sie gegen den Rest der Institution antreten. Das aber ist noch nicht wirklich evangelisch. Man muss es auch mit Vernunft und Bildung tun. So lange bleibt man nur jemand mit der Tendenz zur katholischen Sektenbildung. Polyethylen-Blasphemie / 24. April 2013Die unsägliche Gruppe Femen, die ich ob ihrer Borniertheit eher für eine unpolitische Krawalltruppe halten würde, hat in Brüssel den Erzbischof Andrè-Joseph Leonard auf bekannte Art und Weise angegangen und ihn mit angeblichem Weihwasser aus Madonnen-Fläschchen bespritzt. Das Ganze geschah in der Freien Universität und unterbrach einen Vortrag des Bischofs. Nun kann man sich fragen, wie intelligent es ist, den öffentlichen Diskurs an einer Freien Universität zu verhindern. Es ist einfach nur saublöde und kontraproduktiv; man hätte sich ja an der Diskussion beteiligen können – meinetwegen auch nackt. Eine Christenverfolgung oder Katophobie wie reaktionäre Portale schreiben, ist es dagegen nicht. Wenn katholische Traditionalisten mit dem Hammer auf Werke zeitgenössischer Kunst einschlagen und sie zerstören, können sie sich des Beifalls derartiger Portale sicher sein. Wenn aber ein Bischof ein wenig Wasser abbekommt, geht scheinbar die Welt unter. Die Aktion von Femen mag undurchdacht bis ins Letzte (wenn auch nicht unbegründet) sein, aber sie ist doch keine Christenverfolgung und auch keine dem Antisemitismus oder der Islamophobie vergleichbare Sache. Dies auch noch mit der „Haltung Jesu und eines Jüngers Jesu auf dem Kreuzweg“ zu vergleichen ist einfach pervers und lässt jede Relation zum Leiden Christi und der christlichen Märtyrer vermissen. Der Erzbischof hat 2010 mit der Bemerkung Aufmerksamkeit erregt, dass AIDS eine „Art von immanenter Gerechtigkeit“ für Homosexualität sein könnte und zur Erläuterung hinzugefügt, Homosexualität sei eben ein Laster (wie das Rauchen, das auch Folgen nach sich ziehe). Diese Äußerung finde ich mit Abstand schlimmer als nur ein wenig Wasser (und sei es auch Weihwasser) auf der Soutane.
Keine Inkarnation ohne Nachgeburt! / 02. Mai 2013Da in meiner Besprechung des Bilderpredigt-Buches kein rechter Platz über längere Reflexionen zur Nachgeburt Jesu vorhanden war, schiebe ich meine Überlegungen dazu in diese Notizen. Bevor ich ins Detail gehe, kann jeder Leser für sich die Frage beantworten, ob Maria bei der Geburt Jesu eine Nachgeburt hatte oder nicht. Interessanterweise hat jemand auf Yahoo Clever 2012 diese Frage auch schon gestellt und neben drei eher ironischen Repliken auch folgende Antworten erhalten:
Diese Unbekümmertheit in der Beantwortung finde ich ganz interessant, denn so einfach, wie die Beteiligten denken, ist es wie immer in der Theologie nicht. In der katholischen Theologie zumindest herrschte über Jahrhunderte Einmütigkeit darüber, dass Maria Jesus ohne Schmerzen und Nachgeburt geboren hat. Das war ein Missverständnis der Ausführungen des ersten Konzils in Trullo (692), das festgelegt hatte: Wir bekennen das göttliche Gebären aus der Jungfrau ohne Kindbett“. In Westeuropa verstand man letzteres als „ohne Nachgeburt“. Eine Bauernfrau, die es wohl aus eigener Erfahrung besser zu wissen meinte, wurde 1318 im Languedoc der Inquisition unterzogen (Vgl. die Schilderungen, die Jacques Fourier in seinen Inquisitionsprotokollen aus Dörfern des Languedoc und bezüglich der 1318 festgehaltenen Aussagen der Bäuerin Aude aus Merviel über die Nachgeburt Jesu niedergeschrieben hat; Les registres d’inquisition de Jacques Fournier de Pamiers, Band 2, hg. Von J. Duvernoy, Toulouse 1965, S. 94). Dagegen spricht nämlich die theologische Tradition: Da die Schmerzen der Geburt den Frauen wegen des Sündenfalls auferlegt war, Maria aber sündenfrei war, hat sie ohne Schmerzen geboren und bekam auch nach dem Jesuiten Suarez (1548-1617) wegen Ezechiel 44,2 („Diese Türe wird verschlossen sein und nicht aufgemacht werden“) keine Nachgeburt. Das führte sogar zu literarischen Disputationen. Der katholische Theologe und Schriftsteller Anton von Bucher (1746-1817) schreibt in seinem zu Lebzeiten nicht mehr publizierten satirischen und aufklärerischen Stück Pangraz zunächst von einer schwierigen Geburt einer Frau im Dorf, der die Hebamme unter Verweis auf die Nachgeburt der Maria Linderung zu verschaffen sucht. Das führt zu einem heftigen Disput von zwei anwesenden Patres: A: Die Jungfrau Maria hat ohne Nachgeburt geboren, also ist eine Andacht zu der Nachgeburt Maria abergläubisch. B: Keineswegs! Die heilige Brigitta sagt in dem siebenten Buche ihrer Offenbarungen und im 2. Kapitel desselben also: Ich sah das glorreiche Kind nackt und glänzend, und neben derselben die Nachgeburt, zusammengewickelt im herrlichen Glanze. Ergo hat die Jungfrau Maria nicht ohne Nachgeburt geboren. A: Dieses beweiset mehr nicht, als dass die heilige Brigitta eine Nachgeburt gesehen habe, bei weitem aber nicht, dass es ihr göttlicher Weise geoffenbart worden sei, dass die Jungfrau Maria Christum mit einer Nachgeburt geboren habe. B: ... Aber wegen der Nachgeburt noch ein neues Mirakel fordern, da die Geburt ohne Schmerzen, ohne Verletzung der Jungfrauschaft mirakulös ist, wo führt das hin? Ein vernünftiger Mann kann gar nicht so dumm argumentieren. Er gehört in's Tollhaus. A: Das erwartete ich. Ergo gehören in's Tollhaus die Heiligen Epiphanius, Gregorius Nanzianzenus, Cyprianus und Augustinus, welche alle gelehrt haben, dass Maria ohne Nachgeburt geboren habe. Ergo gehören ins Tollhaus Communis theologorum, namentlich Suárez, Faber, Scribonius, mit unzähligen andern, welche P. Virgilius Sedlmair in dem zweiten Teil seiner marianischen Theologie beim zweiten Artikel über die Frage: ob die Jungfrau Maria ohne Nachgeburt geboren? für die Negativam zitiert. O, ihr großen Kirchenlehrer! in's Tollhaus mit euch! Und die heilige Nachgeburt in einem Reliquienkasten auf den Altar! Soweit die aufklärerische Satire, der sich dann auch leider einige weniger aufklärerische und platt anti-katholische Elaborate angeschlossen haben wie etwa der unsägliche Pfaffenspiegel von 1845. Aber die Satire macht klar, dass die Frage nach der Nachgeburt theologisch nicht unproblematisch und auch nicht leicht zu beantworten ist. Wie aber der eine der beiden Patres zu Recht erwähnt, kommt die Nachgeburt ganz konkret in den Visionen der Heiligen Birgitta von Schweden (1303-73) vor, die im 15 Jahrhundert mündlich durch Europa zirkulierten, bevor sie Ende des 15. Jahrhunderts erstmalig in Venedig auf Latein gedruckt wurden. Die Künstler müssen diese Visionen aber von Anfang an stark beeindruckt haben. Ich wusste aus der kunsthistorischen Literatur, dass es Kunstwerke geben muss, die die Nachgeburt wenigstens indirekt zeigen. Aber mir war bisher keines dieser Bilder bekannt. Die Werke, die erkennbar auf Birgittas Visionen Bezug nehmen, wie etwa die von Niccolo di Tommaso, Turino Vanni, Robert Campin, Rogier van der Weyden oder auch Hans Memling verzichten auf dieses Detail. Ihre Gemeinsamkeit ist vor allem das Auftauchen des Josef mit der Kerze (Vgl. die motivgeschichtliche Untersuchung von Katrin Seidel: Die Kerze, Hildesheim 1996, S. 171ff.). Vermutlich war es in einer Zeit, in der weiter um die theologische Bedeutung der Maria gestritten wurde, zu heikel, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen.
Erläuterungsbedürftig wäre noch der Buntspecht, der auf dem Bündel hockt. In der skandinavischen Mythologie gibt es verschieden überlieferte Erzählungen, nach denen der Specht die Folge einer Strafe Jesu sei, weil eine eine rote Haube tragende Frau sich weigerte, einen Bettler zu beköstigen und deshalb in einen Specht verwandelt wurde – aber das ist für dieses Bild doch etwas zu weit hergeholt. Der Specht – falls er hier eine allegorische Funktion hat und nicht nur den naturkundlichen Vorlieben des Künstlers dient – ist jedenfalls noch aufklärungsbedürftig. Hier wäre noch weiter zu recherchieren. Die anderen Tiere auf dem Bild tragen jedenfalls symbolische Bedeutungen. Die evangelische Gemeinde in Hersbruck darf sich aber glücklich schätzen, so ein vorreformatorisches Altarbild zu haben, das gegen manche katholischen Traditionen ganz und gar realistisch auf der Menschlichkeit Jesu beharrt. Keine Inkarnation ohne Nachgeburt! Nachtrag: Detailfragen / 04. Mai 2013
Auch Schongauer bezieht sich auf die Visionen der Birgitta von Schweden, aber nur, was das nackte Jesuskind außerhalb der Krippe und die anbetende Haltung der Maria betrifft. Die Kerze des Josef lässt er ebenso weg wie die singenden Engel. Eine deutliche Verwandtschaft mit dem Hersbrucker Bild kann man in der Darstellung der Hirten erkennen: Auch sie werden volkstümlich derb gezeichnet und einer von ihnen hat ebenfalls eine Schalmei dabei. Auch die Schafherde im Bildhintergrund wird fast analog dargestellt.
Auch wenn Schongauers Bild wegen der Gleichzeitigkeit der Entstehung kein Vorbild für das Bild des Hersbrucker Altars sein kann, so stellt sich doch die Frage nach der Verwandtschaft beider Bilder. 1480 befindet sich Schongauer als etablierter Künstler in Colmar, aber um die Mitte des 15. Jahrhunderts hat er seine Lehrzeit in Nürnberg verbracht. Dort könnten die beiden Maler gemeinsame Impulse empfangen haben, die zu ähnlichen Bildlösungen führen. Die Art der Darstellung des Bündels ist allerdings stark voneinander abweichend, so dass davon auszugehen ist, dass die beiden Künstler mit dem Motiv je Unterschiedliches darstellen wollten. Die weißen Linnen für die Wickel des Kindes werden bei Birgitta erwähnt. Insofern kann bei Schongauer das Bündel erklärt werden, zumal er anders als etwa italienische Künstler auf die Darstellung des ausgebreiteten Linnens verzichtet. Das Bündel beim Hersbrucker Altar kann aber nicht so gedeutet werden. Vor allem die auffallend betonte Lichtführung wird so nicht plausibel. Denn auf dem Hersbrucker Altar ragt das Bündel aus dem Dunkel hervor, so wie es Birgitta beschreibt: „die Nachgeburt, zusammengewickelt im herrlichen Glanze“. Deshalb bleibe ich bei meiner Deutung. Geist los? / 04. Mai 2013In der Zeitschrift Christ und Welt gibt es einen Artikel unter der Überschrift „Der Protestantismus gibt den Geist auf“. Der Artikel bezieht sich auf die nachlassende Attraktivität der Evangelischen Akademien. Nun kann man als jemand, der in den letzten 25 Jahren regelmäßig mit Evangelischen Akademien zusammen gearbeitet hat, diese Diagnose ja nur teilen. Wo – zumindest nach subjektivem Empfinden – früher noch große Debatten stattfanden, sind es heute eher Tagungen im Kontext der regionalen Kultur oder der kulturellen Geselligkeit. Niemand glaubt mehr ernsthaft, dass von Evangelischen Akademien Impulse ausgehen wie seinerzeit für das Verhältnis von Christen und Juden oder Kirche und Film aus Arnoldshain, Ost-West-Politik aus Tutzing, Kirche und Kunst aus Hofgeismar, Kulturpolitik aus Loccum, Wirtschaftsethik aus Mülheim – um nur einige wenige zu nennen. Diese Zeit ist vorbei. Sie ist nicht zuletzt deshalb vorbei, weil es inzwischen konkurrierende Akademien gibt, die besser ausgestattet sind und diese Aufgabe auch besser erledigen. Diese Zeit ist aber auch vorbei, weil in den Kirchenleitungen kaum noch jemand ein Bewusstsein davon hat, welche intellektuelle Bedeutung Evangelische Akademien haben könnten. Ich erinnere mich an einen Vortrag von Peter Steinacker in der Evangelischen Akademie Arnoldshain, in der er zu Beginn erläuterte, was für ihn persönlich eine Evangelische Akademie bedeutete. Wie er als Student einmal den Zugang zu einer Tagung quasi erzwungen hat, nur um an den intellektuellen Auseinandersetzungen teilnehmen zu können. Diesen intellektuellen Eros gibt es heute nicht mehr. Heute sind die Akademien im besten Falle Veranstaltungsorte oder Verlautbarungsorte für die Kirchen und vor allem sind sie binnenkirchlich ausgerichtet. Themen, die die Gesellschaft bewegen, ja verändern könnten, sind rar. In dem Bereich, in dem ich arbeite, der Begegnung von Kunst und Kirche, muss ich schon 15 Jahre zurückdenken, um auf eine einigermaßen auf der Höhe der Zeit befindliche Tagung zu stoßen. Von Avantgarde keine Rede. All das, was in der Kunst seit 1990 passiert ist, spielt auf Tagungen der Evangelischen Akademien – sieht man von ein paar institutionellen Tagungen a la 50 Jahre documenta ab – keine Rolle. Ich glaube nun nicht, dass man dafür die Evangelischen Akademien selbst oder ihre Studienleiter verantwortlich machen kann. Im Rahmen der weitergehenden Säkularisierung unserer Gesellschaft ist die Evangelische Akademie als Diskussionsort gesellschaftlicher Eliten nicht mehr notwendig. Sie ist heute ein Element der Wochenendunterhaltung. Was Eduard Norden Ende des 19. Jahrhunderts über die Gebildeten der antiken Gesellschaft und ihr Verhältnis zur Kirche schrieb, trifft heute vollumfänglich für die Evangelischen Akademien zu:
Und deshalb mehren sich die Tagungen, die eher der Unterhaltung, dem Ohrenschmaus und dem Genuss dienen. Sie vermögen ansatzweise das zu erfüllen, was heute vorrangiges Ziel aller Akademiearbeit ist: Keine ökonomischen Verluste zu machen und Tagungen anzubieten, die sich rechnen. So aber gibt man wirklich den Geist auf. Wolfgang Huber, der das schon lange erkannt hat, ist wenigstens so ehrlich, gleich das Portemonnaie in den Vordergrund zu stellen. Auch der Geist muss sich eben rechnen. Kunstkritik / 08. Mai 2013
Nun ist ‚Kunstkritik‘ eines der schwierigsten Dinge überhaupt. In aller Regel trifft man weniger auf Kunstkritik, sondern entweder hübsch neutrale Beschreibungen und Umschreibungen des betrachteten Gegenstandes oder eben auf Geschmacksurteile eines Menschen, der für sich in Anspruch nimmt, mehr sagen zu können als nur, das gefällt mir. Nun müsste aber Kunstkritik, die ihren Namen verdient, zunächst einmal erklären können, was das Kunsthafte an dem Gegenstand ist, der gerade betrachtet wird. Und sie müsste es so machen, dass die angesprochenen Leserinnen und Leser diese Erklärung als evident empfinden und einstimmen oder beginnen, mit guten Gründen dagegen zu argumentieren. In 90% aller Kunstkritiken wird man das nicht finden. Entweder wird „Kunst“ als Gegebenes (und nicht als zu Erfahrendes) vorausgesetzt, so als ob es zertifizierte Kunst gäbe, oder die Kunsturteile erweisen sich eher als Urteile über Sujets, über handwerkliches Können oder noch schlimmer, bleiben im Rahmen des gesellschaftlich Anekdotischen. Texte von John Berger habe ich im positiven Sinne oft als Kunstkritik empfunden. Ausstellungsrezensionen im Kunstforum oder anderen Kunstzeitschriften dagegen eher als Meinungsäußerungen. Was mir im Kunstforum auffiel, war, dass die historische Kunstkritik ausgeblendet wird. Im Artikel zur Kulturgeschichte der Kritik kommt die Antike und die Gegenwart vor und nur wenige Zeilen bedenken die Renaissance. Das scheint mir dem Gegenstand nicht angemessen. Wer in Michael Baxandalls gerade bei Wagenbach wieder neu aufgelegtem Klassiker „Die Wirklichkeit der Bilder. Malerei und Erfahrung im Italien der Renaissance“ liest, dem wird deutlich, wie beeindruckend subtil die Kunstsprache und die Kunstkritik jener Zeit war:
Baxandall geht jedem dieser Begriffe im Einzelnen nach und macht sie nachvollziehbar. So wünscht man sich Kunstkritik auch heute. Superlativ und Vorurteil / 12. Mai 2013In meiner Heimatstadt Hagen gibt es zur Zeit eine Ausstellung mit Werken von Anselm Kiefer. Wie immer sind Kiefers Werke eindringlich und erfordern weitergehende Reflexionen, die einen zwingen, die Ausstellung noch ein weiteres Mal zu besuchen. Im Zentrum der Ausstellung steht eine achtteilige Arbeit unter dem Titel „Unfruchtbare Landschaften“, mit Säure bearbeitete Fotos, die zu Objektcollagen mit einzelnen Gegenständen erweitert wurden. Hinzu kommen weitere großformatige Arbeiten, zwei aus dem Europa-Zyklus, und auch zwei, die sich im weitesten Sinne mit biblischen Themen beschäftigen. Eine interessante und für die Kunstprovinz durchaus produktive Ausstellung. Was einen freilich nervt, sind die Kommentare des Museums zu einzelnen Werken. Ohne die idiotischsten Superlative geht es heute offenkundig nicht mehr und die ornamentale Wollust des ergänzenden Adjektivs wird hier voll ausgelebt. Hinzu kommen viele Unkorrektheiten. Wenn Anselm Kiefer ein Wallfahrtslied des 19. Jahrhunderts aus dem katholischen Eichsfeld aufgreift, dann wird hier nicht – wie es in der Zeitung später heißen wird – „das kollektive christliche Unterbewusstsein zum Klingen“ gebracht. Das ist Quatsch. Ja, das Lied gehört zum bildungsbürgerlichen Grundbestand, repräsentiert aber nicht einmal im Ansatz ‚kollektives christliches Unterbewusstsein‘ – was immer das auch sein soll. 90% der Besucher der Ausstellung werden, befragt, was denn der Aussagengehalt des Liedes sei, keine Antwort zu geben wissen, so tief hat sich das Lied ins Unterbewusste eingegraben. Noch ärgerlicher wird es bei Kiefers Arbeit „Samson“. Nicht nur, dass der Museumskommentar die antisemitische Wendung von der „alttestamentarischen“ Geschichte nutzt (hier scheinen sich die Kunsthistoriker darauf geeinigt zu haben, lieber die Sprache von Goebbels als die der Fachwissenschaft zu verwenden), nein Simson, die dem Herakles nachgebildete Sagengestalt, wird auch schnell noch zum Massenmörder. Die Journalistin der örtlichen Presse fasst die Museumsbeschreibung des Bildes so zusammen:
Das ist Antisemitismus in Reinkultur. Nein, Simson (שִׁמְשׁוֹן) hat nie existiert und Gewehre hat er natürlich auch nicht verwendet, weshalb das Gewehr nicht an ihn erinnert, sondern nur für ihn steht (was man nicht erkennen würde, wenn Kiefer nicht Samson drauf geschrieben hätte). Er ist, für jeden Volksschüler erkennbar, eine reine Sagengestalt, eine tragische zumal – denn er scheitert mit jedem seiner Aufbrüche. Die erzählerische Anlage erklärt sich aus der seinerzeitigen, als bedrückend erfahrenden Herrschaft der Philister über die Israeliten (zu der auch die Geschichte von David und Goliath zählt). Simson ist den Philistern durch eine Art Hassliebe verbunden, treibt sich als Jüngling in deren Städten herum, ist drei Mal mit Philisterinnen liiert. Die letzte Beziehung, so erzählt es die Legende, wird ihn durch schmählichen Verrat das Leben kosten. Die Philister nehmen in gefangen, blenden ihn, schicken ihn zur Zwangsarbeit und stellen ihn auf einem ihrer Feste als zur Belustigung und Demütigung gedachtes Schaustück aus. In dieser Situation der zugespitzten Folter bittet Simson, so die Legende, um die alte Kraft und bringt den Tempel, auf dem sich das Ganze abspielt, durch Zerren an den Säulen, an denen er festgebunden ist, zum Einsturz. Diese Geschichte hat nichts mit einem realen Geschehen aus der Zeit des vorköniglichen Israel zu tun. Und anders als manche Propagandisten im heutigen Krieg gegen Israel behaupten, haben die Philister auch nichts mit den Palästinensern zu tun. Das alte Seefahrervolk der Philister gibt es seit über 2000 Jahren nicht mehr. Nicht einmal die Römer haben, als sie den Nahen Osten besetzten, noch einen Philister angetroffen. Welcher Brudermord(!) also seit den Zeiten des Simson bis heute im Heiligen Land andauern soll, bleibt daher ein Geheimnis der Vorurteile unter die Leute bringenden Museumsleitung. Wenn man von einem Bruderkonflikt sprechen will, dann träfe er auf die Konkurrenz von Ismael und Isaak zu, aber diese Geschichte erzählt von keinem Mord. Von der Konkurrenz unter Brüdern könnte man noch im Blick auf die Kanaaniter sprechen. Aber in der Geschichte von Simson gibt es keinen Brudermord, sondern eine Sagenfolge, die von kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem herrschenden Volk der Philister erzählt. Und sie tut das so, dass jedes Kind erkennen kann, dass es sich um Sagen handelt. So wie wir von Rübezahl erzählen. Was soll also die Rede vom andauernden Brudermord aussagen: so sind sie, die Juden? Und das schon seit 3000 Jahren? Dass zudem die jüdische Bevölkerung 2000 Jahre von den 3000 Jahren gewaltsam aus Palästina vertrieben war, dass sie in der restlichen Zeit keinesfalls Palästina beherrscht hat – spielen diese Fakten überhaupt noch eine Rolle? Vermutlich nicht. Klingt ja so schön archaisch bzw. archetypisch: Brudermord seit ewigen Zeiten. Bullshit. Wollte man vernünftig reden, könnte man von einem historischen Territorialkonflikt reden. Aber der Konflikt aus der Vorkönigszeit hat mit dem Konflikt der Gegenwart außer der Ähnlichkeit (aber nicht Gleichheit) des Territoriums nichts gemeinsam. Es ist, als ob man Kämpfe der Cherusker mit dem Soldateneinsatz der Bundesrepublik Deutschland in Afghanistan verknüpfen würde. So sind sie, die Deutschen. Und die Deutschen haben schon damals in einem Massenmord 20.000 arme Römer umgebracht. Dass ausgerechnet Anselm Kiefer, der wie kaum ein anderer deutscher Künstler in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts sich mit den Erzählungen der Bibel und dem Schicksal des Judentums auseinander gesetzt hat, mit solch gedankenlosen Phrasen kontaminiert wird, ist wirklich bedauerlich. Ist es aber zu viel, wenn man verlangt, dass ein Museum Legenden von Geschichte differenziert, dass es nicht nazistische Stereotype transportiert, dass es Aufklärung betreibt und nicht Geschichtsklitterung? Und dass das begleitende Feuilleton derartige Stereotype nicht einfach aus dem Museumstext übernimmt, sondern korrigiert und auf die Verzerrungen hinweist? Das sind doch eigentlich Selbstverständlichkeiten. Und den Gebrauch des Superlativs sollten Museumsautoren wie Feuilletonisten sich grundsätzlich abgewöhnen. Er ist in der Regel unangebracht. (So ist Kiefer gewiss nicht der „bekannteste deutsche Künstler“ – wer denkt sich so etwas nur aus?) Die Ausstellung ist gelungen, seine Kontextualisierung gescheitert. Gottesbilder / 13. Mai 2013
Aber darauf kommt es mir gar nicht an. Sondern auf das Gottesbild der empörten katholischen Traditionalisten. Als der Wiener Dompfarrer Faber mäßigende Worte in der Auseinandersetzung um das Stück gebraucht, schreibt einer der Empörten wörtlich:
Dieses Gottesbild muss man sich mal vorstellen. Da gibt es in Wien, Paris, Berlin, Mailand eine Theatervorstellung, die bei frommen Gemütern auf Protest stößt, und Gott lässt zur Strafe 75 Millionen unbeteiligte Jugendliche arbeitslos werden, schickt Naturkatastrophen und Seuchen nach Asien und das nur als Vorboten, um zu zeigen, wie es die wahren Schuldigen treffen wird. Wie wirr im Kopf muss man sein, um so etwas zu glauben? Und weil dem Betreffenden es noch nicht reicht, schickt er im nächsten Statement hinterher: „Die schrecklichste Strafe wäre dort in den Städten-Nationen wo Castelluccis seinen Abschaum mit Duldung der Regierungen ausstellt: die Strafe eines Atomkrieges.“ Ja natürlich, einen Atomkrieg wegen eines Theaterstücks. Und glaube keiner, derartige Statements seien die Ausnahme. Der nächste Diskussionsteilnehmer stimmt zu und schreibt: „Es wird niemand entkommen, aber wir Katholiken wissen wenigstens, wohin es geht, alle anderen nicht!“ Das ist aber eine Frohe Botschaft. Der unheilige Joseph? / 19. Mai 2013Vor einigen Tagen wies mich ein Kollege auf eine neue Biografie zu Joseph Beuys hin, die von den gewohnten Darstellungen insofern abweicht, als sie Beuys ziemlich unverblümt in die rechte Ecke stellt. „Beuys war bis ins Mark völkisch“ lautet eine Schlagzeile und die WELT sprach von den „Lebenslügen des Jahrhundertkünstlers Beuys“. Nun ist das mit Künstlerbiografien immer so eine Sache. Was sollen sie einem eigentlich verständlich machen? Wie so ein Künstler „funktioniert“? Wird die Lyrik eines Erich Fried besser, wenn ich um seine Erkrankung weiß? Oder die Songs von Freddy Mercury, wenn ich seinen frühen Tod mit einbeziehe? Das ist Boulevard bis ins Letzte. Mit der Kunst hat es so gut wie nichts zu tun. Selbstverständlich pflegen auch Museen diesen Boulevard, wenn etwa bei Führungen viel zum Leben des Künstlers und wenig zu seiner Kunst gesagt wird. Die Frauen des Picasso. Das Ohr des van Gogh. Der Koks des Immendorf. Und nun das Völkische des unheiligen Joseph. Nun muss man schon viel unterschlagen, um so simpel aus Steiners Philosophie Nationalsozialistisches zu machen. Die Anthroposophen wurden unter Hitler verfolgt, ihre Organisationen verboten. Im Verbotsdekret heißt es: „Die auf der Pädagogik des Gründers Steiner aufgebauten und in den heute noch bestehenden anthroposophischen Schulen angewandten Unterrichtsmethoden verfolgen eine individualistische, nach dem Einzelmenschen ausgerichtete Erziehung, die nichts mit den nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen gemein hat.“ Man kann gegen die Anthroposophie sein, aber man sollte die Opfer nicht in die Ecke der Täter stellen. Das ist infam.
Wem der Name Cellini nichts sagt – das ist der Bildhauer, der die Perseus-Statue in der Loggia del Lanci in Florenz geschaffen hat. Und dieser Künstler hat eine Vita, die es in sich hat. In der von Goethe frei bearbeiteten Autobiographie schildert er drei von ihm begangene Morde, zahlreiche bewaffnete Attacken auf Organe der Rechtspflege und diverse sexuelle Verfehlungen. Man muss vielleicht nicht so weit gehen wie Horst Bredekamp, der in der Besprechung der Neuausgabe der Vita durch Jacques Laager schrieb: Für Cellini „waren Kunstwerk und Mord austauschbare Größen“. Aber man sollte sich fragen, ob die Kenntnis der unbestreitbaren Untaten des Cellini dessen künstlerisches Werk schmälert. Ich glaube kaum. Bei Beuys kann man nicht einmal auf Untaten verweisen. Und dennoch möchten einige schnell noch ein negatives gesellschaftliches Urteil loswerden. Der hat so Worte gebraucht ... der kannte wen ... das klingt doch so ... Dieses denunziatorische Raunen ist vermutlich einfacher, als sich mit seiner Kunst auseinanderzusetzen. Mich ekelt es an. Der kapitale Baselitz? / 24. Mai 2013Im deutschen Feuilleton gab es ein Geplänkel über Kunst und Kapital. Julia Voss hat in der FAZ Georg Baselitz vorgeworfen, dieser pflege eine Attitüde des verfolgten Rebellen, während er in Wirklichkeit ein gehätscheltes Kind des Kapitals sei: „Kaum ein Künstler hat eine derart steile Karriere mit der Behauptung gemacht, Außenseiter zu sein. Dabei zeichnet Georg Baselitz und sein Werk eine große Nähe zur Finanz- und Wirtschaftselite aus.“ Und Ulf Poschardt hat tags darauf in der WELT das Ganze eine durchschaubare Verschwörungstheorie genannt. Und natürlich haben beide Recht. Georg Baselitz pflegt – wie viele Künstler – den Mythos des Außenseiters. Oft ist das bei Künstlern aus der Biographie zu erklären, nicht zuletzt aus dem Umstand, sich gegenüber so vielen anderem am Markt durchsetzen zu müssen. Und ja, Georg Baselitz ist ein erfolgreicher Künstler, der gut von seiner Kunst leben kann. Wo wäre die Kunst, wenn nicht einige wenige unter den Reichen, statt ihr Geld in Monaco oder der Karibik zu verschleudern, in Kunst investierten und manchmal diese Kunst auch öffentlich zugänglich machten? E Aber eine Verschwörungstheorie ist das, was Julia Voss da vorträgt, schon. Denn sie sinnt uns ja an, dass die Kunst bzw. der Künstler nicht mehr authentisch wären, wenn sie von Reichen bezahlt würden. Das aber entscheidet sich immer noch an den Kunstwerken selbst. Und da sehe ich nicht, wie Voss ihre Behauptung an Arbeiten von Baselitz stützen könnte – die Preise allein können es ja nicht sein. Und von seinen Sammlern – sagen wir es offen – lebt jeder Künstler. Mehr als ein Geschmäckle bekommt das Ganze, weil die FAZ in einer gewissen Tradition der Baselitz-Denunziation steht. 1980 musste Klaus Wagenbach im FREIBEUTER Baselitz, Kiefer und Lüpertz gegen Anwürfe der FAZ verteidigen, die drei Künstler seien „teutsch“ und eine Skulptur von Baselitz vollziehe „eine Art von Hitlergruß“. Das war damals erkennbar unsinnig und denunziatorisch. Und die Neuauflage des denunziatorischen Gestus macht es nicht besser. |
|
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/83/am442.htm
|

 Der Erzbischof von Brüssel referierte vor Ort zum Thema „Blasphemie: Straftat oder Meinungsfreiheit?“ Über seine Haltung dazu wurde nichts bekannt. Immerhin dazu waren die Polyethylen-Flaschen der Lourdes-Madonna (
Der Erzbischof von Brüssel referierte vor Ort zum Thema „Blasphemie: Straftat oder Meinungsfreiheit?“ Über seine Haltung dazu wurde nichts bekannt. Immerhin dazu waren die Polyethylen-Flaschen der Lourdes-Madonna ( Nun aber meine ich, ein Beispiel für eine derartige Darstellung eindeutig identifizieren zu können. Auf dem Geburtsbild des Altars der Hersbrucker Stadtkirche aus dem Jahr 1480 kann man die Geburt Christi nach der Schilderung der Heiligen Birgitta von Schweden erkennen. Festmachen kann man das zum einen an der Kerze des Josef, die dieser in der Hand hat und die erst im späten 14. Jahrhundert bzw. beginnenden 15. Jahrhundert in der Kunst auftaucht. Erkennen kann man es auch am nackten Christuskind, das strahlend vor Maria liegt und nicht in der Krippe im Hintergrund. So weit, so eindeutig. Hinter Maria liegt aber direkt neben der Krippe ein weißes Bündel. Man könnte es für ein Wanderbündel halten, freilich bedürfte es bei einem spätmittelalterlichen Bild dann der Begründung, was dieses auffällig platzierte Bündel dort zu suchen hat. Ich glaube, es handelt sich um „die Nachgeburt, zusammengewickelt im herrlichen Glanze“. Das würde die Platzierung und die auffällige Helligkeit des Bündels erklären.
Nun aber meine ich, ein Beispiel für eine derartige Darstellung eindeutig identifizieren zu können. Auf dem Geburtsbild des Altars der Hersbrucker Stadtkirche aus dem Jahr 1480 kann man die Geburt Christi nach der Schilderung der Heiligen Birgitta von Schweden erkennen. Festmachen kann man das zum einen an der Kerze des Josef, die dieser in der Hand hat und die erst im späten 14. Jahrhundert bzw. beginnenden 15. Jahrhundert in der Kunst auftaucht. Erkennen kann man es auch am nackten Christuskind, das strahlend vor Maria liegt und nicht in der Krippe im Hintergrund. So weit, so eindeutig. Hinter Maria liegt aber direkt neben der Krippe ein weißes Bündel. Man könnte es für ein Wanderbündel halten, freilich bedürfte es bei einem spätmittelalterlichen Bild dann der Begründung, was dieses auffällig platzierte Bündel dort zu suchen hat. Ich glaube, es handelt sich um „die Nachgeburt, zusammengewickelt im herrlichen Glanze“. Das würde die Platzierung und die auffällige Helligkeit des Bündels erklären. Bei den Vor-Bildern dieser Szene finden wir in der Regel allenfalls die Darstellung der Leinentücher, die für die Wicklung des Kindes vorgesehen sind (etwa bei Niccolo di Tommaso und Turino Vanni), aber keinesfalls jenen Realismus des Bündels, das wir beim Meister des Hersbrucker Altars finden. Er muss sich konkrete Gedanken darüber gemacht haben, wie ja auch insgesamt sein Bild von einem volkstümlichen Realismus getragen ist. Aus dem Bündel ragen jedenfalls noch Teile des Strohs heraus, in die die Nachgeburt gepackt wurde.
Bei den Vor-Bildern dieser Szene finden wir in der Regel allenfalls die Darstellung der Leinentücher, die für die Wicklung des Kindes vorgesehen sind (etwa bei Niccolo di Tommaso und Turino Vanni), aber keinesfalls jenen Realismus des Bündels, das wir beim Meister des Hersbrucker Altars finden. Er muss sich konkrete Gedanken darüber gemacht haben, wie ja auch insgesamt sein Bild von einem volkstümlichen Realismus getragen ist. Aus dem Bündel ragen jedenfalls noch Teile des Strohs heraus, in die die Nachgeburt gepackt wurde. Beim Sichten verschiedener Bilder zur Geburt Christi stoße ich heute auf ein Werk von Martin Schongauer (1440-1491), ebenfalls aus der Zeit um 1480. Es hat einige Ähnlichkeiten, ist freilich nur 39x28 cm groß ist und somit kein Altar-, sondern eher ein Andachtsbild.
Beim Sichten verschiedener Bilder zur Geburt Christi stoße ich heute auf ein Werk von Martin Schongauer (1440-1491), ebenfalls aus der Zeit um 1480. Es hat einige Ähnlichkeiten, ist freilich nur 39x28 cm groß ist und somit kein Altar-, sondern eher ein Andachtsbild.  Vor allem aber entdecken wir auf Schongauers Bild ein Detail, das uns im Kontext des zuvor Beschriebenen interessiert. Links unten hinter der anbetenden Maria liegt ein Bündel, das nun eindeutig durch den Stab als Wanderbündel charakterisiert zu sein scheint. Wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir, dass in dem Bündel das weiße Linnen für das Einwickeln des Christuskindes transportiert wurde. Nicht ausgeschlossen werden kann, das auch hier noch etwas Anderes im Bündel steckt, aber dafür gibt es keine Indizien.
Vor allem aber entdecken wir auf Schongauers Bild ein Detail, das uns im Kontext des zuvor Beschriebenen interessiert. Links unten hinter der anbetenden Maria liegt ein Bündel, das nun eindeutig durch den Stab als Wanderbündel charakterisiert zu sein scheint. Wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir, dass in dem Bündel das weiße Linnen für das Einwickeln des Christuskindes transportiert wurde. Nicht ausgeschlossen werden kann, das auch hier noch etwas Anderes im Bündel steckt, aber dafür gibt es keine Indizien.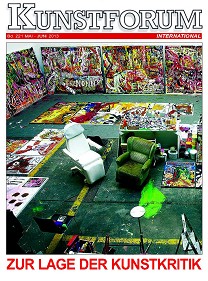 Heute kam das neue Heft von
Heute kam das neue Heft von  Wieder einmal erregen sich die religiös Gestörten über eine Theateraufführung des Stückes Über das Konzept des Angesichts bei Gottes Sohn von Romeo Castellucci. Dieses Mal ist Wien der Ort der besinnungslosen Proteste. Die Leute scheinen keine Probleme damit zu haben, dass das Christus-Bild des Renaissancemalers Antonello da Messina in der Londoner National Gallery als Tourismusattraktion gezeigt wird und nicht in irgendeiner Seitenkapelle einer Kirche. Wenn aber eine Abbildung des Kunstwerkes in einer Theateraufführung Verwendung findet, muss man das verhindern. Ich kann zu Castelluccis Stück nichts sagen, habe es nicht gesehen, kann nach der Beschreibung der Aufgeregten aber auch keine Blasphemie erkennen, sondern eher eine Anklage im Sinne von Tillmann Mosers Gottesvergiftung. Ich vermute, hier trifft zu, was Rüdiger Schaper seinerzeit im Tagesspiegel geschrieben hat: „Früher brauchte das Theater den Skandal. Hier wollen Kirchenleute ihn herbeireden. Um etwas zu schützen, das ihnen entglitten ist – die Seele und das Gefühl der Zeitgenossen.“
Wieder einmal erregen sich die religiös Gestörten über eine Theateraufführung des Stückes Über das Konzept des Angesichts bei Gottes Sohn von Romeo Castellucci. Dieses Mal ist Wien der Ort der besinnungslosen Proteste. Die Leute scheinen keine Probleme damit zu haben, dass das Christus-Bild des Renaissancemalers Antonello da Messina in der Londoner National Gallery als Tourismusattraktion gezeigt wird und nicht in irgendeiner Seitenkapelle einer Kirche. Wenn aber eine Abbildung des Kunstwerkes in einer Theateraufführung Verwendung findet, muss man das verhindern. Ich kann zu Castelluccis Stück nichts sagen, habe es nicht gesehen, kann nach der Beschreibung der Aufgeregten aber auch keine Blasphemie erkennen, sondern eher eine Anklage im Sinne von Tillmann Mosers Gottesvergiftung. Ich vermute, hier trifft zu, was Rüdiger Schaper seinerzeit im Tagesspiegel geschrieben hat: „Früher brauchte das Theater den Skandal. Hier wollen Kirchenleute ihn herbeireden. Um etwas zu schützen, das ihnen entglitten ist – die Seele und das Gefühl der Zeitgenossen.“ Es war reiner Zufall, dass ich an dem Tag, als mir der Kollege die Mail schickte, in der Bibliothek auf ein Buch stieß, das mein Großvater 1924 im Abonnement der Deutschen Buchgemeinschaft bezogen hatte:
Es war reiner Zufall, dass ich an dem Tag, als mir der Kollege die Mail schickte, in der Bibliothek auf ein Buch stieß, das mein Großvater 1924 im Abonnement der Deutschen Buchgemeinschaft bezogen hatte:  inen guten Teil der Kunst verdanken wir derartigen Konstellationen – man braucht nur an Giottos Fresken in der Scrovegni-Kapelle in Padua zu denken (eine Privatkapelle eines Kapitalisten und einer der bedeutsamsten Kunstorte der Welt). Von den unzähligen Stiftungsaltären in unseren kunsthistorischen Museen ganz zu schweigen. Und ja, die Reichen haben sich etwas davon versprochen, Scrovegni zum Beispiel das Seelenheil seines Vaters, den Dante schon in der Hölle schmoren sah. Dieser Handel – Kunst gegen Seelenheil – wird übrigens in der Weltgerichtsdarstellung in Padua ganz offenherzig dargestellt. Trotzdem ist Giotto ein Revolutionär der Kunst, der mit seinen Bildentwicklungen das ganze Herrschaftssystem der katholischen Kirche erschütterte – lange vor der Reformation. Die Maße des Menschlichen und damit die Subjektivität wurden von Giotto eingeführt. So gesehen ist die Tatsache, dass man von den Geldern der Reichen für die eigene Kunst lebt, nicht ehrenrührig, auch wenn man den Gestus des Außenseiters pflegt.
inen guten Teil der Kunst verdanken wir derartigen Konstellationen – man braucht nur an Giottos Fresken in der Scrovegni-Kapelle in Padua zu denken (eine Privatkapelle eines Kapitalisten und einer der bedeutsamsten Kunstorte der Welt). Von den unzähligen Stiftungsaltären in unseren kunsthistorischen Museen ganz zu schweigen. Und ja, die Reichen haben sich etwas davon versprochen, Scrovegni zum Beispiel das Seelenheil seines Vaters, den Dante schon in der Hölle schmoren sah. Dieser Handel – Kunst gegen Seelenheil – wird übrigens in der Weltgerichtsdarstellung in Padua ganz offenherzig dargestellt. Trotzdem ist Giotto ein Revolutionär der Kunst, der mit seinen Bildentwicklungen das ganze Herrschaftssystem der katholischen Kirche erschütterte – lange vor der Reformation. Die Maße des Menschlichen und damit die Subjektivität wurden von Giotto eingeführt. So gesehen ist die Tatsache, dass man von den Geldern der Reichen für die eigene Kunst lebt, nicht ehrenrührig, auch wenn man den Gestus des Außenseiters pflegt.