„Wie unglücklich sind doch die Reichen“
Heines Vorschlag zur Lösung der Kamelfrage, Steuersünder Hoeneß und die Superreichen von heute
Hans–Jürgen Benedict
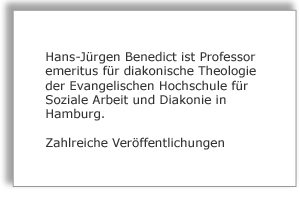 Gegenwärtig ist die Empörung über die Steuerflucht und andere betrügerische Praktiken der Reichen groß. Wieso, fragt sich der Durchschnittsdeutsche, müssen die Reichen, deren Reichtum ständig wächst (die berühmte Schere zwischen arm und reich) auch noch den Fiskus betrügen? Sind das Charakterdefizite? Hoeneß, der sympathische Fußballer und engagierte Bürger, so ein Raffzahn und Zocker? Der Postchef Zumdick vor einigen Jahren! Und tausend andere! Stimmt der Spruch: „Je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine Wünsche still? Gegenwärtig ist die Empörung über die Steuerflucht und andere betrügerische Praktiken der Reichen groß. Wieso, fragt sich der Durchschnittsdeutsche, müssen die Reichen, deren Reichtum ständig wächst (die berühmte Schere zwischen arm und reich) auch noch den Fiskus betrügen? Sind das Charakterdefizite? Hoeneß, der sympathische Fußballer und engagierte Bürger, so ein Raffzahn und Zocker? Der Postchef Zumdick vor einigen Jahren! Und tausend andere! Stimmt der Spruch: „Je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine Wünsche still?
 Was könnte bloß das Motiv der Reichen sein, sich weiter zu bereichern, nichts zu verschenken? Darüber hat sich Heinrich Heine in seinen Berichten aus Paris im Jahr Gedanken gemacht. Am 5. Mai 1843 schildert Heine anlässlich der Eröffnung der beiden Eisenbahnlinien nach Orleans und Rouen – wunderbar die Bemerkung des Emigranten Heine dazu: „Was wird das erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden. Mir ist kamen als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Türe brandet die Nordsee.“ – die Rolle großen Kapitalgesellschaften zur Finanzierung der Eisenbahnen. Und kommt dann auf das Bankhaus Rothschild zu sprechen. Auf dem Höhepunkt seines Einflusses sei der Baron von Rothschild, der reichste Mann seiner Zeit, wie Ludwig XIV. nur mit der Sonne zu vergleichen. Aber diese arme Sonne hat keine Ruhe vor ihren Anbetern, die ihm so stark zusetzen, dass man Mitleid mit ihm haben möchte. „Ich glaube überhaupt, das Geld ist für ihn mehr ein Unglück als ein Glück; er muss viel leiden von dem Andrang des vielen Elends, das er lindern soll.“ „Überreichtum ist vielleicht schwerer zu ertragen als Armut.“ Jedem, der sich in großer Geldnot befindet, rät Heine, zu Herrn von Rothschild zu gehen, nicht um zu borgen, denn er zweifelt, dass er etwas Erkleckliches bekommt, sondern um sich durch den Anblick jenes Geldelends zu trösten. Und jetzt folgt Was könnte bloß das Motiv der Reichen sein, sich weiter zu bereichern, nichts zu verschenken? Darüber hat sich Heinrich Heine in seinen Berichten aus Paris im Jahr Gedanken gemacht. Am 5. Mai 1843 schildert Heine anlässlich der Eröffnung der beiden Eisenbahnlinien nach Orleans und Rouen – wunderbar die Bemerkung des Emigranten Heine dazu: „Was wird das erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden. Mir ist kamen als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Türe brandet die Nordsee.“ – die Rolle großen Kapitalgesellschaften zur Finanzierung der Eisenbahnen. Und kommt dann auf das Bankhaus Rothschild zu sprechen. Auf dem Höhepunkt seines Einflusses sei der Baron von Rothschild, der reichste Mann seiner Zeit, wie Ludwig XIV. nur mit der Sonne zu vergleichen. Aber diese arme Sonne hat keine Ruhe vor ihren Anbetern, die ihm so stark zusetzen, dass man Mitleid mit ihm haben möchte. „Ich glaube überhaupt, das Geld ist für ihn mehr ein Unglück als ein Glück; er muss viel leiden von dem Andrang des vielen Elends, das er lindern soll.“ „Überreichtum ist vielleicht schwerer zu ertragen als Armut.“ Jedem, der sich in großer Geldnot befindet, rät Heine, zu Herrn von Rothschild zu gehen, nicht um zu borgen, denn er zweifelt, dass er etwas Erkleckliches bekommt, sondern um sich durch den Anblick jenes Geldelends zu trösten. Und jetzt folgt
 "Wie unglücklich sind doch die Reichen in diesem Leben – und nach diesem Tode kommen sie nicht einmal in den Himmel! ‚Ein Kamel wird eher durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher in das Himmelreich käme‘, dieses Wort des göttlichen Kommunisten ist ein furchtbares Anathema und zeugt von seinem bitteren Hass gegen die Börse und haute finance von Jerusalem. Es wimmelt in der Welt von Philanthropen, es gibt Tierquälergesellschaften, und man tut wirklich sehr viel für die Armen. Aber für die Reichen, die noch viel unglücklicher sind, geschieht gar nichts. Statt Preisfragen über Seidenkultur, Stallfütterung und Kantsche Philosophie aufzugeben, sollten unsere gelehrten Sozietäten einen bedeutenden Preis aussetzen zur Lösung der Frage: wie man eine Kamel durch ein Nadelöhr fädeln könne? Ehe diese große Kamelfrage gelöst ist und die Reichen einen Aussicht gewinnen ins Himmelreich zu kommen, wird auch für die Armen kein durchgreifendes Heil begründet. Die Reichen würden weniger hartherzig sein, wenn sie nicht bloß auf Erdenglück angewiesen wären und nicht die Armen beneiden müßten, die einst dort oben in floribus sich des ewigen Lebens gaudieren. Sie sagen: Warum sollen wir hier auf Erden für das Lumpengesindel etwas tun, da es ihm doch einst besser ergeht als uns, und wir jedenfalls nach dem Tod nicht mit demselben zusammentreffen.“ Wüssten die Reichen, dass sie dort oben wieder in alle Ewigkeit mit uns zusammen hausen müssen, so würden sie sich gewiß hier auf Erden etwas genieren und sich hüten, uns gar zu sehr zu misshandeln. Laßt uns daher vor allem die große Kamelfrage lösen.“ (Heine, Lutetia, Sämtliche Werke hg. v. Briegleb, V, 453f) "Wie unglücklich sind doch die Reichen in diesem Leben – und nach diesem Tode kommen sie nicht einmal in den Himmel! ‚Ein Kamel wird eher durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher in das Himmelreich käme‘, dieses Wort des göttlichen Kommunisten ist ein furchtbares Anathema und zeugt von seinem bitteren Hass gegen die Börse und haute finance von Jerusalem. Es wimmelt in der Welt von Philanthropen, es gibt Tierquälergesellschaften, und man tut wirklich sehr viel für die Armen. Aber für die Reichen, die noch viel unglücklicher sind, geschieht gar nichts. Statt Preisfragen über Seidenkultur, Stallfütterung und Kantsche Philosophie aufzugeben, sollten unsere gelehrten Sozietäten einen bedeutenden Preis aussetzen zur Lösung der Frage: wie man eine Kamel durch ein Nadelöhr fädeln könne? Ehe diese große Kamelfrage gelöst ist und die Reichen einen Aussicht gewinnen ins Himmelreich zu kommen, wird auch für die Armen kein durchgreifendes Heil begründet. Die Reichen würden weniger hartherzig sein, wenn sie nicht bloß auf Erdenglück angewiesen wären und nicht die Armen beneiden müßten, die einst dort oben in floribus sich des ewigen Lebens gaudieren. Sie sagen: Warum sollen wir hier auf Erden für das Lumpengesindel etwas tun, da es ihm doch einst besser ergeht als uns, und wir jedenfalls nach dem Tod nicht mit demselben zusammentreffen.“ Wüssten die Reichen, dass sie dort oben wieder in alle Ewigkeit mit uns zusammen hausen müssen, so würden sie sich gewiß hier auf Erden etwas genieren und sich hüten, uns gar zu sehr zu misshandeln. Laßt uns daher vor allem die große Kamelfrage lösen.“ (Heine, Lutetia, Sämtliche Werke hg. v. Briegleb, V, 453f)
Heine treibt seinen Spaß mit dem ehrwürdigen Text, über den in der Kirchen- und Weltgeschichte schon so viel gerätselt und gepredigt worden ist. Sein genialer Einfall besteht darin, sich auf die Seite der unglücklichen und gequälten Reichen zu schlagen, die vom Himmelreich ausgeschlossen sind. Geschickt hat er sich durch die Schilderung der bemitleidenswerten Lage des Barons Rotschild an das Thema Last des Reichtums herangearbeitet. Jesu Satz wird nicht relativiert oder spitzfindig ausgelegt. Etwa in der Art, es gab ein kleines Stadttor namens Nadelöhr in Jerusalem, durch das gerade so eben ein Kamel passte, eine reichtumsgünstige Auslegung, die seit dem Hochmittelalter bekannt ist und sich hartnäckig hält, obwohl es erwiesenermaßen nie ein solches Tor gegeben hat.
Überhaupt ist die Auslegungsgeschichte der Geschichte vom reichen Jüngling eine Fundgrube exegetischer Verbiegungen. Schon in den Evangelien selber wird das radikale „Verkaufe alles, was du hast und gib’s den Armen“ erweicht. Das geschieht im Lukasevangelium in der Geschichte vom reichen Zöllner Zachäus, in dessen Haus Jesus einkehrt. Er tritt vor Jesus hin und sagt: „die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen und was ich unrecht erworben habe, erstatte ich vierfach.“ Diese Selbstanzeige eines Reichen ist wohl die erste pragmatische Lösung der großen Kamelfrage, die wir kennen. Kein spontaner Einfall, sondern sie wird in der Gemeinde, in der und für die Lukas schreibt, Praxis gewesen sein. Sie findet sich immerhin noch 250 Jahre später bei Basilius dem Großen. Von den vererbenden Familienvätern fordert dieser, dass sie mehr als die Hälfte ihres Vermögens der Seele, sprich Gott, vererben. Es ziemt sich nicht für einen Christen, dass man den eigenen Kindern mehr vererbt als Gott und seinen Armen. Dieser „Seelteil“, nun zugunsten des Staates, wäre bei der Reform der Erbschaftssteuer doch ein guter Richtsatz!
 Danach aber setzt sich die Tendenz durch, das Gebot dahingehend zu mildern, nur etwas von dem Vermögen den Armen abzugeben. In einer Homilie des Clemens von Alexandrien wird die große Kamelfrage zuerst so gelöst, dass er den Satz nicht auf die äußere Weggabe des Besitzes bezieht, sondern auf die Seele und die Liebe zum Besitz. Es sind die Leidenschaften, die vom Heil abhalten. Reichtum ist an sich weder gut noch böse; man darf ihn nicht wegwerfen, sondern muss daraus ein Werkzeug der Gerechtigkeit machen. Freiwillige Armut wird zur Sache der besonders Frommen, der Mönche. Die reformatorische Auslegung wendet sich gegen diesen Ansatz, da dieser den im Mönchtum ausgeprägten katholischen Versuch verkörpere, durch eigene Werke das Leben zu erwerben. Der Reiche wird hier zum Prototyp des Gottlosen, der nach Werkgerechtigkeit strebt. Besitzverzicht aber wird abgelehnt. Luther stellt den Text geradezu auf den Kopf, wenn er sagt: Das Gebot Christi sei nicht, alles zu verlassen wie die Mönche, sondern mit dem eigenen Besitz für die Seinen zu sorgen. Für Max Weber schließlich wird die Forderung des Besitzverzichts zum Inbegriff jener Gesinnungsethik, die man nur ganz oder gar nicht befolgen kann. Als Maxime eines Politikers und als Forderung für jedermann wäre Mt 19,21 verantwortungslos und sinnlos. Danach aber setzt sich die Tendenz durch, das Gebot dahingehend zu mildern, nur etwas von dem Vermögen den Armen abzugeben. In einer Homilie des Clemens von Alexandrien wird die große Kamelfrage zuerst so gelöst, dass er den Satz nicht auf die äußere Weggabe des Besitzes bezieht, sondern auf die Seele und die Liebe zum Besitz. Es sind die Leidenschaften, die vom Heil abhalten. Reichtum ist an sich weder gut noch böse; man darf ihn nicht wegwerfen, sondern muss daraus ein Werkzeug der Gerechtigkeit machen. Freiwillige Armut wird zur Sache der besonders Frommen, der Mönche. Die reformatorische Auslegung wendet sich gegen diesen Ansatz, da dieser den im Mönchtum ausgeprägten katholischen Versuch verkörpere, durch eigene Werke das Leben zu erwerben. Der Reiche wird hier zum Prototyp des Gottlosen, der nach Werkgerechtigkeit strebt. Besitzverzicht aber wird abgelehnt. Luther stellt den Text geradezu auf den Kopf, wenn er sagt: Das Gebot Christi sei nicht, alles zu verlassen wie die Mönche, sondern mit dem eigenen Besitz für die Seinen zu sorgen. Für Max Weber schließlich wird die Forderung des Besitzverzichts zum Inbegriff jener Gesinnungsethik, die man nur ganz oder gar nicht befolgen kann. Als Maxime eines Politikers und als Forderung für jedermann wäre Mt 19,21 verantwortungslos und sinnlos.
Die katholische wie die protestantische Auslegungsgeschichte dieses Verses ist eine der Verdrängung. Wie klar doch dagegen Heine argumentiert. Der gezwungenermaßen aus Karrieregründen in Heiligenstadt von Pfarrer Grimm protestantisch getaufte Heine macht den Eiertanz zum Thema Reichtum nicht mit. Für ihn hat Jesus, der „göttliche Kommunist“, sein durch nichts zu erweichendes furchtbares Anathema über den Reichtum gesprochen. Sein Hass gegen Börse und Hochfinanz von Jerusalem zeigt sich in dem Satz vom Kamel überdeutlich. Uns aber hat er damit ein Problem hinterlassen. In der Tat: Jesu hat diesen Konflikt mit der Finanzwelt, so die neuere Forschung, bei der Tempelaustreibung riskiert und ist deswegen verhaftet und hingerichtet worden. Heine erweicht nicht den geldkritischen Ansatz Jesu, er aktualisiert ihn, ablesbar an den Begriffen Bankiers, Hochfinanz, Börse. Vor Augen hat er das Aufkommen riesiger Finanzvermögen und -spekulationen. Von den Eisenbahnaktien (die Heine selber kaufte) über Rothschild zu Jesu Verdikt. Geld regiert die Welt. In einem Artikel vom März 1841 schreibt Heine: „Das Geld ist der Gott unserer Zeit.“ Die Reichen haben es schwer, weil sie nicht ins Himmelreich kommen. Das also ist der Grund für das widersinnige Verhalten - auch heutzutage. Mag man auch nicht mehr an den Himmel glauben, selbst als Bayer nicht, untergründig wirkt der Satz nach. Da darf man doch an die Geschichte vom Zöllner Zachäus erinnern. Sie eröffnet für Uli Hoeneß und andere Steuersünder eine Perspektive – gib die Hälfte den Armen und erstatte vierfach, was du unrecht erworben. Dann öffnet sich für dich der Himmel auf Erden – du bist wieder angenommen, das treibt den armen Hoeneß besonders um und da hat er mein Mitgefühl, und darfst in der Talkshow, dem Himmel der medialen Präsenz, auftreten.
Aber das Problem des Überreichtums ist damit überhaupt nicht gelöst. Hoeneß, der Wurstfabrikant, ist ja vergleichen mit den Superreichen fast ein „armes Würstchen“.
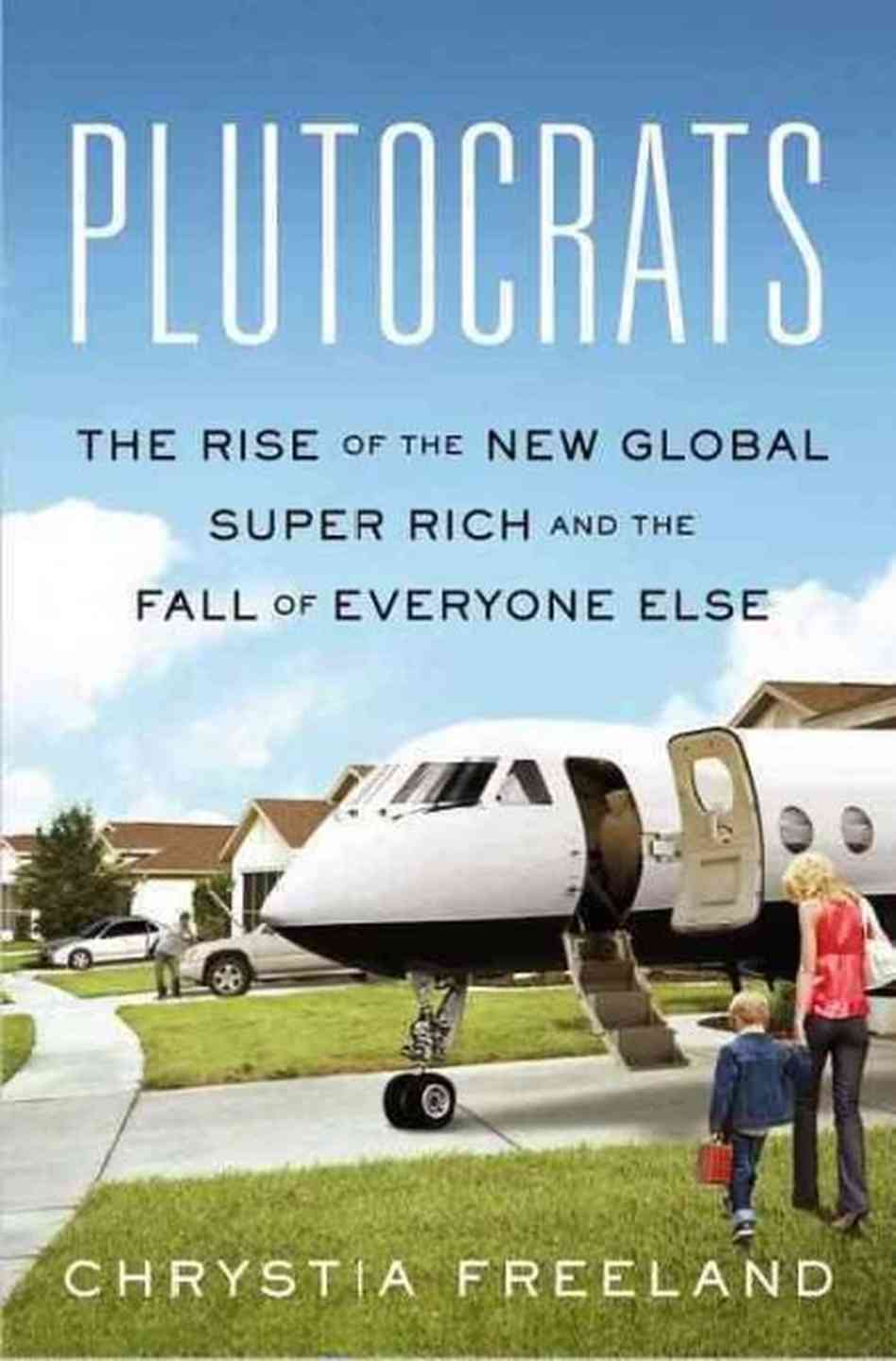 In ihrem 2012 erschienenen Buch The Plutocrats, zu deutsch: „Die Superreichen. Der Aufstieg der neuen globalen Superreichen und der Abstieg von jedermann“ schreibt die Journalistin Chrystia Freeland, dass ein Jahreseinkommen eines Managers von 68 Millionen Dollar oder ein Bonus eines Derivate-Spitzenhändlers verglichen mit den Einkommen der Chefs von Hedge-Fonds und Venture-Kapitalfirmen nur mittemäßig sei. Clans wie die Quandts in Deutschland konnte sich 2012 allein aufgrund ihres BMW-Pakets auf eine Dividende von 650 Millionen Euro freuen. In ihrem 2012 erschienenen Buch The Plutocrats, zu deutsch: „Die Superreichen. Der Aufstieg der neuen globalen Superreichen und der Abstieg von jedermann“ schreibt die Journalistin Chrystia Freeland, dass ein Jahreseinkommen eines Managers von 68 Millionen Dollar oder ein Bonus eines Derivate-Spitzenhändlers verglichen mit den Einkommen der Chefs von Hedge-Fonds und Venture-Kapitalfirmen nur mittemäßig sei. Clans wie die Quandts in Deutschland konnte sich 2012 allein aufgrund ihres BMW-Pakets auf eine Dividende von 650 Millionen Euro freuen.
In gewisser Weise sind die Steueroasen, sagt der Soziologe H. J. Krysmanski in seinem Buch „O,1% Das Imperium der Milliardäre“ (Westend-Verlag 2012) Waffendepots im Krieg der Reichen, und er zitiert Warren Buffett, mit einem Privatvermögen von 60 Milliarden Dollar einer der reichsten Männer der Welt, mit folgenden Worten: „Es herrscht Klassenkrieg, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen.“ Was haben die Superreichen mit diesen Machtmitteln des Geldes, den 30 bis 50 Billionen Dollar, vor? Zunächst einmal wissen sie um die Wichtigkeit des Eindrucks, den sie in der Öffentlichkeit machen, und deswegen haben Bill Gates und Buffett im Jahr 2009 ein dutzend der liberalsten US-amerikanischen Milliardäre eingeladen, um ganz wie der Zachäus des Evangelisten Lukas, sich zu verpflichten, die Hälfte ihres Vermögens für philanthropische Zwecke zu stiften (Giving Pledge). Das sieht sozial gut aus, hat aber zur Konsequenz, dass sie damit halböffentliche Aufgaben übernehmen. So betreibt die Gates-Stiftung nicht nur Weltgesundheitspolitik sondern macht sich auch noch ans Aufmöbeln maroder Schulen – Gates sei fast so etwas wie der wahre Bildungsminister der USA, monierte die US-Lehrergewerkschaft NEA.
 Der Soziologe H. J. Krysmanski hat in seinem schon erwähnten Buch diesen Superreichtum mit einer Ringburg verglichen, in deren Mitte die 0,01 % Superreiche sitzen, Milliardäre wie Warren Buffet und Bill Gates – „eine völlig losgelöste und zu allem fähige soziale Schicht, welcher die Wissens- und Informationsgesellschaft alle Mittel in die Hände legt, um sich als neue gesellschaftliche Mitte zu etablieren.“ Um sie herum und als zweiter Ring gruppieren sich die Konzern- und Finanzeliten als Spezialisten der Verwertung und Sicherung des Reichtums. Den nächsten Funktionsring bilden die politischen Eliten, also die nationalen Regierungen, die sicherstellen dass der Reichtum von unten nach oben verteilt wird. Die größte Gruppe hält sich auf dem Außenring der Festung auf, die Funktions-und Wissenseliten aller Art, von Wissenschaftlern über die Techno-und Bürokraten bis zu den Unterhaltungseliten in Medien, Kultur und Sport. Während sich also die Reichen verschanzen und gleichzeitig ihren Einfluss auf Politik und Wirtschaft auszuweiten versuchen, häuft sich um die Ringburg das Konfliktpotential. Nach einer Studie des britischen Verteidigungsministeriums werden im Jahr 2037 60 % der Menschen weltweit in verslumten Städten um die Bankentürme sich zusammendrängen. Diese Konzentration von Not, Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit wird einen gewaltigen Sprengsatz darstellen. Auf der andern Seite betreiben die Superreichen Strategien der Reichtumsverwaltung und der weltweiten Vernetzung, die ihre Privilegien sichern sollen. Eine Forschergruppe der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich hat alle 43 060 transnationalen Konzerne und ihre Anteilseigner herausgefiltert und dabei festgestellt, dass es ein Cluster von 147 engverwobenen Unternehmen gibt, die meisten davon Finanzinstitutionen, die 40 % des gesamten Netzwerks beherrschen. Die Finanzkrise von 2008 hat allerdings gezeigt, dass dieses Netz nicht so stabil ist, wie es scheint. Auf der andern Seite sind die Superreichen ungeschoren aus der Krise herausgekommen. Einige Analytiker nehmen nun an, dass die Geldeliten sich weiter verselbständigen wollen. Sie beginnen, auf eigene Faust mit Söldner- Armeen sowie privaten Polizei-und Geheimdiensten zu kooperieren. So soll der russisch-britische Milliardär Abramowitsch auf seiner 475 Mill. teuren Megayacht Eclipse ein Raketenabwehrsystem installiert haben. Der Soziologe H. J. Krysmanski hat in seinem schon erwähnten Buch diesen Superreichtum mit einer Ringburg verglichen, in deren Mitte die 0,01 % Superreiche sitzen, Milliardäre wie Warren Buffet und Bill Gates – „eine völlig losgelöste und zu allem fähige soziale Schicht, welcher die Wissens- und Informationsgesellschaft alle Mittel in die Hände legt, um sich als neue gesellschaftliche Mitte zu etablieren.“ Um sie herum und als zweiter Ring gruppieren sich die Konzern- und Finanzeliten als Spezialisten der Verwertung und Sicherung des Reichtums. Den nächsten Funktionsring bilden die politischen Eliten, also die nationalen Regierungen, die sicherstellen dass der Reichtum von unten nach oben verteilt wird. Die größte Gruppe hält sich auf dem Außenring der Festung auf, die Funktions-und Wissenseliten aller Art, von Wissenschaftlern über die Techno-und Bürokraten bis zu den Unterhaltungseliten in Medien, Kultur und Sport. Während sich also die Reichen verschanzen und gleichzeitig ihren Einfluss auf Politik und Wirtschaft auszuweiten versuchen, häuft sich um die Ringburg das Konfliktpotential. Nach einer Studie des britischen Verteidigungsministeriums werden im Jahr 2037 60 % der Menschen weltweit in verslumten Städten um die Bankentürme sich zusammendrängen. Diese Konzentration von Not, Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit wird einen gewaltigen Sprengsatz darstellen. Auf der andern Seite betreiben die Superreichen Strategien der Reichtumsverwaltung und der weltweiten Vernetzung, die ihre Privilegien sichern sollen. Eine Forschergruppe der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich hat alle 43 060 transnationalen Konzerne und ihre Anteilseigner herausgefiltert und dabei festgestellt, dass es ein Cluster von 147 engverwobenen Unternehmen gibt, die meisten davon Finanzinstitutionen, die 40 % des gesamten Netzwerks beherrschen. Die Finanzkrise von 2008 hat allerdings gezeigt, dass dieses Netz nicht so stabil ist, wie es scheint. Auf der andern Seite sind die Superreichen ungeschoren aus der Krise herausgekommen. Einige Analytiker nehmen nun an, dass die Geldeliten sich weiter verselbständigen wollen. Sie beginnen, auf eigene Faust mit Söldner- Armeen sowie privaten Polizei-und Geheimdiensten zu kooperieren. So soll der russisch-britische Milliardär Abramowitsch auf seiner 475 Mill. teuren Megayacht Eclipse ein Raketenabwehrsystem installiert haben.
Ist das jetzt eine neue Verschwörungstheorie? Gar eine Neuauflage der Protokolle der Weisen von Zion, die das jüdische Geldkapital als böses Zentrum von Weltpolitik in den Köpfen verunsicherter Menschen verankerte und sich im Nationalsozialismus in eine rassistische Vernichtungsmaschine verwandelte?
Zurück zu der Kamelfrage, die Heinrich Heine vor 170 Jahren so geistreich am Beispiel des Barons Rothschild abhandelte. In der Tat ist die Kamelfrage ungelöst – privaten Superreichtum demokratisch zu kontrollieren, ist vor allem eine Frage des Datenwissens. Die ist das Nadelöhr, durch das man die Superreichen fädeln müsste. Schon bei den Steuer-CDs, die bundesdeutsche Länder kauften, um die vielen reichen Steuersünder mittlerer Größe zu überführen, ist das erkennbar. Aber trauen sich die Regierungen auch an die Superreichen heran? Eher nicht, aber ohne ihre demokratische Kontrolle wird es nicht wirklich besser werden, und so wird uns die Kamelfrage wohl noch lange begleiten.
|

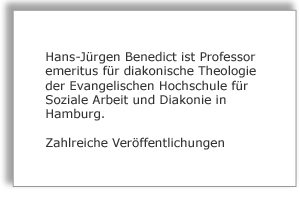 Gegenwärtig ist die Empörung über die Steuerflucht und andere betrügerische Praktiken der Reichen groß. Wieso, fragt sich der Durchschnittsdeutsche, müssen die Reichen, deren Reichtum ständig wächst (die berühmte Schere zwischen arm und reich) auch noch den Fiskus betrügen? Sind das Charakterdefizite? Hoeneß, der sympathische Fußballer und engagierte Bürger, so ein Raffzahn und Zocker? Der Postchef Zumdick vor einigen Jahren! Und tausend andere! Stimmt der Spruch: „Je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine Wünsche still?
Gegenwärtig ist die Empörung über die Steuerflucht und andere betrügerische Praktiken der Reichen groß. Wieso, fragt sich der Durchschnittsdeutsche, müssen die Reichen, deren Reichtum ständig wächst (die berühmte Schere zwischen arm und reich) auch noch den Fiskus betrügen? Sind das Charakterdefizite? Hoeneß, der sympathische Fußballer und engagierte Bürger, so ein Raffzahn und Zocker? Der Postchef Zumdick vor einigen Jahren! Und tausend andere! Stimmt der Spruch: „Je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine Wünsche still? Was könnte bloß das Motiv der Reichen sein, sich weiter zu bereichern, nichts zu verschenken? Darüber hat sich Heinrich Heine in seinen Berichten aus Paris im Jahr Gedanken gemacht. Am 5. Mai 1843 schildert Heine anlässlich der Eröffnung der beiden Eisenbahnlinien nach Orleans und Rouen – wunderbar die Bemerkung des Emigranten Heine dazu: „Was wird das erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden. Mir ist kamen als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Türe brandet die Nordsee.“ – die Rolle großen Kapitalgesellschaften zur Finanzierung der Eisenbahnen. Und kommt dann auf das Bankhaus Rothschild zu sprechen. Auf dem Höhepunkt seines Einflusses sei der Baron von Rothschild, der reichste Mann seiner Zeit, wie Ludwig XIV. nur mit der Sonne zu vergleichen. Aber diese arme Sonne hat keine Ruhe vor ihren Anbetern, die ihm so stark zusetzen, dass man Mitleid mit ihm haben möchte. „Ich glaube überhaupt, das Geld ist für ihn mehr ein Unglück als ein Glück; er muss viel leiden von dem Andrang des vielen Elends, das er lindern soll.“ „Überreichtum ist vielleicht schwerer zu ertragen als Armut.“ Jedem, der sich in großer Geldnot befindet, rät Heine, zu Herrn von Rothschild zu gehen, nicht um zu borgen, denn er zweifelt, dass er etwas Erkleckliches bekommt, sondern um sich durch den Anblick jenes Geldelends zu trösten. Und jetzt folgt
Was könnte bloß das Motiv der Reichen sein, sich weiter zu bereichern, nichts zu verschenken? Darüber hat sich Heinrich Heine in seinen Berichten aus Paris im Jahr Gedanken gemacht. Am 5. Mai 1843 schildert Heine anlässlich der Eröffnung der beiden Eisenbahnlinien nach Orleans und Rouen – wunderbar die Bemerkung des Emigranten Heine dazu: „Was wird das erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden. Mir ist kamen als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Türe brandet die Nordsee.“ – die Rolle großen Kapitalgesellschaften zur Finanzierung der Eisenbahnen. Und kommt dann auf das Bankhaus Rothschild zu sprechen. Auf dem Höhepunkt seines Einflusses sei der Baron von Rothschild, der reichste Mann seiner Zeit, wie Ludwig XIV. nur mit der Sonne zu vergleichen. Aber diese arme Sonne hat keine Ruhe vor ihren Anbetern, die ihm so stark zusetzen, dass man Mitleid mit ihm haben möchte. „Ich glaube überhaupt, das Geld ist für ihn mehr ein Unglück als ein Glück; er muss viel leiden von dem Andrang des vielen Elends, das er lindern soll.“ „Überreichtum ist vielleicht schwerer zu ertragen als Armut.“ Jedem, der sich in großer Geldnot befindet, rät Heine, zu Herrn von Rothschild zu gehen, nicht um zu borgen, denn er zweifelt, dass er etwas Erkleckliches bekommt, sondern um sich durch den Anblick jenes Geldelends zu trösten. Und jetzt folgt "Wie unglücklich sind doch die Reichen in diesem Leben – und nach diesem Tode kommen sie nicht einmal in den Himmel! ‚Ein Kamel wird eher durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher in das Himmelreich käme‘, dieses Wort des göttlichen Kommunisten ist ein furchtbares Anathema und zeugt von seinem bitteren Hass gegen die Börse und haute finance von Jerusalem. Es wimmelt in der Welt von Philanthropen, es gibt Tierquälergesellschaften, und man tut wirklich sehr viel für die Armen. Aber für die Reichen, die noch viel unglücklicher sind, geschieht gar nichts. Statt Preisfragen über Seidenkultur, Stallfütterung und Kantsche Philosophie aufzugeben, sollten unsere gelehrten Sozietäten einen bedeutenden Preis aussetzen zur Lösung der Frage: wie man eine Kamel durch ein Nadelöhr fädeln könne? Ehe diese große Kamelfrage gelöst ist und die Reichen einen Aussicht gewinnen ins Himmelreich zu kommen, wird auch für die Armen kein durchgreifendes Heil begründet. Die Reichen würden weniger hartherzig sein, wenn sie nicht bloß auf Erdenglück angewiesen wären und nicht die Armen beneiden müßten, die einst dort oben in floribus sich des ewigen Lebens gaudieren. Sie sagen: Warum sollen wir hier auf Erden für das Lumpengesindel etwas tun, da es ihm doch einst besser ergeht als uns, und wir jedenfalls nach dem Tod nicht mit demselben zusammentreffen.“ Wüssten die Reichen, dass sie dort oben wieder in alle Ewigkeit mit uns zusammen hausen müssen, so würden sie sich gewiß hier auf Erden etwas genieren und sich hüten, uns gar zu sehr zu misshandeln. Laßt uns daher vor allem die große Kamelfrage lösen.“ (Heine, Lutetia, Sämtliche Werke hg. v. Briegleb, V, 453f)
"Wie unglücklich sind doch die Reichen in diesem Leben – und nach diesem Tode kommen sie nicht einmal in den Himmel! ‚Ein Kamel wird eher durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher in das Himmelreich käme‘, dieses Wort des göttlichen Kommunisten ist ein furchtbares Anathema und zeugt von seinem bitteren Hass gegen die Börse und haute finance von Jerusalem. Es wimmelt in der Welt von Philanthropen, es gibt Tierquälergesellschaften, und man tut wirklich sehr viel für die Armen. Aber für die Reichen, die noch viel unglücklicher sind, geschieht gar nichts. Statt Preisfragen über Seidenkultur, Stallfütterung und Kantsche Philosophie aufzugeben, sollten unsere gelehrten Sozietäten einen bedeutenden Preis aussetzen zur Lösung der Frage: wie man eine Kamel durch ein Nadelöhr fädeln könne? Ehe diese große Kamelfrage gelöst ist und die Reichen einen Aussicht gewinnen ins Himmelreich zu kommen, wird auch für die Armen kein durchgreifendes Heil begründet. Die Reichen würden weniger hartherzig sein, wenn sie nicht bloß auf Erdenglück angewiesen wären und nicht die Armen beneiden müßten, die einst dort oben in floribus sich des ewigen Lebens gaudieren. Sie sagen: Warum sollen wir hier auf Erden für das Lumpengesindel etwas tun, da es ihm doch einst besser ergeht als uns, und wir jedenfalls nach dem Tod nicht mit demselben zusammentreffen.“ Wüssten die Reichen, dass sie dort oben wieder in alle Ewigkeit mit uns zusammen hausen müssen, so würden sie sich gewiß hier auf Erden etwas genieren und sich hüten, uns gar zu sehr zu misshandeln. Laßt uns daher vor allem die große Kamelfrage lösen.“ (Heine, Lutetia, Sämtliche Werke hg. v. Briegleb, V, 453f) Danach aber setzt sich die Tendenz durch, das Gebot dahingehend zu mildern, nur etwas von dem Vermögen den Armen abzugeben. In einer Homilie des Clemens von Alexandrien wird die große Kamelfrage zuerst so gelöst, dass er den Satz nicht auf die äußere Weggabe des Besitzes bezieht, sondern auf die Seele und die Liebe zum Besitz. Es sind die Leidenschaften, die vom Heil abhalten. Reichtum ist an sich weder gut noch böse; man darf ihn nicht wegwerfen, sondern muss daraus ein Werkzeug der Gerechtigkeit machen. Freiwillige Armut wird zur Sache der besonders Frommen, der Mönche. Die reformatorische Auslegung wendet sich gegen diesen Ansatz, da dieser den im Mönchtum ausgeprägten katholischen Versuch verkörpere, durch eigene Werke das Leben zu erwerben. Der Reiche wird hier zum Prototyp des Gottlosen, der nach Werkgerechtigkeit strebt. Besitzverzicht aber wird abgelehnt. Luther stellt den Text geradezu auf den Kopf, wenn er sagt: Das Gebot Christi sei nicht, alles zu verlassen wie die Mönche, sondern mit dem eigenen Besitz für die Seinen zu sorgen. Für Max Weber schließlich wird die Forderung des Besitzverzichts zum Inbegriff jener Gesinnungsethik, die man nur ganz oder gar nicht befolgen kann. Als Maxime eines Politikers und als Forderung für jedermann wäre Mt 19,21 verantwortungslos und sinnlos.
Danach aber setzt sich die Tendenz durch, das Gebot dahingehend zu mildern, nur etwas von dem Vermögen den Armen abzugeben. In einer Homilie des Clemens von Alexandrien wird die große Kamelfrage zuerst so gelöst, dass er den Satz nicht auf die äußere Weggabe des Besitzes bezieht, sondern auf die Seele und die Liebe zum Besitz. Es sind die Leidenschaften, die vom Heil abhalten. Reichtum ist an sich weder gut noch böse; man darf ihn nicht wegwerfen, sondern muss daraus ein Werkzeug der Gerechtigkeit machen. Freiwillige Armut wird zur Sache der besonders Frommen, der Mönche. Die reformatorische Auslegung wendet sich gegen diesen Ansatz, da dieser den im Mönchtum ausgeprägten katholischen Versuch verkörpere, durch eigene Werke das Leben zu erwerben. Der Reiche wird hier zum Prototyp des Gottlosen, der nach Werkgerechtigkeit strebt. Besitzverzicht aber wird abgelehnt. Luther stellt den Text geradezu auf den Kopf, wenn er sagt: Das Gebot Christi sei nicht, alles zu verlassen wie die Mönche, sondern mit dem eigenen Besitz für die Seinen zu sorgen. Für Max Weber schließlich wird die Forderung des Besitzverzichts zum Inbegriff jener Gesinnungsethik, die man nur ganz oder gar nicht befolgen kann. Als Maxime eines Politikers und als Forderung für jedermann wäre Mt 19,21 verantwortungslos und sinnlos.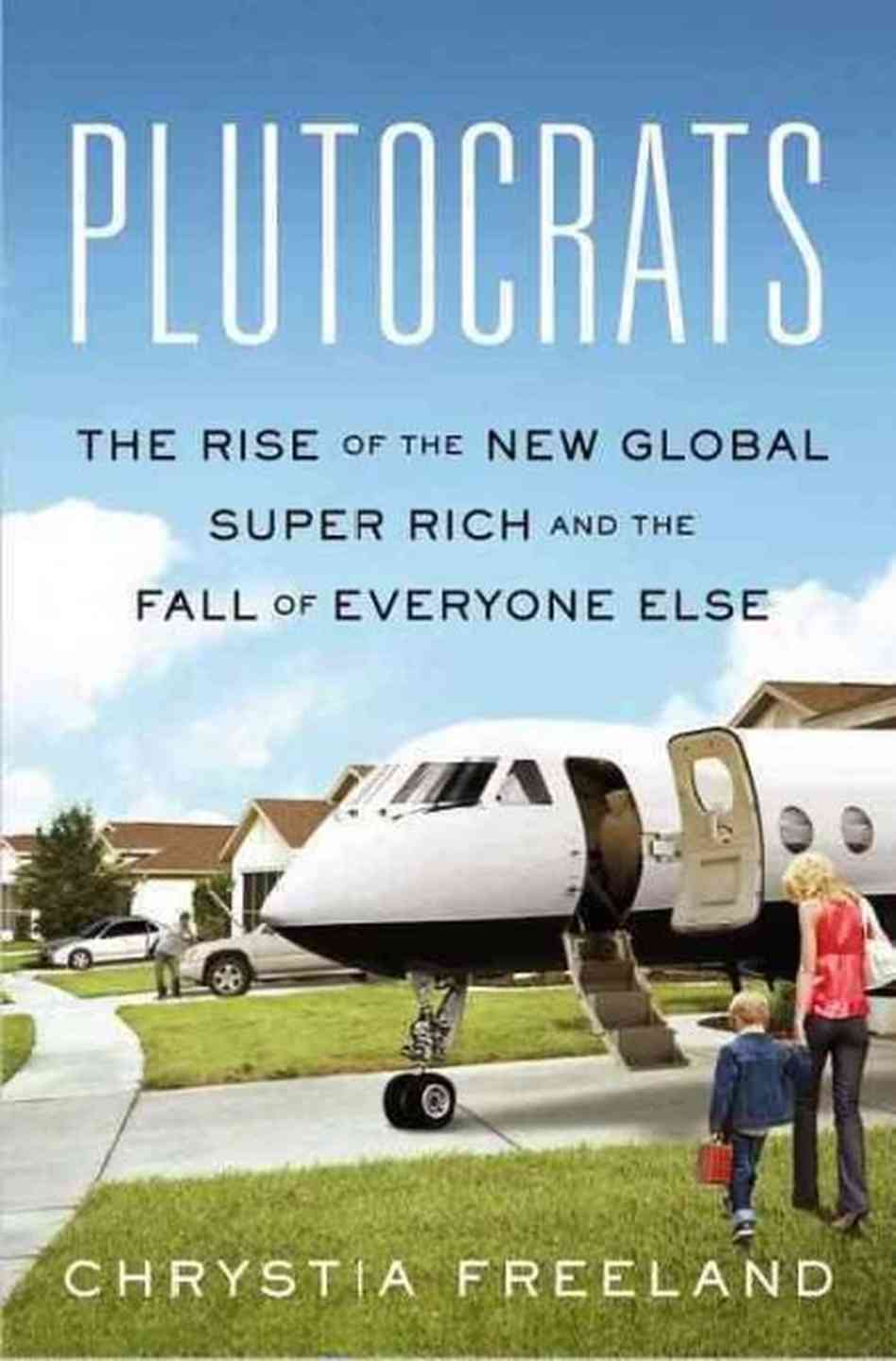 In ihrem 2012 erschienenen Buch The Plutocrats, zu deutsch: „Die Superreichen. Der Aufstieg der neuen globalen Superreichen und der Abstieg von jedermann“ schreibt die Journalistin Chrystia Freeland, dass ein Jahreseinkommen eines Managers von 68 Millionen Dollar oder ein Bonus eines Derivate-Spitzenhändlers verglichen mit den Einkommen der Chefs von Hedge-Fonds und Venture-Kapitalfirmen nur mittemäßig sei. Clans wie die Quandts in Deutschland konnte sich 2012 allein aufgrund ihres BMW-Pakets auf eine Dividende von 650 Millionen Euro freuen.
In ihrem 2012 erschienenen Buch The Plutocrats, zu deutsch: „Die Superreichen. Der Aufstieg der neuen globalen Superreichen und der Abstieg von jedermann“ schreibt die Journalistin Chrystia Freeland, dass ein Jahreseinkommen eines Managers von 68 Millionen Dollar oder ein Bonus eines Derivate-Spitzenhändlers verglichen mit den Einkommen der Chefs von Hedge-Fonds und Venture-Kapitalfirmen nur mittemäßig sei. Clans wie die Quandts in Deutschland konnte sich 2012 allein aufgrund ihres BMW-Pakets auf eine Dividende von 650 Millionen Euro freuen. Der Soziologe H. J. Krysmanski hat in seinem schon erwähnten Buch diesen Superreichtum mit einer Ringburg verglichen, in deren Mitte die 0,01 % Superreiche sitzen, Milliardäre wie Warren Buffet und Bill Gates – „eine völlig losgelöste und zu allem fähige soziale Schicht, welcher die Wissens- und Informationsgesellschaft alle Mittel in die Hände legt, um sich als neue gesellschaftliche Mitte zu etablieren.“ Um sie herum und als zweiter Ring gruppieren sich die Konzern- und Finanzeliten als Spezialisten der Verwertung und Sicherung des Reichtums. Den nächsten Funktionsring bilden die politischen Eliten, also die nationalen Regierungen, die sicherstellen dass der Reichtum von unten nach oben verteilt wird. Die größte Gruppe hält sich auf dem Außenring der Festung auf, die Funktions-und Wissenseliten aller Art, von Wissenschaftlern über die Techno-und Bürokraten bis zu den Unterhaltungseliten in Medien, Kultur und Sport. Während sich also die Reichen verschanzen und gleichzeitig ihren Einfluss auf Politik und Wirtschaft auszuweiten versuchen, häuft sich um die Ringburg das Konfliktpotential. Nach einer Studie des britischen Verteidigungsministeriums werden im Jahr 2037 60 % der Menschen weltweit in verslumten Städten um die Bankentürme sich zusammendrängen. Diese Konzentration von Not, Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit wird einen gewaltigen Sprengsatz darstellen. Auf der andern Seite betreiben die Superreichen Strategien der Reichtumsverwaltung und der weltweiten Vernetzung, die ihre Privilegien sichern sollen. Eine Forschergruppe der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich hat alle 43 060 transnationalen Konzerne und ihre Anteilseigner herausgefiltert und dabei festgestellt, dass es ein Cluster von 147 engverwobenen Unternehmen gibt, die meisten davon Finanzinstitutionen, die 40 % des gesamten Netzwerks beherrschen. Die Finanzkrise von 2008 hat allerdings gezeigt, dass dieses Netz nicht so stabil ist, wie es scheint. Auf der andern Seite sind die Superreichen ungeschoren aus der Krise herausgekommen. Einige Analytiker nehmen nun an, dass die Geldeliten sich weiter verselbständigen wollen. Sie beginnen, auf eigene Faust mit Söldner- Armeen sowie privaten Polizei-und Geheimdiensten zu kooperieren. So soll der russisch-britische Milliardär Abramowitsch auf seiner 475 Mill. teuren Megayacht Eclipse ein Raketenabwehrsystem installiert haben.
Der Soziologe H. J. Krysmanski hat in seinem schon erwähnten Buch diesen Superreichtum mit einer Ringburg verglichen, in deren Mitte die 0,01 % Superreiche sitzen, Milliardäre wie Warren Buffet und Bill Gates – „eine völlig losgelöste und zu allem fähige soziale Schicht, welcher die Wissens- und Informationsgesellschaft alle Mittel in die Hände legt, um sich als neue gesellschaftliche Mitte zu etablieren.“ Um sie herum und als zweiter Ring gruppieren sich die Konzern- und Finanzeliten als Spezialisten der Verwertung und Sicherung des Reichtums. Den nächsten Funktionsring bilden die politischen Eliten, also die nationalen Regierungen, die sicherstellen dass der Reichtum von unten nach oben verteilt wird. Die größte Gruppe hält sich auf dem Außenring der Festung auf, die Funktions-und Wissenseliten aller Art, von Wissenschaftlern über die Techno-und Bürokraten bis zu den Unterhaltungseliten in Medien, Kultur und Sport. Während sich also die Reichen verschanzen und gleichzeitig ihren Einfluss auf Politik und Wirtschaft auszuweiten versuchen, häuft sich um die Ringburg das Konfliktpotential. Nach einer Studie des britischen Verteidigungsministeriums werden im Jahr 2037 60 % der Menschen weltweit in verslumten Städten um die Bankentürme sich zusammendrängen. Diese Konzentration von Not, Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit wird einen gewaltigen Sprengsatz darstellen. Auf der andern Seite betreiben die Superreichen Strategien der Reichtumsverwaltung und der weltweiten Vernetzung, die ihre Privilegien sichern sollen. Eine Forschergruppe der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich hat alle 43 060 transnationalen Konzerne und ihre Anteilseigner herausgefiltert und dabei festgestellt, dass es ein Cluster von 147 engverwobenen Unternehmen gibt, die meisten davon Finanzinstitutionen, die 40 % des gesamten Netzwerks beherrschen. Die Finanzkrise von 2008 hat allerdings gezeigt, dass dieses Netz nicht so stabil ist, wie es scheint. Auf der andern Seite sind die Superreichen ungeschoren aus der Krise herausgekommen. Einige Analytiker nehmen nun an, dass die Geldeliten sich weiter verselbständigen wollen. Sie beginnen, auf eigene Faust mit Söldner- Armeen sowie privaten Polizei-und Geheimdiensten zu kooperieren. So soll der russisch-britische Milliardär Abramowitsch auf seiner 475 Mill. teuren Megayacht Eclipse ein Raketenabwehrsystem installiert haben.