
White Cube |
Clown in der DämmerungWolfgang Vögele
Nein. Peter Steinacker, der systematische Theologe und emeritierte Kirchenpräsident stellte in seinem Buch über Richard Wagner die These auf, in allen Opern Wagners, also auch im „Ring“ sei Erlösung das entscheidende Thema. Vom Holländer über Tannhäuser bis zu Wotan und Siegfried lässt sich eine lange Reihe von Figuren aufzählen, die diese These belegen. Tannhäuser, Parsifal und nicht zuletzt der „Ring“ selbst sind musikalische Erlösungsdramen, die Geschichten von der (scheiternden) Rettung der Menschen und Götter erzählen. Erlösung hat ohne Zweifel eine theologisch und eine politische Dimension, die einander durchdringen. Wagner war nun kein Theologe, der seine Thesen mit dem Taktstock verfochten hätte, aber er war ein Komponist, der mit seinen Opern eine theologische, politische und ästhetische Gesamtschau der Welt vorlegen wollte. Dort, wo Regisseure diese Dimensionen in ihren Inszenierungen ohne Belehrung aufnehmen, kann die Opernbühne in beglückender Weise zum Guckkasten für Debatten über Politik, Religion und Musik werden[1]. Ich wähle Mannheim als Beispiel. Am Nationaltheater ist ja mittlerweile seit 1957 Hans Schülers Inszenierung des „Parsifal“ zu sehen. An jedem Karfreitag pilgern bis heute die Wagnerianer in die Neckarstadt, um dort das Abendmahl in der Gralsburg zu sehen, getreu den Regieanweisungen des Komponisten, inklusive der Taube, die zu den Schlussakkorden in den Himmel schwebt. Der Blick auf die über fünfzig Jahre alte Inszenierung macht den Kontrast und die Entfernung von moderner Inszenierungspraxis deutlich. In Stuttgart, in Calixto Bieitos Inszenierung kniet am Ende der nackte Parsifal in einer apokalyptisch zertrümmerten Totenstadt. Auch das kann eine Gralsburg sein. Seit zwei Jahren steht in Mannheim auch ein „Lohengrin“ auf dem Programm. In dieser Inszenierung verwandelt sich das mittelalterliche Brabant zum demokratischen Parlament. Elsa wird zur fiesen Intrigantin, die sich nur zu gerne den Kriegstreibereien und außen- wie innenpolitischen Ränken von König Heinrich zur Verfügung stellt. Kein Wunder, dass Lohengrin seine berühmte Erzählung „In fernem Land, unnahbar euren Schritten liegt eine Burg, die Monsalvat genannt….“ in einer Pressekonferenz vor den Fernsehkameras singt. Er wendet sich stolz den Fotografen und Journalisten zu, bevor er sich nach seiner Rücktrittserklärung aus der Medienpräsenz wieder in die Mythenwelt zurückzieht. Am Ende stürmen dann Truppen mit Granatwerfer und Maschinenpistolen vom Publikum aus auf die Bühne. Und die Oper endet in einem Gemetzel. Wagnerianer denken ja bei „Lohengrin“ eher an den Schwan. Was Richard Wagner angeht, so schwankt Mannheim zwischen Provokation und Tradition. Was nun den neuen „Ring“ angeht, hat man sich für das erstere entschieden und damit allen, außer dem sehr konservativen Wagner-Publikum, einen großen Gefallen getan. Regie führt der Brecht-Schüler Achim Freyer, und mit beinahe 80 Jahren ist der Maler, Regisseur und Bühnenbildner es gewohnt, Buh-Rufe aus dem Parkett zu ertragen. Sein „Ring“ liegt nun mit der Premiere der „Götterdämmerung“ im Frühjahr 2013 (Trailer „Rheingold“ und „Walküre“) vollständig vor. Trailer "Das Rheingold" - Richard Wagner Trailer "Walküre" - Richard Wagner Die „Götterdämmerung“ ist ja die am meisten politische Oper des gesamten Zyklus. Der Göttervater Wotan, schon in „Siegfried“ (Trailer der Mannheimer Inszenierung) nur noch als schattenhafter Wanderer präsent, hat sich schmollend und besiegt aus der Lebenswelt der Menschen zurückgezogen. Nur noch die Raben als Götterboten berichten ihm davon, was die Menschen aus seinem Erbe gemacht haben. Das Verhältnis von Politik und Religion entscheidet sich an der Schlussszene, nach dem als Jagdunfall getarnten Mord an Siegfried. Die Götter- und Heldenburg Walhall und die Gibichungenhalle gehen in den Flammen des Weltenbrandes auf. Aber was kommt danach? Nach der Götter- und Menschenkatastrophe deutet sich doch noch ein Neuanfang an. Es könnte Besseres, Vernünftigeres, Aufklärenderes geschehen. Im berühmten Bayreuther Jahrhundert-„Ring“ von Patrice Chereau aus den achtziger Jahren steht am Ende das Volk auf der Bühne vor dem Publikum und blickt erwartungsvoll in seine (bessere?) Zukunft, während es bei den spanischen Artisten-Theatermachern von Fura dels Baus (Valencia 2008-2010) gar nicht mehr aufhören will zu brennen. Während bei Chereau das aufklärerische, um nicht zu sagen sozialdemokratische Element dominierte, blieb man in Valencia beim dauerhaft Katastrophischen, der ewigen Wiederkehr des Apokalyptischen, sozusagen Nietzsche für Akrobatik-Freaks. Bei Achim Freyer steht am Ende der nackte, unbeleuchtete und spiegelnde Bühnenraum. Der Brecht-Schüler kommt am Ende seiner Karriere wieder bei seinem Lehrer und dessen moralischem Lehrtheater an. Bei den letzten Akkorden von Wagners Musik ist die Bühne von Personen leer gefügt. Das strahlende, helle Licht verlischt langsam, und zu sehen ist nur noch die Bühne mit den Requisiten der Inszenierung. Das Spiel vorbei, die Protagonisten sind tot. Man könnte jetzt, zwischen Requisiten, Spiegelböden und Vorhängen noch einmal neu anfangen. Trailer "Götterdämmerung" - Richard Wagner „Götterdämmerung“ ist der Endpunkt einer Befreiungs-, aber nicht einer Erlösungsgeschichte. Vom „Rheingold“ bis zur „Götterdämmerung“ wird vor allem Wotan gezwungen, sich aus dem Raum der Menschen und damit aus dem Raum des Politischen zurückzuziehen. Seine Macht wird zuerst korrumpiert, dann beschnitten, dann gebrochen. Die Menschen, Siegfried vorneweg, gewinnen immer mehr Macht. Sie werden immer mächtiger, obwohl das Böse in Gestalt der Zwerge (Alberich und Hagen) noch präsent ist. Siegfried macht den Fehler, dass er sich nur auf seine physische Kraft und Macht verlässt. Mit der List und der Heimtücke Alberichs hat er nicht gerechnet. Diese Naivität kostet ihn das Leben. Am Ende der „Götterdämmerung“ haben sich die Menschen von den Göttern befreit, auch wenn überall noch Spuren ihres Einflusses und ihrer Macht zu sehen sind. Umgekehrt sind die Götter von den Menschen befreit worden, und sie dämmern nun als abwesende Geister in ihrer Machtlosigkeit. Siegfried ist zum furchtlosen Menschen, Wotan zum traurigen Gott (Peter Wapnewski) geworden. Aber weder mit Furchtlosigkeit allein noch mit Traurigkeit allein kann ein Mensch sein Glück machen. Freyer hat zum Ärger der Wagnerianer Siegfried als Clown ausstaffiert, mit Latzhose, knallgelbem Haar, roter Nase und ebensolchen, zum breiten Lachen geschminkten Lippen. Siegfried ist nicht nur Tor (wie Parsifal), sondern auch ein rechter Trottel, der falsch macht, was falsch zu machen ist. Siegfried ist ein Tolpatsch und darin – damit hätte man nun gar nicht gerechnet – dem Vogelfänger Papageno nahe, jener tumb volkstümlichen Antifigur im Aufklärungsspiel der „Zauberflöte“. Dabei fehlt es dem Clown Siegfried an der Verschlagenheit Hagens. Er ist ohne Arg und Bosheit, aber eben im Gegensatz zu Hagen auch ohne Vernunft und Kalkül, was seine Absichten und Handlungen von vornherein ins Leere laufen lässt. Die Götter, weil sie kraftlos geworden sind, können ihm nichts mehr anhaben, aber auf das Böse fällt er dafür umso gnadenloser herein. Und nicht einmal die Liebe der gefallenen Walküre Brünhilde bringt ihn zur Vernunft. Der Clown Siegfried ist bei Freyer eine dumme, kindliche Kampfmaschine, die schon mit dem neonfarbenen Starwars-Schwert fuchtelt, bevor sie überhaupt daran denkt, zur Vernunft zu kommen. So stellt man sich eigentlich einen erfolgreichen Manager in der midlife crisis vor, der sich einen Porsche mit Turbomotor und abnehmbarem Verdeck kauft. Nothung oder Carrera – das macht keinen so großen Unterschied. Und Freyer lässt es sich nicht nehmen, in die Gibichungen-Halle immer wieder die marktschreierischen Überschriften von Märkten für Unterhaltungselektronik einzublenden. Aber Siegfried besitzt ja schon seine Spielzeuge, den Ring, die Tarnkappe und das Horn, bei Freyer ein Plastiktrichter, den Siegfried lustig auf dem Kopf trägt. Kein Zuschauer kann diesen Siegfried ernst nehmen. Aber das ist ja auch die Aufgabe des Clowns, dass er seinen Zuschauern einen Spiegel entgegenhält, in dem sie sich selbst wieder erkennen. Und Spiegel stehen in großer Anzahl auf der Bühne. Freyers Siegfried steht für den gnadenlos selbstbezogenen Menschen, der ohne nachzudenken dem folgt, worauf er genetisch programmiert worden ist. Siegfried ist der unpolitische Mensch par excellence. Wobei das Politische in dieser Perspektive für das Soziale, Gemeinsame und Gemeinschaftliche stehen müsste. Aber Siegfried schlägt eben eher zu als sich mit seinen Freunden zu besprechen. Im Wald, als es gegen den Drachen ging, hat dieses Programm noch sehr gut funktioniert, in der Gibichungen-Gesellschaft muss Siegfried an dieser Selbstbezogenheit scheitern, zumal diese allzu menschliche Monarchie mit dem Bösen kontaminiert ist. In seiner clownesken Arglosigkeit ist Siegfried darauf allerdings nicht vorbereitet. Der böse Hagen muss sich nicht einmal Mühe geben, um den Clownshelden zu durchschauen. Der Clown Siegfried setzt allein auf seine Kraft. Er möchte lernen Angst zu haben, aber am Ende scheitert er daran, dass er von der Kraft seiner Vernunft keinen Gebrauch macht. Er wird vom Bösen überlistet: Hagen entdeckt die einzig verletzliche Stelle des Drachentöters. Mit Naivität und Gedankenlosigkeit kommt niemand an sein (politisches) Ziel. Brünnhilde, die Walküre, die von ihrem Vater Wotan wegen ihres Ungehorsams verstoßen wurde, unterscheidet sich von Siegfried in zwei Punkten. Zum einen ist sie fähig zur Liebe, auch wenn sie grausam getäuscht und betrogen wird. Zum anderen erkennt sie im Laufe dessen, was ihr an Unrecht in der „Götterdämmerung“ geschieht, welches böse Spiel hier gespielt wird. Brünnhilde scheitert daran, dass sie zwar das böse Spiel erkennt, aber nichts mehr dagegen tun kann. Brünnhilde ist eine doppelt tragische Figur, zum einen, weil sie von Wotan, ihrem Vater verstoßen wurde, zum anderen weil Siegfried, getäuscht durch den Trank der Vergesslichkeit, nicht zögerte, sie für seinen neuen Schwager Gunter zu erobern. Trotzdem hat Wagner ihr die entscheidende, die aufklärerische Aufgabe zugedacht: Sie besitzt genügend Distanz und Engagement, um das Verhängnis und die Tragik der Nibelungengeschichte zu durchschauen. Sie ist eine entfernte Schwester der trojanischen Seherin Kassandra. Am Ende stürzt sie sich ins Feuer. Den Menschen und sich selbst hat sie damit nicht geholfen. Die Menschen stehen am Ende des „Rings“ allein gelassen da und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie müssten sich selbst helfen. Freyers Botschaft lautet: Die Menschen sind zwar alle gestorben, aber die Bühne steht, die meisten Requisiten sind kaputt, aber man könnte alles wieder aufbauen. Wenn man das alles wieder aufbaut, könnte man dasselbe Spiel wiederholen oder ein neues Spiel anfangen – vielleicht auch jenseits der Bühne. Das Schlussbild bleibt – bewusst – nicht frei von Doppeldeutigkeit. Es vermeidet den sozialdemokratischen Aufklärungsoptimismus ebenso wie den apokalyptischen Pessimismus der Nietzscheaner. Für Wagner war der „Ring“ ein Stück über die Entmachtung der Götter und die Erfindung des Politischen aus dem Geist der Mythologie. Daran wären die Menschen beinahe gescheitert, weil ihnen die Bruchstücke der Götter- wie der Zwergenwelt noch um die Ohren flogen. In dieser Gemengelage mussten sie tragisch zugrunde gehen. Freyer macht den „Ring“ zum Märchen, zum von Psychologie vollständig befreiten Spiel der Märchentypen und Sagengestalten, die sich aus dem Schlamm der Mythenwelt freistrampeln und dabei gegenseitig vernichten. Und für dieses Spiel mit Typen, Gestalten, Walküren, Helden, Göttern und Halbgöttern findet Freyer nicht nur in der „Götterdämmerung“ grandiose Bilder. Dabei stehen im ganz einfache und gerade deswegen überzeugende Mittel zu Gebote: die Clownsmaske, aber vor allen Dingen die Puppen. In den ersten drei Teilen des „Rings“ wird nahezu jede Gestalt durch eine Puppe verdoppelt. Die Puppe ist der mythologisch oder theologisch besetzte, stellvertretende Mensch. Sie kann sich nicht aus sich selbst heraus bewegen. Der Puppenspieler, der Marionettengott muss ihre Bewegungen steuern und ihr damit Leben einhauchen. Und an diesem Gedanken wird ein zweites wichtig. In dieser Mannheimer „Götterdämmerung“ ist kein menschliches Gesicht zu sehen. Siegfried ist als Clown geschminkt. Hagens Gesicht ist mit weißer Schminke überzogen, sein Vater Alberich erinnert mit dem rechteckigen Oberlippenbärtchen an Hitler. Gunter und Gutrune sowie ihr Gefolge tragen Schwellköpfe. Freyer hat sich der Humanisierung der „Ring“-Erzählung konsequent verweigert. Man sah ja Wotan schon als zwielichtigen Manager mit Sonnenbrille, dunklem Anzug, dezenter Krawatte und Geldkoffer. Freyer erzählt von der Menschwerdung des Menschen in einer Mischung aus Mythologie und Märchen. Und das hat Folgen zuerst für die Bildregie und die Inszenierung und zweitens für den philosophischen Gehalt und, was hier besonders interessiert, für das Verhältnis von Politik und Religion. Die Verlagerung der „Ring“-Erzählung in die symbolische Sphäre des Märchenhaften und Mythologischen schafft eine surreale Traum- und Ideenwelt, die etwas Schwebendes und Unwirkliches hat. Freyers Inszenierung ist vollständig frei von Psychologie, er interessiert sich nicht für die Interaktionen der Menschen, Walküren und Zwerge. An die Stelle der „Handlung“, die sich im Grunde nur noch im Programmheft nachlesen lässt, tritt die Bühnenwelt der Bilder, des Lichtes und der Farben. Wenn Oper normalerweise in dem Dreieck von Musik, Libretto und Inszenierung nach einer ausgewogenen Balance sucht, so treten bei Freyer Text, Libretto und die erzählte „Geschichte“ in den Hintergrund, um im Zusammenspiel von Musik und Bildern, von Beleuchtung und Leitmotiven eine ebenso magische wie phantastische Welt zu schaffen, die Wagners ästhetischem Programm einer Remythologisierung und Religionisierung einer zwanghaft rationalen und bürokratischen Welt in besonderer Weise entgegenkommt. Man könnte das für eine Wiederkehr von Novalis‘ programmatischem Gedicht halten:
Aber Novalis‘ Heinrich von Ofterdingen wollte einen Rückzug in die Märchenwelt, während Freyer bei seinem Lehrer Brecht genügend Regievernunft gelernt hat. Er führt seinen Zuschauern die bewusst verfremdete, künstliche Bühnenwelt deutlich vor Augen. Freyer zeigt diese Bühnen- und Märchenwelt als geschaffene, als Kunstwerk und damit gewinnt er den nötigen ästhetischen Schwung, um Bühnenästhetik und politische Philosophie zu verknüpfen. Die „Ring“-Welt ist kein nostalgischer Regressionsraum, sondern ein Spiegel zurück in Märchen und Mythologie, um Tragik und Hoffnung menschlichen Lebens zu erklären und ihr zweitens auch eine hoffnungsvoll-hoffnungslose Wendung in die Zukunft zu geben. Der „Ring“ wird zur mythologisch-märchenhaften Vor-Geschichte des Politischen und des Sozialen, und die „Götterdämmerung“ ist dafür die Schnittstelle, der Übergang. Am Ende verwandelt sich der Mythos in Politik. Aus dem Konflikt zwischen Göttern und Menschen wird ein Konflikt der Menschen untereinander. Das ist allerdings mehr als ein Säkularisierungsdrama, in dem sich die menschlichen Marionetten von den Fäden ihrer göttlichen Puppenspieler befreien. Am Ende stehen die Menschen nicht zu ihrer eigenen Humanität befreit an der Rampe und brechen nicht in das Morgenlicht einer geläuterten Zukunft auf. In diesem Sinn ist die „Götterdämmerung“ gerade kein aufgeklärtes Revolutionsdrama. Stattdessen steht am Ende vielfacher tragischer Tod (Siegfried, Gunter, Brünnhilde, Hagen), auch der Tod der Götter. Aber dass die Götter in der mythischen Zeit gestorben sind, bedeutet nicht, dass die Menschen nun in der politischen Zeit sich der Marionettenfäden entledigt hätten. Das Politische wird am Ende der Götterdämmerung nicht als aufgeklärte Fortschrittsgeschichte, sondern als Muster gefährdeter, konfliktträchtiger Kooperation unter egoistischen, eigensinnigen Menschen sichtbar. Es gehört zu Richard Wagners Größe, dass er sich dem einfachen Ausweg eines naiven Fortschrittsoptimismus verweigert hat. Und es ist das Großartige an Freyers Inszenierung, dass sie diesen Übergang vom Mythos zur Politik in all ihrer Ambivalenz sichtbar gemacht. Die Auswege romantischer Regressionssehnsucht und eines aufgeklärten Optimismus sind versperrt. Die Götter wirken noch im Bewusstsein der Menschen, obwohl sie im Weltenbrand untergegangen sind. Genau hier liegt auch der ästhetische Ertrag der „Götterdämmerung“ für das Verhältnis von Politik und Religion. Der Mensch betritt die Bühne des Politischen nicht nackt, ohne Vorwissen und Vorkenntnisse. Er kommt auf diese Bühne mit einer Vorgeschichte des Mythischen, mit der Erfahrung der tragischen Befreiung von den Göttern im Rücken. Um zu handeln, um zu kooperieren und Ziele des Gemeinwohls zu erreichen, muss er sich dieser Geschichte bewusst sein, denn die alten Marionettenfäden des Numinosen haften noch immer an seinen Gliedmaßen und ziehen ihn manchmal in eine Richtung, in die er gar nicht gehen wollte. So bleiben am Ende, beim Weltenbrand verstörende Erkenntnisse: Jede Kraft zum Guten, sei es die Liebe oder die Vernunft, auch die Kooperation, kann sich in Böses verwandeln. Auch die toten Götter üben noch ihren verhängnisvollen Einfluss aus. Und schließlich: Auch wenn die Menschen zusammenarbeiten, bleibt diese Zusammenarbeit stets gefährdet. Mediennachweise
Anmerkungen[1] Es muss übrigens nicht immer Wagner sein. In Stuttgart läuft immer noch sehr erfolgreich eine szenische Aufführung von Bachkantaten unter dem Titel „Actus tragicus“ in einer sehr beeindruckenden Inszenierung des verstorbenen Baseler Regisseurs Herbert Wernicke. Vgl. dazu Wolfgang Vögele, Arien am Bügelbrett, http://wolfgangvoegele.files.wordpress.com/2010/11/alltag-im-guckkasten.pdf. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/83/wv02.htm
|
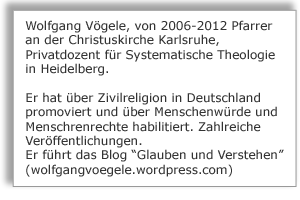 Über Richard Wagner und den „Ring des Nibelungen“ ist alles gesagt worden? Dutzende alter und neuer Inszenierungen des „Ring“ im Jubiläumsjahr 2013 können den überkommenen Deutungen nichts Neues hinzufügen? Ist Siegfried zu oft ermordet worden? Hat Hagen zu oft intrigiert? Sind Walhall und die Gibichungenhalle zu oft in Flammen aufgegangen? Gehören die Augenklappe, der Speer, die ausgestopften Raben, die Walkürenpanzer und das unbesiegbare Schwert Nothung nicht endlich auf den Requisiten-Verkaufstisch beim Theaterfest, am besten gleich zusammen mit Lohengrins Schwan und Tannhäusers grünendem Pilgerstab?
Über Richard Wagner und den „Ring des Nibelungen“ ist alles gesagt worden? Dutzende alter und neuer Inszenierungen des „Ring“ im Jubiläumsjahr 2013 können den überkommenen Deutungen nichts Neues hinzufügen? Ist Siegfried zu oft ermordet worden? Hat Hagen zu oft intrigiert? Sind Walhall und die Gibichungenhalle zu oft in Flammen aufgegangen? Gehören die Augenklappe, der Speer, die ausgestopften Raben, die Walkürenpanzer und das unbesiegbare Schwert Nothung nicht endlich auf den Requisiten-Verkaufstisch beim Theaterfest, am besten gleich zusammen mit Lohengrins Schwan und Tannhäusers grünendem Pilgerstab?