
VIEW |
LektürenAuf dem Tisch der RedaktionAndreas Mertin
In der Sache ist es vorrangig um Konsens bemüht, Kontroverstheologisches findet sich eher selten. Trotzdem scheint im Nebeneinander der Artikel manchmal die deutliche Unterschiedlichkeit der Positionen auf, wenn etwa im Artikel „Menschrechte, islamisch“ das Verbot des außerehelichen Geschlechtsverkehrs als Beitrag zur Achtung von Menschenrechten und Menschenwürde charakterisiert wird. Die Themen „sexuelle Selbstbestimmung“ und „Homosexualität“, die heute zentral zur Frage der Menschenrechte gehören werden in beiden Artikeln zum Thema Menschenrechte ausgeklammert. Das ist vielleicht in Bezug auf die binnenreligiösen Debatten nachvollziehbar, zeigt aber auch die Differenz zwischen säkularer Gesellschaft und den religiösen Positionen allzu deutlich auf. Das wird in den unterschiedlich akzentuierten und vorsichtig formulierten Artikeln zum Stichwort „Homosexualität“ noch deutlicher. Ich hätte mir auch bei anderen Stichworten, wie zum Beispiel im Blick auf die Abbildbarkeit Jesu, die ja sowohl zwischen den beiden Religionen wie innerchristlich zwischen den Konfessionen strittig ist, präzisere Hinweise gewünscht. [Hier zeigt ein Blick auf die fortdauernden weltweiten Debatten zur Abbildbarkeit der Propheten in der Wikipedia welche Bedeutung dieses Lemma interreligiös inzwischen hat.] Der Artikel zum Thema Bild ist leider ein Beispiel, das meines Erachtens nicht den aktuellen Stand der fachwissenschaftlichen Diskussion wiedergibt (etwa wenn es unpräzise einen Konnex zwischen dem Bilderverbot und der Imago-Dei-Lehre herstellt). Hilfreich wäre auch eine etwas breitere Basis der Beiträger gewesen, es überrascht doch, wie viele äußerst unterschiedliche Artikel vom selben Autor verfasst wurden. Das aber trübt den guten Gesamteindruck dieses Buches nicht, man wünschte sich weitere derartige Lexika zu verschiedenen Dialogen zwischen Religionen und Konfessionen. Wie wichtig dieses Anliegen einer auf der vergleichenden Erarbeitung diverser Lemmata beruhenden Dialogarbeit ist, wird deutlich, wenn man parallel in der Presse die völlig anders gearteten Äußerungen mancher Kirchenvertreter liest. Etwa wenn laut katholischer Presseagentur der ägyptische Jesuit Samir Khalil Samir (zugleich als Vatikan-Berater etikettiert) grundsätzlich dekretiert: Der theologische Dialog mit Muslimen sei weitgehend sinnlos und man sei den Muslimen stattdessen Mission schuldig. [Update: Samir Khalil Samir hat mir geschrieben, dass die Darstellung seiner Ansichten durch die katholische Presseagentur Wiens völlig sinnentstellend sei. Dies sei nicht, was er vertreten habe und auch nicht vertreten würde. Dementsprechend sind auch meine Schlussfolgerungen aus der Darstellung der von der österreichischen Bischofskonferenz getragenen Presseagentur KPA unzutreffend. Dies sei den Leserinnen und Lesern des Magazins explizit mitgeteilt. Ich hoffe, dass auch die KPA ihre dementsprechende Darstellung ändert.] Zum Hintergrund der Genese des Buchprojekts schreiben Verlag und Herausgeber: „Bei ihrer Suche nach geeigneten Gesprächspartnern für den wissenschaftlich-theologischen Dialog ergab sich für die Eugen-Biser-Stiftung im Jahre 2005 die Gelegenheit, gemeinsam mit der Islamisch-Theologischen Fakultät der Universität Ankara – Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi – abwechselnd in Ankara und München Symposien zu Grundpositionen des heutigen christlichen bzw. islamischen Selbstverständnisses durchzuführen. Auf diesen Veranstaltungen, bei denen sich die muslimischen Wissenschaftler der türkischen, die christlichen der deutschen Sprache bedienten, sahen sich hochqualifizierte Übersetzer vor außerordentliche Probleme gestellt: Es fehlten auf beiden Seiten entsprechende Referenzwerke. Diese Lücke zu schließen, war das Gebot der Stunde.“ ... „In dem Werk erklären 24 deutsche und 64 türkische Wissenschaftler rund 330 Grundbegriffe jeweils aus christlicher und islamischer Sicht und beleuchten auch die gesellschaftlichen Grundpositionen beider Religionen. Entstanden ist das Werk in einem wohl einzigartigen Kontext interreligiöser Zusammenarbeit. Von A wie Abendmahl, Aberglaube, Abtreibung oder Adam und Eva bis Z wie Zwangsheirat, Zorn Gottes, Zeitrechnung oder den Zehn Geboten finden Interessierte in dem ca. 850 Seiten umfassenden, zweibändigen Lexikon Antworten. Das Werk erscheint zeitgleich in einer türkischen Ausgabe im Verlag der Universität Ankara.“
Wolfgang Huber, Professor für Systematische Theologie, Bischof von Berlin, Ratsvorsitzender der EKD, „profilierter Vordenker in ethischen Fragen“ hat jedenfalls einige Antworten parat, die er in seinem jüngsten Buch vorstellt und vermitteln will. Abgesehen von der Einleitung geht es in 19 Kapiteln um Fragen der Familie, der Sexualität, der Anthropologie, der Gerechtigkeit, der Medienwelt, der Politik und der letzten Dinge. Jedes unter einem Stichwort stehende Kapitel beginnt mit einer exemplarischen Situationsschilderung, der sich dann ethische Reflexionen anschließen. Im ersten Kapitel geht es um die grundsätzliche Frage der Bedeutung von Ethik. Ethik als normatives System ist in der Moderne und spätestens in der Postmoderne erodiert. Huber wendet sich mit seinen Überlegungen erkennbar an ein breites Publikum. Das macht aber auch die Problematik aus. Wenn ich in einer Vorlesung an einer theologischen Fakultät über Ethik spreche, habe ich ein Publikum vor mir, von dem ich unterstellen kann, dass es wesentliche Grundannahmen mit mir teilt. Ähnliches gilt in der Gemeinde. Aber es ist nicht in der Gesellschaft vorauszusetzen, die sich eher in einem post-säkularen Zustand befindet. Hier gilt, was Habermas 2001 in seiner Paulskirchenrede über „Glauben und Wissen“ zur Explikation religiöser Gehalte in postsäkularen Gesellschaften gefordert hat: Dass deren Redeformen so transformiert werden, dass sie auch von denen nachvollzogen werden können, die nicht die religiösen Voraussetzungen teilen. Wenn also Huber auf Seite 14 seines Buches im Kontext der allgemeinmenschlichen Erfahrung, dass wir als Menschen immer schuldig werden, schreibt „In dieser Erfahrung tritt uns vor Augen, was grundlegend das Gottesverhältnis des Menschen prägt. Vor Gott kann sich kein Mensch der Bedingtheit seiner Freiheit entziehen“ – dann wäre ich an dieser Stelle als säkularer Mensch einigermaßen ratlos. Ist Gott hier eine objektive Größe, die mir gegenüber tritt? Ist Gott eine Deutungskategorie, mit der das allgemeinmenschliche Schuldphänomen angemessener (oder auch kulturell kontextuell) verstanden werden kann? Oder beschreibt Huber hier nur, wie Christen ihr Gottesverhältnis erfahren und sucht dies auf die allgemein menschliche Schulderfahrung anzuwenden? Wie erläutert man als christliche Ethik er Umwelt, die an biblische Bindungen nicht mehr zu glauben vermag? Huber geht Schritt für Schritt vor und sucht an den Grundfragen des Lebens die christliche Perspektivierung ethischer Fragen plausibel zu machen. Ein bisschen geht es mir dabei freilich wie in dem kurzen Gedicht von Ernst Meister: Am Meer / ein Lachen, sie haben / den Fisch gefangen, der spricht. / Doch er sagt, / was jedermann meint. Das Problem der christlichen Ethik ist vielleicht, dass sie zum einen elementarer Bestandteil der allgemeinen Erthik geworden ist und zum anderen kaum noch Kontroversen auslöst. Die Fragezeichen und die Ausrufezeichen, die Huber setzt, sind oftmals die des Common Sense. Einen Skandal bilden die christlichen Reflexionen zur Ethik kaum noch. Oftmals sind sie fast schon in bestürzender Weise bürgerlich. Etwa wenn Huber im siebten Kapitel von der Kultur als Grundnahrungsmittel schreibt. Dieser Begriff ist mir allerdings wie der Begriff des Genusses zu verkürzt. Wir können nicht ohne Nahrung, wohl aber durchaus ohne Kultur existieren, jedoch können wir nicht ohne Kultur leben. Deshalb würde ich eher von der Kunst als einem Überlebensmittel sprechen. Ob dann tatsächlich die Sprache das signifikant Unterscheidende des Menschen vom Tier und vor allem ein Charakteristikum des Homo Sapiens ist, lässt sich meines Erachtens mit guten Gründen bezweifeln. Mir scheint das künstliche Schaffen von Bildern eine wesentlich spezifischere Differenzierung des heutigen Menschen darzustellen. Am Anfang des Homo Sapiens war nicht das Wort (das er mit dem Neandertaler teilt), sondern das Bild. Hier müsste gerade eine protestantische Ethik nach dem Iconic turn bzw. dem Visualistic turn noch einmal neu nachdenken. Die praktischen Konsequenzen aber, die Huber im Blick auf die Kunst und Kultur aus seinen Reflexionen zieht, sind dann aber doch sehr konventionell: eine Aufforderung zum Musizieren und zum selber Kunst machen. Das ist mir ehrlich gesagt zu allgemein und zu banal. Die ethischen Gründe für eine Auseinandersetzung mit der Ästhetik, die doch spätestens seit Kierkegaard das Christentum bewegt, hätten mich hier mehr interessiert, als allgemeine kulturpolitische Verlautbarungen. Der Aufstand des Schönen gegen das bürgerlich Gute, den Adorno z.B. in den Minima moralia skizziert: inwieweit ist dieser auch noch in einer theologischen Ethik des 21. Jahrhunderts relevant? Aber das sind nur marginale Einwände. In der Sache und mit Blick auf das breite Publikum ist dieses Buch ein Gewinn für die öffentliche Auseinandersetzung. Oberthür, Rainer; Nascimbeni, Barbara (2013): Das Vater unser. Stuttgart, Wien: Gabriel.
Aber ermutigt durch Oberthürs entschiedenes Plädoyer für das subjektive Geschmacksurteil sage ich frei heraus, dass mir das vorliegende Bändchen über das Vaterunser nicht gefällt. In der Geschichte des Christentums gibt es im Vergleich zu anderen Motiven der religiösen Überlieferung nur wenige Visualisierungen des Vaterunsers. Und das hat seinen Grund. Zum einen wird das Vaterunser ja in der Regel im Gottesdienst, selten aber im häuslichen Kontext (anders als Tisch- oder Nachtgebete) verwendet (auch wenn die Kapitularien Karls des Großen anordnen, niemand dürfe Taufpate werden, der das Vater unser nicht auswendig aufsagen kann). Es gehört in der Tradition des Christentums eher zu den rituellen Gebeten (wie auch das Glaubensbekenntnis), also zu den Gebeten, die man durch Teilhabe am Gottesdienst erlernt. Die Grundanlage des ersten Teils des Buches (Du fragst ... der Autor antwortet) ist typisch kirchlich, aber wie ich finde in einer unangenehmen Art. Die Fragen, die das Kind dabei stellt, sind in der Regel solche, von denen Theologen es gerne hätten, dass Kinder sie stellen, damit sie ihre theologischen Weisheiten vermitteln können. Deshalb kommt eine Frage wie „Warum ist Gott grün?“ in dem Buch leider nicht vor. Sondern nur: „Du fragst: Was kann ich zu Gott sagen, wenn mir die Worte fehlen?“ Und die Antworten sind dann derart, dass selbst Erwachsene damit Probleme haben dürften. Etwa wenn der Autor schreibt Gott käme in der Schönheit zur Geltung. Warum hatte dann Christus nach der Überlieferung der Kirche „keine Schönheit und Gestalt“? Warum wählte Gott die Niedrigkeit der Magd, warum bevorzugt er eine Ästhetik der Verklärung des Gewöhnlichen? Gott ist gerade kein Gott der Schönheit (wie bei den Griechen), sondern einer mit dem Blick dorthin, wo andere nicht gerne hinschauen (vgl. Luthers Auslegung des Magnifikat). Sicher für Kinder klingt das gut, wenn man Schönheit mit Gott verknüpft, aber schon die Alte Kirche hatte ihre Probleme damit. Man kann in dieser Frage keine guten Lösungen anbieten, und sollte deshalb darauf verzichten.
Der Verlag bewirbt seine Bücher mit dem Slogan: Bücher, die Werte vermitteln. Ja, diese Intention ist auch hier erkennbar. Aber welche Werte werden dabei vermittelt? Wenn es etwa unter der Überschrift „Geheiligt werde Dein Name“ heißt: „Jahwe ... Wir dürfen dich bei deinem Namen nennen“ und auf der Abbildung daneben der (doch nur wissenschaftlich rekonstruierte) Eigenname Gottes gemalt ist, dann finde ich das gelinde gesagt religiös höchst unsensibel. Das Neue Testament jedenfalls achtet die Zehn Gebote, indem es das Tetragramm nicht verwendet, sondern kyrios „die griechische Wiedergabe eines hebräischen Ersatzwortes für den Gottesnamen“ einsetzt. Ich fände es einen guten Beitrag zur religiösen Erziehung von Kindern, wenn in dieser Frage ein Konsens mit dem Judentum hergestellt würde. Auf der anderen Seite wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn unter den genannten und gemalten Namen auch „Allah“ gestanden hätte, wie arabischsprachige Juden und Christen Gott seit jeher genannt haben, sogar – wie die Archäologie uns zeigt – schon vor dem Islam. Die visuelle Gestaltung des Buches ist ein Zwischending aus Illustration und moderner Ausgestaltung (s. Coverabbildung). Ich finde sie ehrlich gesagt nicht wirklich inspirierend im Sinne eines kindlichen Entdeckungszusammenhangs bzw. eines visuellen Impulses für das Gespräch zwischen Eltern und Kind. Die Materialität der Bilder spielt nur selten eine Rolle, sie sind aber auch nicht wirklich narrativ, eher schmückendes Beiwerk. Das ist eine verpasste Chance. Der Blick auf die wenigen Kunstwerke bzw. Illustrationen zum Vater unser aus früheren Jahrhunderten (z.B. von Lukas Cranach) zeigt, dass es auch anders geht. Entsprechend der vorwiegend didaktischen Tradition des christlichen Glaubens waren diese Bilder natürlich zum Memorieren des Gebets gedacht und sind in der Gestaltung aus heutiger Sicht sicher nicht mehr zeitgemäß, haben aber den Vorteil, dass sie durch ihre didaktische Anlage verdeutlichen, dass das Vater Unser in faszinierender Weise mit den anderen Geschichten des Neuen Testaments und der Lehre Jesu zusammenhängt. Große, Jürgen (2013): Der gekränkte Mensch. Metaphysische Miniaturen. Zweiter Band. Leipzig: Leipziger Literaturverlag.
Ich bin nun nicht der Meinung des Philosophen Markus Gabriel, dass jede Philosophie unmittelbar aus sich heraus verständlich zu sein habe, aber sie sollte sich wenigstens bemühen, eine gemeinsame Sprache mit den Adressaten zu finden. Beim vorliegenden Buch „Der gekränkte Mensch“ fällt es mir allerdings außerordentlich schwer, dem Autor zu folgen und ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt. Zum einen erscheint mir seine Art des Schreibens sehr dunkel, zum anderen tauchen die von ihm beschriebenen Tatbestände in meiner Lebenswelt kaum auf. Wenn er zum Beispiel von der Bürgerlichkeit des Christentums schreibt, frage ich mich, welchen historischen Zeitabschnitt er damit meint - doch nicht das 21. Jahrhundert? Das mag alles seine Berechtigung für die Zeit zwischen 1800 und 1970 gehabt haben, aber geht heute doch arg an den Wirklichkeiten vorbei, in denen das Bürgertum längst in zahlreiche Milieus aufgespalten ist. Auch die umstandslose Verknüpfung von Innerlichkeit und Protestantismus erscheint mir überholt. Ja, das Betroffenheitspathos findet man bei Evangelischen Akademien in modifizierter Form immer noch, nicht aber den Jargon der Eigentlichkeit. Ich finde, man kann das 19. Jahrhundert auch zu ernst nehmen und man kann in dessen Sprache ertrinken. Dabei meine ich nicht, dass hier lax gedacht wird – ganz im Gegenteil, die Reflexionsformen sind höchst komplex. Vielleicht ist es der Duktus des Verwerfenden Denkens, der mich stört. Oder der dekretierende Sprachstil. Auch die späte Krise der Weisheit in der hebräischen Bibel ist pessimistisch, aber drückt das in einer Sprachform aus, die sich eher der Klage und nicht der Anklage annähert. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt er auch, und haben alle einerlei Odem, und der Mensch hat nichts mehr als das Vieh ... |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/85/am452.htm
|
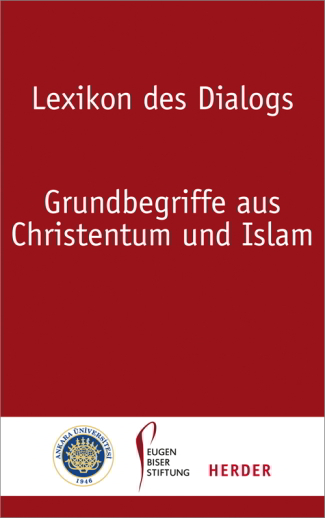 Bücher wie dieses sind in unserer Zeit überaus wichtig, denn wenn etwas den öffentlichen Diskurs kennzeichnet, dann die Unkenntnis über die Ansichten und Lehren der jeweils anderen Religion. Während wir im Bereich der Konfessionen schon weit gekommen sind – gerade auch auf der Ebene des Alltags und der Nachbarschaft –, ist das zwischen den Religionen noch selten der Fall. Hier dominiert das Vorurteil. Das hier vorgelegte Lexikon zum Dialog zwischen Christentum und Islam geht nun tatsächlich dialogisch vor, indem es zu den wichtigsten Stichworten des Christentums und des Islam die jeweilige Lehre durch wissenschaftliche Vertreter der Religionen vorstellen lässt. Das ist gerade auch im alltäglichen Gespräch außerordentlich hilfreich, weshalb das Lexikon in keiner Gemeindebibliothek fehlen sollte.
Bücher wie dieses sind in unserer Zeit überaus wichtig, denn wenn etwas den öffentlichen Diskurs kennzeichnet, dann die Unkenntnis über die Ansichten und Lehren der jeweils anderen Religion. Während wir im Bereich der Konfessionen schon weit gekommen sind – gerade auch auf der Ebene des Alltags und der Nachbarschaft –, ist das zwischen den Religionen noch selten der Fall. Hier dominiert das Vorurteil. Das hier vorgelegte Lexikon zum Dialog zwischen Christentum und Islam geht nun tatsächlich dialogisch vor, indem es zu den wichtigsten Stichworten des Christentums und des Islam die jeweilige Lehre durch wissenschaftliche Vertreter der Religionen vorstellen lässt. Das ist gerade auch im alltäglichen Gespräch außerordentlich hilfreich, weshalb das Lexikon in keiner Gemeindebibliothek fehlen sollte. Wer würde nicht zugreifen, wenn ihm ein Buch „Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen unseres Lebens“ verspräche? Mich würde das allein schon deshalb interessieren, weil ich nach 55 Jahren auf dieser Erde immer noch nicht weiß, was denn die wirklich wichtigen Fragen des Lebens sind. Ich entnehme der Formulierung, dass es zahlreiche Fragen des Lebens gibt, aus denen sich einige wichtige herausdestillieren lassen, von denen dann wiederum wenige (20 im vorliegenden Fall) als „wirklich wichtige“ bezeichnet werden können, während die restlichen dementsprechend nur scheinbar wichtig sind. Vermutlich wäre schon viel gewonnen, wenn wir uns unter vernünftigen Bürgern auf die wichtigen zu stellenden Fragen einigen könnten. Aber ich bin skeptisch, ob uns das gelänge. Antworten freilich gibt es viele und geben viele und mich treibt die Frage um, von wem ich denn aus welchen Gründen auf welche Fragen zu Recht Antworten erwarten soll.
Wer würde nicht zugreifen, wenn ihm ein Buch „Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen unseres Lebens“ verspräche? Mich würde das allein schon deshalb interessieren, weil ich nach 55 Jahren auf dieser Erde immer noch nicht weiß, was denn die wirklich wichtigen Fragen des Lebens sind. Ich entnehme der Formulierung, dass es zahlreiche Fragen des Lebens gibt, aus denen sich einige wichtige herausdestillieren lassen, von denen dann wiederum wenige (20 im vorliegenden Fall) als „wirklich wichtige“ bezeichnet werden können, während die restlichen dementsprechend nur scheinbar wichtig sind. Vermutlich wäre schon viel gewonnen, wenn wir uns unter vernünftigen Bürgern auf die wichtigen zu stellenden Fragen einigen könnten. Aber ich bin skeptisch, ob uns das gelänge. Antworten freilich gibt es viele und geben viele und mich treibt die Frage um, von wem ich denn aus welchen Gründen auf welche Fragen zu Recht Antworten erwarten soll. Der Zufall will es, dass ich an dem Tag, an dem dieses Buch zur Rezension eintrifft, auch einen anderen Text des Autors auf den Schreibtisch bekomme, eine Annäherung an Bildende Kunst bei Grundschulkindern. Und darin artikuliert Rainer Oberthür, dass er sich im Blick auf die Kunstannäherung wenig um das Urteil von Experten schert, also darum, was diese für das Überliefernswerte aus der kulturellen Tradition halten, sondern dass er den subjektiven Zugang zu Kunstwerken bevorzuge. Nun ist der Grundsatz, dass man nur das plausibel vermitteln kann, was einem selber einleuchtet, ja durchaus nachvollziehbar. Aber das muss ja nicht gleich mit einer Spitze gegenüber den Experten der kulturellen Überlieferung verbunden werden, denn auch diese Haltung teilt sich im pädagogischen Prozess mit. Wozu Experten, wenn subjektiver Zugang reicht? Und im Blick auf die beobachtbaren Ergebnisse eines derartigen privatisierten Zugangs zur Kultur bereitet es mir schon Sorgen.
Der Zufall will es, dass ich an dem Tag, an dem dieses Buch zur Rezension eintrifft, auch einen anderen Text des Autors auf den Schreibtisch bekomme, eine Annäherung an Bildende Kunst bei Grundschulkindern. Und darin artikuliert Rainer Oberthür, dass er sich im Blick auf die Kunstannäherung wenig um das Urteil von Experten schert, also darum, was diese für das Überliefernswerte aus der kulturellen Tradition halten, sondern dass er den subjektiven Zugang zu Kunstwerken bevorzuge. Nun ist der Grundsatz, dass man nur das plausibel vermitteln kann, was einem selber einleuchtet, ja durchaus nachvollziehbar. Aber das muss ja nicht gleich mit einer Spitze gegenüber den Experten der kulturellen Überlieferung verbunden werden, denn auch diese Haltung teilt sich im pädagogischen Prozess mit. Wozu Experten, wenn subjektiver Zugang reicht? Und im Blick auf die beobachtbaren Ergebnisse eines derartigen privatisierten Zugangs zur Kultur bereitet es mir schon Sorgen. Ich glaube, dass Kindern das Vater Unser als gesprochenes Wort reicht. Wenn wir es aber erläutern wollen, dann müssen wir uns von der rituellen Sprachversion lösen und zu anderen Sprachformen übergehen: Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel. Stattdessen zu sagen „Vater, Du bist da für uns ... als Vater und Mutter“ erzeugt nur heillose Verwirrung. Und wenn ich Kindern dann noch mühsam erklären muss, dass kontrafaktisch der Himmel gar nicht da oben sondern eigentlich überall ist, dann wird es wirklich verquast. Doch, das war das Weltbild des Vater Unsers, aber es ist natürlich nicht mehr unseres. Wenn ich aber Kindern von Anfang an vermittle, dass der Himmel nicht „da oben“ sei, wie erkläre ich dann die traditionellen Bilder aus der Geschichte des Christentums – etwa von der Himmelfahrt oder der Aufnahme Marias in den Himmel? Nicht wirklich „da oben“, aber irgendwie doch?
Ich glaube, dass Kindern das Vater Unser als gesprochenes Wort reicht. Wenn wir es aber erläutern wollen, dann müssen wir uns von der rituellen Sprachversion lösen und zu anderen Sprachformen übergehen: Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel. Stattdessen zu sagen „Vater, Du bist da für uns ... als Vater und Mutter“ erzeugt nur heillose Verwirrung. Und wenn ich Kindern dann noch mühsam erklären muss, dass kontrafaktisch der Himmel gar nicht da oben sondern eigentlich überall ist, dann wird es wirklich verquast. Doch, das war das Weltbild des Vater Unsers, aber es ist natürlich nicht mehr unseres. Wenn ich aber Kindern von Anfang an vermittle, dass der Himmel nicht „da oben“ sei, wie erkläre ich dann die traditionellen Bilder aus der Geschichte des Christentums – etwa von der Himmelfahrt oder der Aufnahme Marias in den Himmel? Nicht wirklich „da oben“, aber irgendwie doch? Im Buch von Große geht es um „die gekränkte Humanität auf verschiedenen Lebensgebieten“. Dazu bietet es zunächst eine „Phänomenologie der Kränkung“ und dann eine „Genealogie der Demütigung“. Der Stil des Schreibens ist dicht und weit ausgreifend zugleich. Sätze wie der folgende lassen zwar irgendwie ahnen, was gemeint ist, sind aber zugleich so formuliert, dass sie möglichst nebulös bleiben: „Nicht erst im gegenwärtigen Weltalter fühlt man sich durch Anblick und Anmutungen der Liebenswürdigkeit provoziert, wenn nicht gekränkt. Die Liebenswürdigkeit bedeutet ja jene fadenfeine Verwicklung mit Weltstoff, die alles Mönchtum und Nonnenwesen seit je verabscheuten. Heilige Geister und gekränkte Körper streiften die Gefühligkeit ab, die in die Welt zieht, gefühllos wurden sie unverwundbar. Sie waren nicht länger zu kränken.“ (66) Wer nicht kommuniziert, kann nicht gekränkt werden. Was aber ist eine „fadenfeine Verwicklung mit Weltstoff“? Weder Nonnen noch Mönche fliehen die Welt, ihr Gelübde verpflichtet sie gerade zum Dienst an der Welt. Sie unterscheiden sich nur im Selbstverständnis von der Welt. Gemeint sind vermutlich Eremiten oder Anachoreten.
Im Buch von Große geht es um „die gekränkte Humanität auf verschiedenen Lebensgebieten“. Dazu bietet es zunächst eine „Phänomenologie der Kränkung“ und dann eine „Genealogie der Demütigung“. Der Stil des Schreibens ist dicht und weit ausgreifend zugleich. Sätze wie der folgende lassen zwar irgendwie ahnen, was gemeint ist, sind aber zugleich so formuliert, dass sie möglichst nebulös bleiben: „Nicht erst im gegenwärtigen Weltalter fühlt man sich durch Anblick und Anmutungen der Liebenswürdigkeit provoziert, wenn nicht gekränkt. Die Liebenswürdigkeit bedeutet ja jene fadenfeine Verwicklung mit Weltstoff, die alles Mönchtum und Nonnenwesen seit je verabscheuten. Heilige Geister und gekränkte Körper streiften die Gefühligkeit ab, die in die Welt zieht, gefühllos wurden sie unverwundbar. Sie waren nicht länger zu kränken.“ (66) Wer nicht kommuniziert, kann nicht gekränkt werden. Was aber ist eine „fadenfeine Verwicklung mit Weltstoff“? Weder Nonnen noch Mönche fliehen die Welt, ihr Gelübde verpflichtet sie gerade zum Dienst an der Welt. Sie unterscheiden sich nur im Selbstverständnis von der Welt. Gemeint sind vermutlich Eremiten oder Anachoreten.