Sättigung für Augenblicke
Filmische Bildinszenierungen und der Zusammenhang von Film, Zeit und Religion[1]
Jörg Herrmann
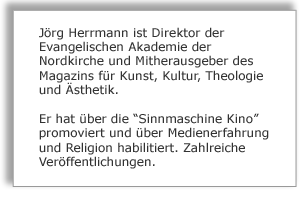 Der italienische Regisseur Federico Fellini hat einmal gesagt: „Das Kino ist eine göttliche Art und Weise, das Leben zu erzählen, dem Herrgott Konkurrenz zu machen.“ Fellinis Charakterisierung des Kinos scheint mir nach wie vor zutreffend zu sein. Das wird nicht zuletzt dann deutlich, wenn man über das Verhältnis von Film und Zeit nachdenkt. Denn der Film vermag wie kein anderes Medium, Zeit zu simulieren und zu inszenieren. Er kann ein Leben oder ein Jahrhundert auf 90 Minuten verdichten. Er kann uns Jahrtausende zurückversetzten oder uns einen glaubhaften Blick in die ferne Zukunft werfen lassen, er kann seine Geschichte linear erzählen oder sie mit Hilfe von Rückblenden und Sprüngen auf die Leinwand bringen. „So handelt es sich beim Film“, so die Filmwissenschaftlerin Kerstin Volland, „nicht um ein zeit-mimetisches, sondern um ein zeit-schöpferisches Medium“[2] – zeit-schöpferisch dem Herrgott Konkurrenz machend. Was das konkret bedeutet, kann man zum Beispiel bei Regisseuren wie Christopher Nolan oder auf ganz andere Weise bei Theo Angelopoulos beobachten. Der italienische Regisseur Federico Fellini hat einmal gesagt: „Das Kino ist eine göttliche Art und Weise, das Leben zu erzählen, dem Herrgott Konkurrenz zu machen.“ Fellinis Charakterisierung des Kinos scheint mir nach wie vor zutreffend zu sein. Das wird nicht zuletzt dann deutlich, wenn man über das Verhältnis von Film und Zeit nachdenkt. Denn der Film vermag wie kein anderes Medium, Zeit zu simulieren und zu inszenieren. Er kann ein Leben oder ein Jahrhundert auf 90 Minuten verdichten. Er kann uns Jahrtausende zurückversetzten oder uns einen glaubhaften Blick in die ferne Zukunft werfen lassen, er kann seine Geschichte linear erzählen oder sie mit Hilfe von Rückblenden und Sprüngen auf die Leinwand bringen. „So handelt es sich beim Film“, so die Filmwissenschaftlerin Kerstin Volland, „nicht um ein zeit-mimetisches, sondern um ein zeit-schöpferisches Medium“[2] – zeit-schöpferisch dem Herrgott Konkurrenz machend. Was das konkret bedeutet, kann man zum Beispiel bei Regisseuren wie Christopher Nolan oder auf ganz andere Weise bei Theo Angelopoulos beobachten.
Der Film moduliert und inszeniert Zeit. Immer allerdings suggeriert er dabei eine Präsenz des erzählten Geschehens. Mit 24 Bildern in der Sekunde simuliert er eine Handlung, die jetzt geschieht: im Augenblick ihrer Projektion. Dieses Jetzt kann jedoch ganz unterschiedlich daher kommen. So ist das populäre Kino an einer möglichst ungebrochenen Illusion interessiert. Die Apparatur soll hinter dem Schein verschwinden. Der Zuschauer soll intensiv involviert werden. Er soll nach Möglichkeit vergessen, dass er „nur“ einen Film sieht. Für den künstlerisch ambitionierten Film ist hingegen charakteristisch, dass er sich nicht scheut, die Medialität des Erzählens ausdrücklich zu reflektieren und zu thematisieren. Der Zuschauer darf oder soll sogar im Augenblick der Projektion bemerken, dass er einer Inszenierung folgt. Das kann so weit gehen, dass ein Mikrophon ganz bewusst ins Bild ragt oder auf andere Weise etwas von der Aufnahme- und Inszenierungsapparatur sichtbar wird. So kann der Film unterschiedliche Intentionen verfolgen: Manchmal sollen wir vergessen, dass wir nur Bilder sehen, dann wieder soll es uns bewusst sein.
Man könnte diese Differenz auch konfessionell zuordnen: Dann wäre das an realer Gegenwart interessierte populäre Illusionskino m.E. wohl eher katholisch zu nennen, während das seine Medialität nicht verbergende und manchmal bewusst ausstellende Arthouse-Kino eher eine Affinität zum Protestantischen hätte – insofern man die Betonung der Dialektik von Darstellung und Transzendierung, von Präsenz und Brechung im Kontext religiöser Kommunikation für etwas Protestantisches hält.
Dabei ist zu sehen: Auch das Arthouse-Kino ist an Präsenz interessiert, an intensiver Gegenwart. Man könnte vielleicht sagen: An einer wissenden, aufgeklärten Gegenwart. Im Unterschied zum populären Kino spielt das einzelne Bild in diesem Zusammenhang eine größere Rolle. Sicher, im Film ist das einzelne Bild immer auch und nur ein Aufblitzen in einer Bilderfolge, ein Element in einer größeren Bildererzählung, die dem Einzelbild eine bestimmte Bedeutung zuschreibt. Aber gerade im Kunstkino lässt sich beobachten, dass das einzelne Bild eine herausgehobene Bedeutung erlangen kann und als ästhetisches Ereignis aus seiner dienenden Funktion innerhalb des Filmganzen heraustritt und auch heraustreten soll.
Solche Bilder ermöglichen kontemplative Augenblickserfahrungen. Der Philosoph und Filmtheoretiker Gilles Deleuze spricht von „Zeit-Bildern“, in denen besondere Verdichtungen stattfinden.[3] Für die reine Bildlichkeit der Filmbilder gilt dabei wie für alle Bilder: Der „sinnlich organisierte Sinn“ (Gottfried Böhm) der Bilder lässt sich nicht vollständig sprachlich repräsentieren.[4] Nach und neben allen Interpretationen und Umschreibungen bleibt ein unübersetzbarer Rest. Steckt darin Religion?
Wenn man Filme auf ihre religiösen Dimensionen hin untersucht, wird zunächst deutlich: Religiöse Qualität entsteht nicht zuletzt durch religiöse Deutung – oder: sie wird jedenfalls durch diese erst explizit. Dieses Deutungselement kann als Text im Film selbst zum Bild hinzutreten oder auch erst als Interpretation im Prozess der Aneignung hinzukommen. Voraussetzung für so ein Zustandekommen religiöser Qualitäten scheint mit allerdings immer ein ästhetisch exponiertes Bild zu sein, ein Bild, das zum Verweilen im Hier und Jetzt seiner Sinnlichkeit einlädt und im Vollzug dieses Verweilens eine Erfahrung immanenter Transzendenz eröffnet. Im Film kann es sich natürlich nur um ein begrenztes Verweilen handeln. Aber es sind m.E. diese Momente, die anschlussfähig für religiöse Deutungen sind. Im Unterschied zum großen stillen Bild der Fotographie oder der Malerei ist diese Anschlussfähigkeit beim Film in bestimmter Weise imprägniert: durch den narrativen Kontext. Ein filmisches Bild ist durch seine Positionierung im Bedeutungsgewebe der filmischen Erzählung immer schon semantisch aufgeladen.
Um also die Sequenz, die Szene, das Bild verstehen zu können, muss man den Kontext vergegenwärtigen. Ich zeige Ihnen im Folgenden zwei ästhetisch-religiös exponierte Bildsequenzen, die ich knapp einführe und interpretiere.
 Die erste ist aus dem Film „American Beauty“ von Sam Mendes (USA 1999). Der mit fünf Oscars ausgezeichnete Film erzählt von Lester Burnham und seinem Leben mit Frau und Tochter in einer aufgeräumten amerikanischen Kleinstadt. Burnhams Selbsteinschätzung zu Beginn des Films: „Irgendwie bin ich jetzt schon tot.“ Sein Weg vom Tod zum Leben und wieder zum Tod beginnt, als er sich in Angela verliebt, die hübsche Freundin seiner Tochter Jane. Wie aus jahrelanger Anästhesie erwacht, beginnt er von neuem, seine Interessen wahrzunehmen, seinen Körper in Form zu bringen, Pink Floyd zu hören und Joints zu rauchen, die ihm der Nachbarsjunge Ricky besorgt. Was folgt, ist eine filmische Reflexion über die Entdeckung eines anderen Blicks auf das Leben. Über den Wert und das Sehen von Schönheit. Der reinste Vertreter dieser Religion des Schönen ist Ricky. Der 16-jährige Sohn eines neofaschistischen Soldatenvaters, der regelmäßig Urinproben zum Zweck der Drogenkontrolle von seinem Sohn verlangt, hat immer eine digitale Kamera dabei, um die Momente der Schönheit festzuhalten. Lesters Tochter Jane, in die er sich verliebt, erzählt er vom Anblick einer toten Obdachlosen, davon, dass es gewesen sei, „als ob Gott dich direkt ansieht“. Was man da sehe, will Jane wissen. „Schönheit“, antwortet Ricky, Mystiker des Augenblicks der ästhetischen Erfahrung. Einmal zeigt er Jane „das Schönste, was ich je gefilmt habe“. Es ist eine im Wind tanzenden Plastiktüte. Die Kamera blickt den beiden von hinten über die Schulter auf einen Fernsehmonitor, auf dem das Video der Tüte läuft, begleitet von einer meditativen Synthesizer-Musik, in die sich Klavierklänge mischen. Die Musik ist extradiegetisch, kommt nicht aus der dargestellten Welt und löst die Szene darum aus ihren konkreten Bezügen heraus. Sie signalisiert über die konkrete Situation hinausgehende Bedeutung und modelliert das Gefühl. Die erste ist aus dem Film „American Beauty“ von Sam Mendes (USA 1999). Der mit fünf Oscars ausgezeichnete Film erzählt von Lester Burnham und seinem Leben mit Frau und Tochter in einer aufgeräumten amerikanischen Kleinstadt. Burnhams Selbsteinschätzung zu Beginn des Films: „Irgendwie bin ich jetzt schon tot.“ Sein Weg vom Tod zum Leben und wieder zum Tod beginnt, als er sich in Angela verliebt, die hübsche Freundin seiner Tochter Jane. Wie aus jahrelanger Anästhesie erwacht, beginnt er von neuem, seine Interessen wahrzunehmen, seinen Körper in Form zu bringen, Pink Floyd zu hören und Joints zu rauchen, die ihm der Nachbarsjunge Ricky besorgt. Was folgt, ist eine filmische Reflexion über die Entdeckung eines anderen Blicks auf das Leben. Über den Wert und das Sehen von Schönheit. Der reinste Vertreter dieser Religion des Schönen ist Ricky. Der 16-jährige Sohn eines neofaschistischen Soldatenvaters, der regelmäßig Urinproben zum Zweck der Drogenkontrolle von seinem Sohn verlangt, hat immer eine digitale Kamera dabei, um die Momente der Schönheit festzuhalten. Lesters Tochter Jane, in die er sich verliebt, erzählt er vom Anblick einer toten Obdachlosen, davon, dass es gewesen sei, „als ob Gott dich direkt ansieht“. Was man da sehe, will Jane wissen. „Schönheit“, antwortet Ricky, Mystiker des Augenblicks der ästhetischen Erfahrung. Einmal zeigt er Jane „das Schönste, was ich je gefilmt habe“. Es ist eine im Wind tanzenden Plastiktüte. Die Kamera blickt den beiden von hinten über die Schulter auf einen Fernsehmonitor, auf dem das Video der Tüte läuft, begleitet von einer meditativen Synthesizer-Musik, in die sich Klavierklänge mischen. Die Musik ist extradiegetisch, kommt nicht aus der dargestellten Welt und löst die Szene darum aus ihren konkreten Bezügen heraus. Sie signalisiert über die konkrete Situation hinausgehende Bedeutung und modelliert das Gefühl.
Ricky: „Das war einer von jenen Tagen, an denen es jeden Moment schneien kann und Elektrizität in der Luft liegt. Man kann sie fast knistern hören, stimmt's?" Diese zunächst an Jane gerichtete rhetorische Frage intensiviert die Aufmerksamkeit. Die Musik korrespondiert dem Schweben der Tüte. Ricky weiter: „Und diese Tüte hat einfach mit mir getanzt, wie ein kleines Kind, das darum bettelt, mit mir zu spielen, fünfzehn Minuten lang." Es folgt ein Schnitt auf Rickys Gesicht in Nahaufnahme, eine Perspektive, die die Fokussierung auf Rickys subjektive Empfindung verstärkt. Ricky: „An dem Tag ist mir klar geworden, dass hinter allen Dingen Leben steckt (Schnitt, bildfüllend im Blick nun nur noch die im Wind schwebende Tüte) und diese unglaublich gütige Kraft (Klänge von Streichinstrumenten setzen ein, die die Wärme der gütigen Kraft unterstreichen und bekräftigen), die mich wissen lassen wollte, dass es keinen Grund gibt Angst zu haben."
Schnitt, Janes Gesicht in Nahaufnahme. Ricky: „Nie wieder. Ein Video ist ein armseliger Ersatz, ich weiß. Aber es hilft mir, mich zu erinnern. Und ich muss mich erinnern." Jane wendet ihren Kopf in seine Richtung. Schnitt: Das Gesicht von Ricky. Er sagt: „Es gibt manchmal so viel Schönheit auf der Welt, dass ich sie fast nicht ertragen kann. Und mein Herz droht dann daran zu zerbrechen." Er spricht langsam, weiterhin von der Musik begleitet und, so sehen wir an seinem Gesichtsausdruck, den Tränen nahe. Die Verbindung von Schönheit und Gotteserfahrung, die Ricky in einer früheren Äußerung Jane gegenüber schon einmal hergestellt hatte, schwingt mit. Beide Köpfe sind im Blick. Jane legt ihre Hand in seine. Sie blicken einander an. Jane beugt sich zur Seite und küsst Ricky auf den Mund, sieht ihn verträumt an, scheint dann auf einmal zu erwachen und sagt: „Oh, mein Gott, wie spät ist es?“ Damit ist der Film zurück im Alltag. Die exponierte Szene, in der die Zeit stillzustehen scheint, ist beendet.
Die religiöse Aufladung der Szene vollzieht sich dabei schrittweise. Zunächst wird gespannte Erwartung durch die Ankündigung des „Schönsten, was ich je gefilmt habe“ erzeugt. Das Zeigen des Videos wird durch meditative Musik begleitet, die alltagstranszendierende Bedeutungssteigerung signalisiert. Nahaufnahmen der Gesichter fokussieren auf subjektive Empfindung. Rickys Erläuterung stellt sein Video schließlich in einen Kontext religiöser Deutung. Zusammengefasst: Der Anblick einer im Wind tanzenden Plastiktüte vermittelt die Erfahrung des Unbedingten und damit ein religiöses Gefühl des Getragenseins von einer „gütigen Kraft“, die die Angst besiegt. Dass hier ausgerechnet eine Plastiktüte zum Anlass für eine religiöse Erfahrung wird, macht nur deutlich, dass es der Deutungshorizont ist, der eine Erfahrung als religiöse Erfahrung und eben auch ein Gefühl als religiöses Gefühl qualifiziert. Der Eindruck des Stillstehens der Zeit wird dabei schon auf der Ebene der ästhetischen Intensität erreicht: durch die vollzugsorientierte Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt der sinnlichen Wahrnehmung. Die religiöse Deutung steigert das darin schon enthaltene Moment der immanenten Transzendenz.
 Mein zweites Beispiel entnehme ich dem Film „Bal – Honig“. Auch ein Film mit Festivalmeriten. 2010 gewann der türkische Regisseur Semih Kaplanoglu mit „Bal – Honig“ den Goldenen Bären der Internationalen Filmfestspiele von Berlin. Es ist ein Film, der in mancher Hinsicht an Angelopoulos erinnert, lange Einstellungen, durchkomponierte Bilder, atmosphärische Dichte. Er erzählt eine Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, von dem Imker Yakup und seinem vielleicht sechsjährigen Sohn Yusuf, wohnhaft im Pontusgebirge an der türkischen Schwarzmeerküste, eine Landschaft ohne Autobahnen und Mobiltelefone. Yusuf hat es schwer in der Schule, er stottert. Nur im Gespräch mit seinem Vater kann er flüsternd das Stottern überwinden. Mit dem Vater geht er in den Wald, um nach den Bienen zu sehen. Der Wald ist sein Zuhause, seine Zuflucht - der zirpende, summende und manchmal auch nur schweigende Wald. Eines Tages ist der Vater fort. Er wollte neue Stellplätze für seine Bienenstöcke finden. Doch er kommt nicht zurück. Als Zuschauer weiß man aus der Eingangssequenz: Der Vater ist tot, verunglückt bei der Suche nach Bienenstockstandorten. Wir sehen den Jungen, seine Sehnsucht, seinen Schmerz, sein sehnliches Warten. Als er dann schließlich erfährt, was mit seinem Vater geschehen ist, flüchtet er in den Wald, in den Schutz der Bäume. Am Fuß eines Baumes, in den Armen seiner Wurzel, schläft er schließlich erschöpft ein. Die Kamera verweilt im Hier und Jetzt dieses Bildes und erzeugt so ein Nunc stans, das religiöse Interpretationen nahe legt. Mein zweites Beispiel entnehme ich dem Film „Bal – Honig“. Auch ein Film mit Festivalmeriten. 2010 gewann der türkische Regisseur Semih Kaplanoglu mit „Bal – Honig“ den Goldenen Bären der Internationalen Filmfestspiele von Berlin. Es ist ein Film, der in mancher Hinsicht an Angelopoulos erinnert, lange Einstellungen, durchkomponierte Bilder, atmosphärische Dichte. Er erzählt eine Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, von dem Imker Yakup und seinem vielleicht sechsjährigen Sohn Yusuf, wohnhaft im Pontusgebirge an der türkischen Schwarzmeerküste, eine Landschaft ohne Autobahnen und Mobiltelefone. Yusuf hat es schwer in der Schule, er stottert. Nur im Gespräch mit seinem Vater kann er flüsternd das Stottern überwinden. Mit dem Vater geht er in den Wald, um nach den Bienen zu sehen. Der Wald ist sein Zuhause, seine Zuflucht - der zirpende, summende und manchmal auch nur schweigende Wald. Eines Tages ist der Vater fort. Er wollte neue Stellplätze für seine Bienenstöcke finden. Doch er kommt nicht zurück. Als Zuschauer weiß man aus der Eingangssequenz: Der Vater ist tot, verunglückt bei der Suche nach Bienenstockstandorten. Wir sehen den Jungen, seine Sehnsucht, seinen Schmerz, sein sehnliches Warten. Als er dann schließlich erfährt, was mit seinem Vater geschehen ist, flüchtet er in den Wald, in den Schutz der Bäume. Am Fuß eines Baumes, in den Armen seiner Wurzel, schläft er schließlich erschöpft ein. Die Kamera verweilt im Hier und Jetzt dieses Bildes und erzeugt so ein Nunc stans, das religiöse Interpretationen nahe legt.
Anmerkungen
[1] Vortrag auf dem 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg am 4. Mai 2013 im Rahmen des Tages des Wissens der Universität Hamburg.
[2] Kerstin Volland, Zeitspieler. Inszenierungen des Temporalen bei Bergson, Deleuze und Lynch, Wiesbaden 2009, 14.
[3] Vgl. Gilles Deleuze, Kino 2, Das Zeit-Bild, Frankfurt/Main 1991.
[4] Gottfried Boehm, Bildsinn und Sinnesorgane, in: Jürgen Stöhr (HG.), Ästhetische Erfahrung heute, Köln 1996, 148-165, 149.
|

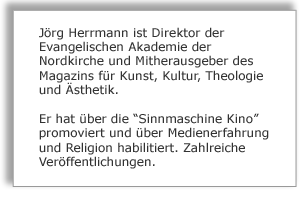 Der italienische Regisseur Federico Fellini hat einmal gesagt: „Das Kino ist eine göttliche Art und Weise, das Leben zu erzählen, dem Herrgott Konkurrenz zu machen.“ Fellinis Charakterisierung des Kinos scheint mir nach wie vor zutreffend zu sein. Das wird nicht zuletzt dann deutlich, wenn man über das Verhältnis von Film und Zeit nachdenkt. Denn der Film vermag wie kein anderes Medium, Zeit zu simulieren und zu inszenieren. Er kann ein Leben oder ein Jahrhundert auf 90 Minuten verdichten. Er kann uns Jahrtausende zurückversetzten oder uns einen glaubhaften Blick in die ferne Zukunft werfen lassen, er kann seine Geschichte linear erzählen oder sie mit Hilfe von Rückblenden und Sprüngen auf die Leinwand bringen. „So handelt es sich beim Film“, so die Filmwissenschaftlerin Kerstin Volland, „nicht um ein zeit-mimetisches, sondern um ein zeit-schöpferisches Medium“
Der italienische Regisseur Federico Fellini hat einmal gesagt: „Das Kino ist eine göttliche Art und Weise, das Leben zu erzählen, dem Herrgott Konkurrenz zu machen.“ Fellinis Charakterisierung des Kinos scheint mir nach wie vor zutreffend zu sein. Das wird nicht zuletzt dann deutlich, wenn man über das Verhältnis von Film und Zeit nachdenkt. Denn der Film vermag wie kein anderes Medium, Zeit zu simulieren und zu inszenieren. Er kann ein Leben oder ein Jahrhundert auf 90 Minuten verdichten. Er kann uns Jahrtausende zurückversetzten oder uns einen glaubhaften Blick in die ferne Zukunft werfen lassen, er kann seine Geschichte linear erzählen oder sie mit Hilfe von Rückblenden und Sprüngen auf die Leinwand bringen. „So handelt es sich beim Film“, so die Filmwissenschaftlerin Kerstin Volland, „nicht um ein zeit-mimetisches, sondern um ein zeit-schöpferisches Medium“ Die erste ist aus dem Film „American Beauty“ von Sam Mendes (USA 1999). Der mit fünf Oscars ausgezeichnete Film erzählt von Lester Burnham und seinem Leben mit Frau und Tochter in einer aufgeräumten amerikanischen Kleinstadt. Burnhams Selbsteinschätzung zu Beginn des Films: „Irgendwie bin ich jetzt schon tot.“ Sein Weg vom Tod zum Leben und wieder zum Tod beginnt, als er sich in Angela verliebt, die hübsche Freundin seiner Tochter Jane. Wie aus jahrelanger Anästhesie erwacht, beginnt er von neuem, seine Interessen wahrzunehmen, seinen Körper in Form zu bringen, Pink Floyd zu hören und Joints zu rauchen, die ihm der Nachbarsjunge Ricky besorgt. Was folgt, ist eine filmische Reflexion über die Entdeckung eines anderen Blicks auf das Leben. Über den Wert und das Sehen von Schönheit. Der reinste Vertreter dieser Religion des Schönen ist Ricky. Der 16-jährige Sohn eines neofaschistischen Soldatenvaters, der regelmäßig Urinproben zum Zweck der Drogenkontrolle von seinem Sohn verlangt, hat immer eine digitale Kamera dabei, um die Momente der Schönheit festzuhalten. Lesters Tochter Jane, in die er sich verliebt, erzählt er vom Anblick einer toten Obdachlosen, davon, dass es gewesen sei, „als ob Gott dich direkt ansieht“. Was man da sehe, will Jane wissen. „Schönheit“, antwortet Ricky, Mystiker des Augenblicks der ästhetischen Erfahrung. Einmal zeigt er Jane „das Schönste, was ich je gefilmt habe“. Es ist eine im Wind tanzenden Plastiktüte. Die Kamera blickt den beiden von hinten über die Schulter auf einen Fernsehmonitor, auf dem das Video der Tüte läuft, begleitet von einer meditativen Synthesizer-Musik, in die sich Klavierklänge mischen. Die Musik ist extradiegetisch, kommt nicht aus der dargestellten Welt und löst die Szene darum aus ihren konkreten Bezügen heraus. Sie signalisiert über die konkrete Situation hinausgehende Bedeutung und modelliert das Gefühl.
Die erste ist aus dem Film „American Beauty“ von Sam Mendes (USA 1999). Der mit fünf Oscars ausgezeichnete Film erzählt von Lester Burnham und seinem Leben mit Frau und Tochter in einer aufgeräumten amerikanischen Kleinstadt. Burnhams Selbsteinschätzung zu Beginn des Films: „Irgendwie bin ich jetzt schon tot.“ Sein Weg vom Tod zum Leben und wieder zum Tod beginnt, als er sich in Angela verliebt, die hübsche Freundin seiner Tochter Jane. Wie aus jahrelanger Anästhesie erwacht, beginnt er von neuem, seine Interessen wahrzunehmen, seinen Körper in Form zu bringen, Pink Floyd zu hören und Joints zu rauchen, die ihm der Nachbarsjunge Ricky besorgt. Was folgt, ist eine filmische Reflexion über die Entdeckung eines anderen Blicks auf das Leben. Über den Wert und das Sehen von Schönheit. Der reinste Vertreter dieser Religion des Schönen ist Ricky. Der 16-jährige Sohn eines neofaschistischen Soldatenvaters, der regelmäßig Urinproben zum Zweck der Drogenkontrolle von seinem Sohn verlangt, hat immer eine digitale Kamera dabei, um die Momente der Schönheit festzuhalten. Lesters Tochter Jane, in die er sich verliebt, erzählt er vom Anblick einer toten Obdachlosen, davon, dass es gewesen sei, „als ob Gott dich direkt ansieht“. Was man da sehe, will Jane wissen. „Schönheit“, antwortet Ricky, Mystiker des Augenblicks der ästhetischen Erfahrung. Einmal zeigt er Jane „das Schönste, was ich je gefilmt habe“. Es ist eine im Wind tanzenden Plastiktüte. Die Kamera blickt den beiden von hinten über die Schulter auf einen Fernsehmonitor, auf dem das Video der Tüte läuft, begleitet von einer meditativen Synthesizer-Musik, in die sich Klavierklänge mischen. Die Musik ist extradiegetisch, kommt nicht aus der dargestellten Welt und löst die Szene darum aus ihren konkreten Bezügen heraus. Sie signalisiert über die konkrete Situation hinausgehende Bedeutung und modelliert das Gefühl. Mein zweites Beispiel entnehme ich dem Film „Bal – Honig“. Auch ein Film mit Festivalmeriten. 2010 gewann der türkische Regisseur Semih Kaplanoglu mit „Bal – Honig“ den Goldenen Bären der Internationalen Filmfestspiele von Berlin. Es ist ein Film, der in mancher Hinsicht an Angelopoulos erinnert, lange Einstellungen, durchkomponierte Bilder, atmosphärische Dichte. Er erzählt eine Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, von dem Imker Yakup und seinem vielleicht sechsjährigen Sohn Yusuf, wohnhaft im Pontusgebirge an der türkischen Schwarzmeerküste, eine Landschaft ohne Autobahnen und Mobiltelefone. Yusuf hat es schwer in der Schule, er stottert. Nur im Gespräch mit seinem Vater kann er flüsternd das Stottern überwinden. Mit dem Vater geht er in den Wald, um nach den Bienen zu sehen. Der Wald ist sein Zuhause, seine Zuflucht - der zirpende, summende und manchmal auch nur schweigende Wald. Eines Tages ist der Vater fort. Er wollte neue Stellplätze für seine Bienenstöcke finden. Doch er kommt nicht zurück. Als Zuschauer weiß man aus der Eingangssequenz: Der Vater ist tot, verunglückt bei der Suche nach Bienenstockstandorten. Wir sehen den Jungen, seine Sehnsucht, seinen Schmerz, sein sehnliches Warten. Als er dann schließlich erfährt, was mit seinem Vater geschehen ist, flüchtet er in den Wald, in den Schutz der Bäume. Am Fuß eines Baumes, in den Armen seiner Wurzel, schläft er schließlich erschöpft ein. Die Kamera verweilt im Hier und Jetzt dieses Bildes und erzeugt so ein Nunc stans, das religiöse Interpretationen nahe legt.
Mein zweites Beispiel entnehme ich dem Film „Bal – Honig“. Auch ein Film mit Festivalmeriten. 2010 gewann der türkische Regisseur Semih Kaplanoglu mit „Bal – Honig“ den Goldenen Bären der Internationalen Filmfestspiele von Berlin. Es ist ein Film, der in mancher Hinsicht an Angelopoulos erinnert, lange Einstellungen, durchkomponierte Bilder, atmosphärische Dichte. Er erzählt eine Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, von dem Imker Yakup und seinem vielleicht sechsjährigen Sohn Yusuf, wohnhaft im Pontusgebirge an der türkischen Schwarzmeerküste, eine Landschaft ohne Autobahnen und Mobiltelefone. Yusuf hat es schwer in der Schule, er stottert. Nur im Gespräch mit seinem Vater kann er flüsternd das Stottern überwinden. Mit dem Vater geht er in den Wald, um nach den Bienen zu sehen. Der Wald ist sein Zuhause, seine Zuflucht - der zirpende, summende und manchmal auch nur schweigende Wald. Eines Tages ist der Vater fort. Er wollte neue Stellplätze für seine Bienenstöcke finden. Doch er kommt nicht zurück. Als Zuschauer weiß man aus der Eingangssequenz: Der Vater ist tot, verunglückt bei der Suche nach Bienenstockstandorten. Wir sehen den Jungen, seine Sehnsucht, seinen Schmerz, sein sehnliches Warten. Als er dann schließlich erfährt, was mit seinem Vater geschehen ist, flüchtet er in den Wald, in den Schutz der Bäume. Am Fuß eines Baumes, in den Armen seiner Wurzel, schläft er schließlich erschöpft ein. Die Kamera verweilt im Hier und Jetzt dieses Bildes und erzeugt so ein Nunc stans, das religiöse Interpretationen nahe legt.