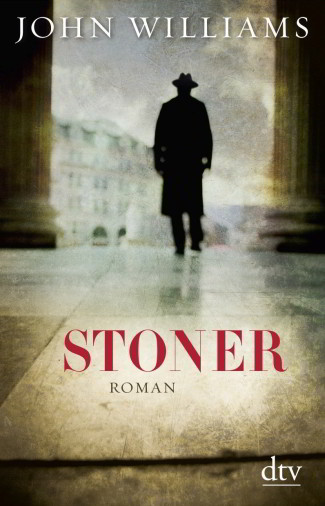Resonanzen & Kompetenzen |
Der DulderEine RezensionWolfgang Vögele
Den meisten Lesern wird der Name des amerikanischen Romanciers John Williams (1922-1994) unbekannt sein. Zum ersten Mal wurde sein Roman "Stoner" im Jahr 1965 publiziert, danach gerieten Text und Autor sofort in Vergessenheit. Im Jahr 2006 wurde das Buch neu aufgelegt und erreichte in den USA überraschend schnell die Bestsellerlisten. Im letzten Jahr erschien eine deutsche Übersetzung. Auf den ersten Blick ist "Stoner" ein College Roman, und man könnte ihn mit Tom Wolfe ("Ich bin Charlotte Simmons"), Matt Ruff ("Fool on the Hill") oder Philip Roth ("Der menschliche Makel") vergleichen. Aber diese Vergleiche hinken. Williams belebt kein Genre, er hat etwas ganz eigenes geschaffen. Er erzählt die Passionsgeschichte eines Literaturhistorikers an einem kleinen College im Mittleren Westen. Sein Name lautet William Stoner. Der Autor erzählt von dessen schnörkelloser Biographie, von der Geburt bis zum Tod, und er konzentriert sich kommentarlos und nüchtern auf die Schlüsselsituationen dieses Lebens, besonders auf sein Leiden, seine Niederlagen und sein Scheitern. Das macht, trotz aller Nüchternheit, keinen ausgewogenen Eindruck, aber gerade in dieser Beschränkung erreicht Williams eine unerhörte Dichte und Intensität der Darstellung. Man kann dem Autor diese Methode der Konzentration vorwerfen: Er hätte dann all das Gute und Schöne im Leben Stoners vernachlässigt, wenn nicht sogar unterschlagen. Sieht man in der Methode aber eine Stärke, erzeugt die dichte Abfolge bei der Erzählung von Knotenpunkten und Wegscheiden in Stoners Leben einen Effekt, der über aufklärt und zugleich Empathie bei den Lesern weckt. An diesen Wegscheiden nimmt Stoners Leben eine gelegentlich kaum von ihm bemerkte, aber dennoch eine andere Richtung auf. Ein Viehhändler rät seinem Vater, einem Farmer, den Sohn aufs College zu schicken. Der Student der Agrarwissenschaften besucht eine Vorlesung über Sonette; danach schreibt er sich um für Literaturwissenschaften. Als Doktorand trifft er sich mit zwei Kommilitonen in einer Bar und hört eine Einschätzung über sich selbst, die ihn fürs Leben prägt. Er verzichtet darauf, sich freiwillig als Soldat für den ersten Weltkrieg zu melden. Bei einem Fakultätstreffen begegnet einer jungen Frau, in die er sich verliebt, ohne zu ahnen, dass ihm diese Frau das Eheleben zur Hölle machen wird. Der Literaturprofessor beginnt eine Affäre mit einer Doktorandin. Stets fügt er sich in sein Schicksal, lässt alles über sich ergehen. Von Studenten, Kollegen, Freunden, vor allem aber von seiner Frau lässt er sich drangsalieren und schikanieren. Ganz selten nur ergreift er selbst die Initiative. Er ist von der Vorlesung seines späteren Doktorvaters fasziniert und wechselt das Studienfach. Er macht Dienst nach Vorschrift, um wieder seine gewohnten Seminare und Vorlesungen halten zu können. Er bricht gegen Ende seines Lebens die körperlich auszehrende Chemotherapie ab. All diese 'kleinen' Entscheidungen genügen aber nicht, um dem Verhängnis seines Lebens, seinem Dasein zum Tode, eine grundlegend andere Richtung zu geben. Stoner steht seinem Leben hilflos gegenüber. Er ist darin gefangen. Und das Schlimmste ist nicht, dass er diesem Schicksal nicht entkommen kann. Das Schlimmste ist, dass er nicht zu erkennen scheint, dass er in einem Gefängnis sitzt. Stoner ist ein Dulder, der sich entlang der Schienen seines Lebens unversehens auf einer Laufbahn zum Tode wiederfindet. Er rettet sich aus den Plagen und Mühen des elterlichen Farmerlebens in das Studium. Mit Hilfe des Studiums etabliert er sich im beschränkten Schutzraum der Fakultät für Literaturwissenschaft, abgeschottet von den komplexen sozialen, ökonomischen und politischen Konflikten seiner Zeit, von der Jahrhundertwende über zwei Weltkriege bis zum Koreakrieg. Die Universität bewahrt ihn vor dem Militärdienst. Durch die Heirat mit einer lebensuntüchtigen Bankdirektorstochter versucht er, sich in der bürgerlichen Welt zu etablieren, aber damit scheitert er kläglich. Er macht gar nicht erst den Versuch, um seine Ehe zu kämpfen, weil er um die Aussichtslosigkeit dieses Kampfes weiß. Seine Tochter mit dem sprechenden Namen Grace ist das genaue Gegenteil einer Gnade. Sie wird zum umkämpften Gegenstand des dornenreichen Rosenkrieges zwischen Stoner und seiner Frau. Auf dem College wird die erwachsene Grace ungewollt schwanger, heiratet den Kindesvater, einen unreifen jungen Studenten, der vor seiner Ehe in den Militärdienst flieht. Nach kurzer Zeit an der Front fällt er, und Grace überlässt die Erziehung ihres Sohnes den Schwiegereltern, während sie selbst zunehmend der Whiskyflasche verfällt. Stoner sieht das alles, was mit seiner Tochter und sonst um ihn herum geschieht. Und er nimmt es hin, aber er schreitet nicht ein. Diese Haltung des Rückzugs beeinflusst sein Leben tiefer als er es wahrhaben will. Stoner ist der exemplarische Dulder, zurückgezogen, lebensscheu, schon in seiner Jugend müde. Und gerade darin, in Duldung und Rückzug macht Williams ihn zum Jedermann, zur schwächelnden Person, die gar nicht erst zum Kampf gegen die Windmühlen des Lebens aufbricht. Stoner bleibt in seinem akademischen Elfenbeinturm sitzen und beobachtet die Stürme der Zeit von der Aussichtsplattform aus. Wenn er dann doch einmal energisch zum Handeln schreitet, dann geschieht das zwar in der hilflosen Absicht, dem eigenen Verhängnis zu entkommen, aber jeder Schritt aus diesem Verhängnis heraus ist zugleich von dem Bewusstsein geprägt, dass dieses Verhängnis nur verzögert, aber nicht beseitigt werden kann. Der größte Schritt nach draußen, die Affäre mit der Doktorandin, ist zugleich der größte Schritt auf das Verhängnis zu. Es macht keinen Sinn, mit der jungen Frau, über deren Verhältnis zu Stoner Studenten und Fakultät unablässig tratschen, ein neues Leben zu beginnen, denn beiden fehlen die finanziellen Möglichkeiten und das soziale Netzwerk, das einen beruflichen Neuanfang an einer anderen Universität ermöglichen würde. Stoner beendet die Affäre und er nimmt es regungslos zur Kenntnis, als er Jahre später entdeckt, dass die junge Frau, zu der er den Kontakt abbrach, ihm die fertig gestellte Dissertation gewidmet hat. Williams beschreibt all das in einer nüchternen und präzisen Sprache, klar, mitleidlos (wobei dieses nicht in einem abwertenden Sinn gemeint ist) und schnörkellos. Er hat es nicht nötig, weiche Polster aus Verständnis und Mitgefühl an die Ecken und Kanten dieser so sperrigen, ergebenen Persönlichkeit zu binden. Und in dieser Nüchternheit lässt Williams sich in keinem Moment des Romans beirren, von den mühsamen Anfängen des Farmerlebens bis zur Tumorerkrankung und Sterben. Letzteres beschreibt der Autor so, dass dem emeritierten Professor, der in seinem Wintergarten sitzt und liest, das Buch aus der Hand gleitet. Stoner ist ein Dulder, weil er die Bürden, die das Leben für ihn bereithält, geduldig erträgt, bis in den Tod hinein. Er nimmt das Kreuz seines Lebens auf sich und erträgt dieses buchstäblich bis zum letzten Atemzug. Dabei ist der Roman frei von allen religiösen wie theologischen Anspielungen. Religion hat wie alles andere, was Begeisterung, Enthusiasmus, Energie wecken könnte, keinen Platz. Stoner erlebt seine Erweckung in der Literatur, als sein Professor ein Sonett von Shakespeare zuerst vorträgt und danach interpretiert. Viel mehr sagt der Autor nicht über Stoners Literaturleidenschaft, obwohl dieses Schlüsselerlebnis in der Vorlesung seine jahrzehntelange Arbeit als Dozent an der Universität begründet. Stoners Vorlieben sind schwach ausgeprägt, oder der Autor vernachlässigt sie. Weit im Vordergrund steht sein ebenso stummes wie stilles Leiden. Der Leser ist die ganze Zeit versucht, sich zum Fürsprecher der Titelfigur zu machen und einzuschreiten. Man würde gern die merkwürdige Ehefrau in die Psychiatrie einliefern, die trinkende Tochter zu den Anonymen Alkoholikern schicken und jenem arroganten wie intriganten Leiter des Fachbereichs für Englisch endlich das Handwerk legen. Eine der Schlüsselstellen des Romans findet sich am Ende des ersten Viertels. Masters, ein promovierender Freund Stoners, der als Soldat im Ersten Weltkrieg fallen wird, entlarvt im Gespräch mit seinen Freunden ungewollt die Persönlichkeit der Titelfigur. Er sagt ihm ins Gesicht: "Auch du gehörst zu den Unzulänglichen - du bist der Träumer, der Verrückte in einer noch verrückteren Welt, unser Don Quichotte des Mittleren Westens, der (...) unter blauem Himmel herumtollt." (S.42) Wenn Lebensgeschichte ein Kampf zwischen dem Individuum und der widerständigen Welt ist, dann geht dieser Kampf, so Masters, grundsätzlich mit einem Sieg der Welt zu Ende. Der kluge Freund, der dennoch seiner Kriegsbegeisterung erliegt und mit seiner freiwilligen Meldung sein Todesurteil unterschreibt, spricht bittere Wahrheiten aus. Niemand kann der Welt, dem Zufall oder dem Glück, das selten genug eintritt, etwas entgegensetzen. Der Mensch ist grundsätzlich nicht lebenstüchtig. Stoner hat in der Universität eine Flucht- und Trutzburg gegen das Schicksal gefunden. Weil sie ihn vor der Plackerei des Farmerlebens bewahrt hat, ist er ihr zu Dank verpflichtet. Aber in seinem vermeintlichen akademischen Schlaraffenland trifft er auf andere Dämonen, die ihm das Leben zur Last machen. Stoner Muss immer wieder an den toten Masters und seine Worte über die Niederlage des einzelnen gegen die Welt denken. Aber er macht nicht den Eindruck, als würde er aus dessen Einsichten Konsequenzen ziehen. Er wirkt so seltsam energielos, beinahe gelangweilt, vom ersten Moment seines Lebens an überdrüssig, ein verlorener Fremdling in einer kalten und lieblosen sozialen Umwelt. Gerade darum vergräbt sich Stoner an der Universität. Im Fachbereich wird er zunächst schikaniert, dann isoliert. Die Studenten besuchen seine Vorlesungen und Seminare nicht mehr, vereinsamt findet er sich in seinem Büro wieder, auf sich selbst gestellt. Aber Lesen und Schreiben können ihn nicht erfüllen, denn Denken und wissenschaftliches Arbeiten ist auch an Kommunikation und Debatte gebunden. Beides bleibt ihm verschlossen. Für Stoner ist die Universität die einsame Insel seines Lebens, sein Schutzraum, die feste Burg, die ihn vor den Unbilden der bösen Welt bewahrt, vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, aber auch vor der eigenen Ehe und Familie. Als es - wen wundert es? - in Stoners Ehe kriselt, flüchtet er sich in seine wissenschaftliche Arbeit. Er beschäftigt sich mit dem Einfluss der lateinischen Klassiker auf Shakespeare und seine Zeitgenossen. Aber Publikationen bewahren nicht vor dem Überdruss des Lebens. Er ertappt sich dabei, nur noch dumpf auf Bücher und Manuskripte zu starren. Stoner wird an der Universität melancholisch und er verzagt. Das Grübeln über die Frage nach dem Sinn seines Lebens führt ihn zu der Einsicht: "Letzten Endes war alles, selbst das Studium, das ihm dieses Wissen ermöglichte, sinnlos und vergeblich und gerann zu einem unabänderlichen Nichts." (S.227). Stoner denkt über die Kraft nach, die sein Leben antreibt, und sie ist weder mit Vernunft noch mit Emotion gleichzusetzen. Er stellt sich eine Art Lebenskraft vor, die nur in begrenztem Umfang vorhanden ist, bis sie gegen Ende seines Lebens mit zunehmendem Alter, Krankheit und Gebrechlichkeit versiegt. Der Roman sagt: Stoner hat diese Lebenskraft verschwendet, das heißt sie nicht planvoll und bewusst eingesetzt, er hat sie verbraucht, als er auf eine bestimmte Weise emotional angerührt war. Und ein zweites fällt bei ihm auf: Niemals fließt seine Lebenskraft in Zorn, Streit, Hass oder Aggression. Stoner ist ein Jedermann, ein leidender Dulder, der die Leser fragt, ob sie genau wie er ihren langsam versiegenden Kräften nachtrauern oder ob sie nicht doch durch ein Quäntchen Rebellion ihrem Leben eine andere Richtung geben wollen. Die Energie der eigenen Selbsterhaltung reagiert auf eine Lebensdeutung, die sich als ein fortwährender Sog von Niederlagen darstellt. Obwohl dieses ein tieftrauriges Buch ist, gewinnt man als Leser diesen leicht schrulligen Literaturprofessor in seiner unnachahmlichen Mischung aus Melancholie, Duldung und Pragmatismus lieb. Die Figur rührt an die Zufälligkeit und Einsamkeit des einzelnen menschlichen Lebens, aber eben auch an seine Würde. Dieses Leben findet sich ungewollt in Verhältnissen wieder, in denen es nur untergehen kann. Die Unbarmherzigkeit, mit der Williams seine Titelfigur als Dulder vorstellt, ruft aber trotzdem die Frage nach Gegengewichten, die Frage nach dem Kampf hervor. Stoner verwirft mit der Sinnlosigkeit des Lebens zugleich auch die Aufklärung darüber. Bildung und Intellekt helfen nach seinem Urteil letztendlich nicht weiter. Stoner gelangt zu der - bestreitbaren - Erkenntnis, dass er ein verschwendetes, weggeworfenes Leben führt. Man kann Fragen nach den Gegengewichten stellen: Wäre nicht in schöpferischer Tätigkeit und wissenschaftlicher Arbeit solch ein Gegengewicht zu sehen? Ist die Ästhetik nicht eine Hilfe? Kein einziges Mal wird erzählt, dass Stoner sich die Tragödien und Komödien seines Hausgottes Shakespeare auf der Bühne angeschaut hätte. Wäre nicht Humor auch ein Ausweg? In diesem Roman wird leider nur sehr wenig gelacht. Und man könnte auch an einen aufgeklärten Glauben im Gefolge Hiobs denken. Der Leser verfolgt die Lebensgeschichte des armen Stoner zunehmend fassungslos, er möchte helfen und eingreifen, kann es aber nicht. Er kann nur wahrnehmen und sich im Herzen bewegen lassen. Williams hat einen im emphatischen Sinn bewegenden Roman geschrieben, der auf der anderen Seite an philosophische und theologische Fragestellungen rührt. Neben Hiob wären der Kierkegaard von "Entweder-Oder", Dostojewski mit dem Fürsten Myshkin und - natürlich - Shakespeare zu nennen. Bei letzterem finden sich die Gegenfiguren zu Stoner, wie man das Leben auch angehen kann: der jugendliche Grübler und Kämpfer Hamlet, der protestierende, aber eben auch scheiternde König Lear und der genießende Ästhet Falstaff. Sie alle scheitern wie Stoner oder sie werden mindestens belehrt. Stoners Lebensgeschichte ist eine Shakespearesche Tragödie in der Form eines Romans. |
|
Artikelnachweis: https://www.theomag.de/87/wv07.htm
|